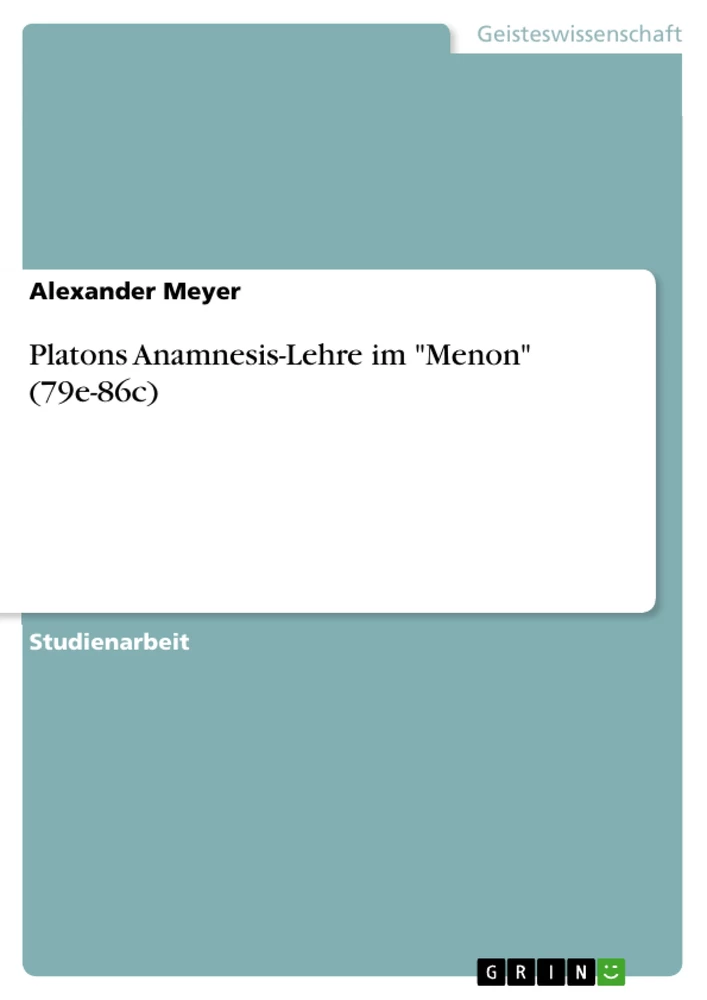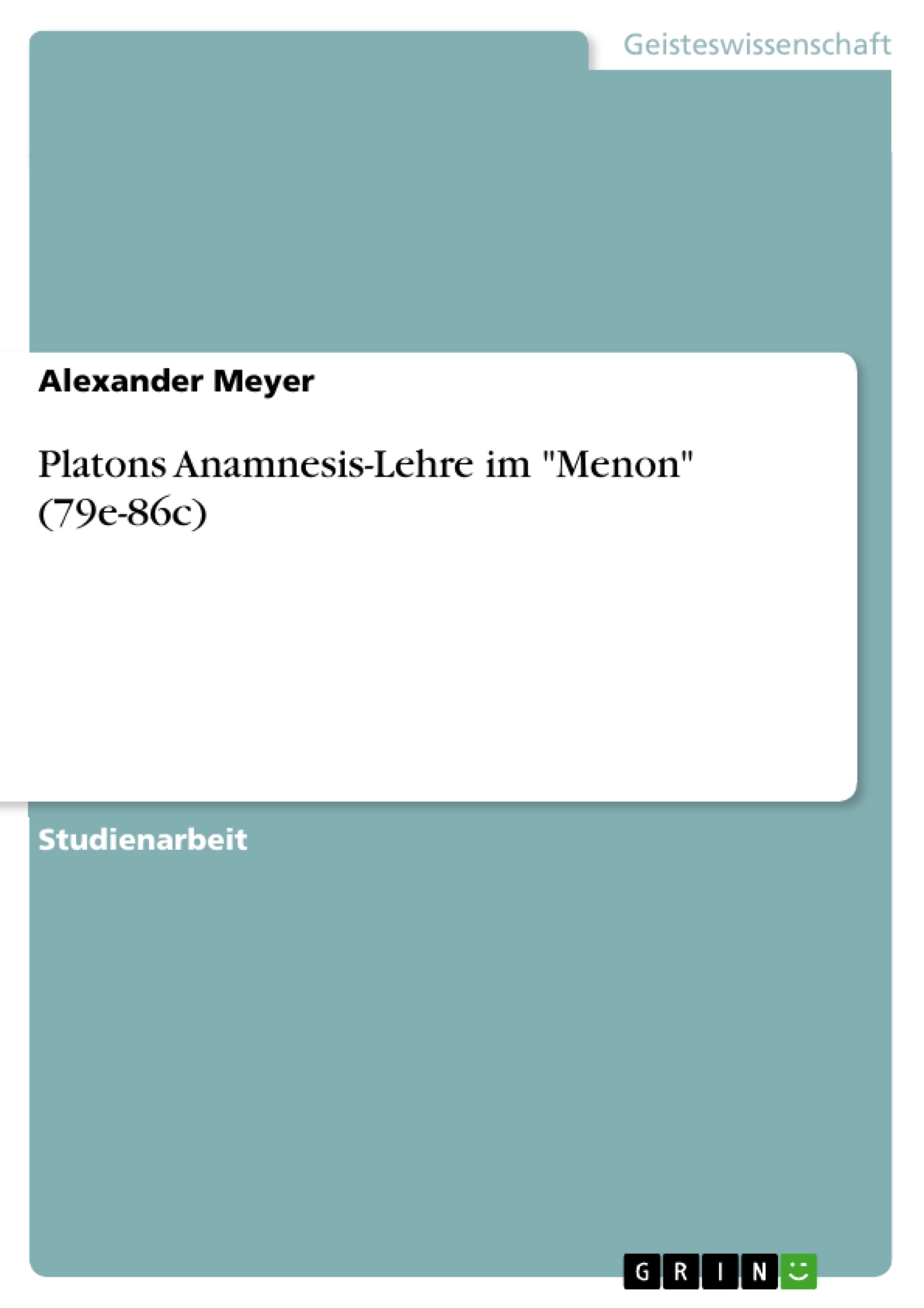Das Problem des Lernens wird im Dialog "Menon" vor dem Hintergrund der Lehr- bzw. Unlehrbarkeit der Tugend behandelt. Hierzu wird die paradox klingende These eingeführt, dass alles Lernen Wiedererinnerung an etwas bereits Bekanntes sei, nämlich an ein Wissen, das mit der Geburt verlorengegangen ist. Um diese Lehre, die eine Antwort auf das Problem des Lernens geben möchte, soll es in dieser Arbeit gehen, d.h. Platons Konzeption der Anamnesis-Lehre soll Gegenstand dieser Arbeit sein.
Hierzu soll zunächst in einem ersten Kapitel das erkenntnistheoretische Themenfeld der Erinnerung im Dialogganzen aufgespürt werden, d.h. die Erinnerungsspuren sollen entdeckt werden, um die Entwicklung hin zur Anamnesis-Theorie plausibel zu machen.
Anschließend soll gezeigt werden, dass die Aporie im Gespräch zwischen Sokrates und Menon keine eigentliche Ausweglosigkeit bedeutet, sondern eine Voraussetzung für die Vergegenwärtigung von Vergessenem darstellt. Es soll also deutlich werden, dass die Aporie die Voraussetzung für die Wiedererinnerung schafft.
Im dritten Kapitel sollen das Menon-Paradox und der Anamnesis-Mythos thematisiert werden, wodurch gezeigt werden soll, dass es sich bei der Anamnesis-Lehre offensichtlich um die Lehre von einem latenten Wissen handelt. Demnach wird die Anamnesis-Lehre als der Übergang von bloßer Meinung zum Wissen verstanden.
Anschließend soll im vierten Kapitel, das das Gespräch zwischen Sokrates und dem Sklaven von Menon (Geometriestunde) thematisieren wird, gezeigt werden, dass Sokrates seine Lehre durch das mathematische Beispiel für Menon exemplifiziert, um dessen falsches Verständnis der Aporie zu korrigieren. Hierbei wird auch aufgezeigt werden, weshalb Sokrates ein mathematisches Beispiel wählt und um welche Form von Wissen es sich dabei eigentlich handelt.
Es wird sich überdies zeigen, dass durch die Geometriestunde die Probleme für den Interpreten nicht kleiner werden. So wird im fünften Kapitel die Frage diskutiert werden, ob der Sklave tatsächlich aus sich selbst heraus zu der Lösung des mathematischen Problems gelangt ist, oder ob Sokrates dies mittels Suggestion erreicht hat. Nach einer vorläufigen Beantwortung dieser Frage soll der Versucht unternommen werden, den Gegenstand der Anamnesis genauer zu fassen. Drei mögliche Lesarten werden hierzu vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung: Platons Anamnesis-Lehre im Menon (79e-86c)
- Hauptteil
- 1. Erinnerungsspuren innerhalb des Dialogs
- 2. Ausgangspunkt der Anamnesis: Aporie (79e-80d)
- 3. Erkenntnismöglichkeit: Menon-Paradox (80d-e) und Anamnesis-Mythos (81a-e)
- 4. Das Sklaven-Gespräch : die Geometriestunde (81e-85d)
- 5. Suggestion und Gegenstand der Anamnesis-Lehre: drei Annäherungsversuche
- 6. Anamnesis und Unsterblichkeit (81a-e, 85d-86c)
- Schluss: Rekapitulation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit Platons Anamnesis-Lehre im Dialog Menon, der die Paradoxie des Lernens vor dem Hintergrund der Lehr- und Unlehrbarkeit der Tugend untersucht. Das Ziel dieser Arbeit ist es, Platons Konzeption der Anamnesis-Lehre zu analysieren und zu verstehen, wie sie als Antwort auf das Problem des Lernens dient.
- Die Erinnerungsspuren innerhalb des Dialogs
- Die Aporie als Voraussetzung für die Vergegenwärtigung von Vergessenem
- Das Menon-Paradox und der Anamnesis-Mythos als Darstellung des latenten Wissens
- Die Geometriestunde als Beispiel für die Exemplifizierung der Anamnesis-Lehre
- Die Frage der Suggestion und die Interpretationsoffenheit der Anamnesis-Lehre
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel untersucht die Erinnerungsspuren innerhalb des Dialogs Menon und zeigt auf, wie diese die Entwicklung hin zur Anamnesis-Theorie plausibel machen. Das zweite Kapitel betrachtet die Aporie im Gespräch zwischen Sokrates und Menon und argumentiert, dass diese keine Ausweglosigkeit darstellt, sondern eine Voraussetzung für die Wiedererinnerung schafft. Im dritten Kapitel werden das Menon-Paradox und der Anamnesis-Mythos thematisiert, wodurch gezeigt wird, dass die Anamnesis-Lehre von einem latenten Wissen ausgeht und den Übergang von bloßer Meinung zum Wissen repräsentiert.
Das vierte Kapitel analysiert das Gespräch zwischen Sokrates und dem Sklaven von Menon, die Geometriestunde, und zeigt, wie Sokrates seine Lehre durch dieses mathematische Beispiel exemplifiziert. Das fünfte Kapitel diskutiert die Frage, ob der Sklave tatsächlich selbst zu der Lösung des Problems gelangt oder ob Sokrates ihn durch Suggestion beeinflusst.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Anamnesis-Lehre, Platon, Menon, Tugend, Lernen, Aporie, Wissen, Meinung, Erinnerung, Unsterblichkeit, Suggestion, Geometriestunde, Interpretationsoffenheit. Diese Begriffe repräsentieren die wichtigsten Themen und Konzepte, die im Dialog Menon und der Analyse der Anamnesis-Lehre eine zentrale Rolle spielen.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Platons Anamnesis-Lehre?
Die Lehre besagt, dass alles Lernen eine Wiedererinnerung (Anamnesis) an Wissen ist, das die Seele bereits vor der Geburt besaß und dann vergessen hat.
Was ist das "Menon-Paradox"?
Es beschreibt das Problem, dass man weder das suchen kann, was man weiß (da man es schon weiß), noch das, was man nicht weiß (da man nicht weiß, wonach man suchen soll).
Welche Rolle spielt die Geometriestunde mit dem Sklaven?
Sokrates nutzt das Beispiel, um zu zeigen, dass ein ungebildeter Sklave mathematische Wahrheiten "aus sich selbst heraus" finden kann, was die Anamnesis belegen soll.
Was bedeutet "Aporie" im Dialog Menon?
Aporie bezeichnet einen Zustand der Ratlosigkeit. Laut Sokrates ist sie die notwendige Voraussetzung für das Lernen, da sie den Wunsch nach Wiedererinnerung weckt.
Wird die Anamnesis-Lehre als bewiesene Tatsache dargestellt?
Die Arbeit diskutiert, ob die Lösung im Sklavengespräch tatsächlich aus dem Sklaven kam oder durch Suggestion von Sokrates herbeigeführt wurde.
Wie hängen Anamnesis und Unsterblichkeit zusammen?
Die Fähigkeit zur Wiedererinnerung setzt voraus, dass die Seele unsterblich ist und in früheren Existenzen Wissen erworben hat.
- Arbeit zitieren
- Alexander Meyer (Autor:in), 2014, Platons Anamnesis-Lehre im "Menon" (79e-86c), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/309752