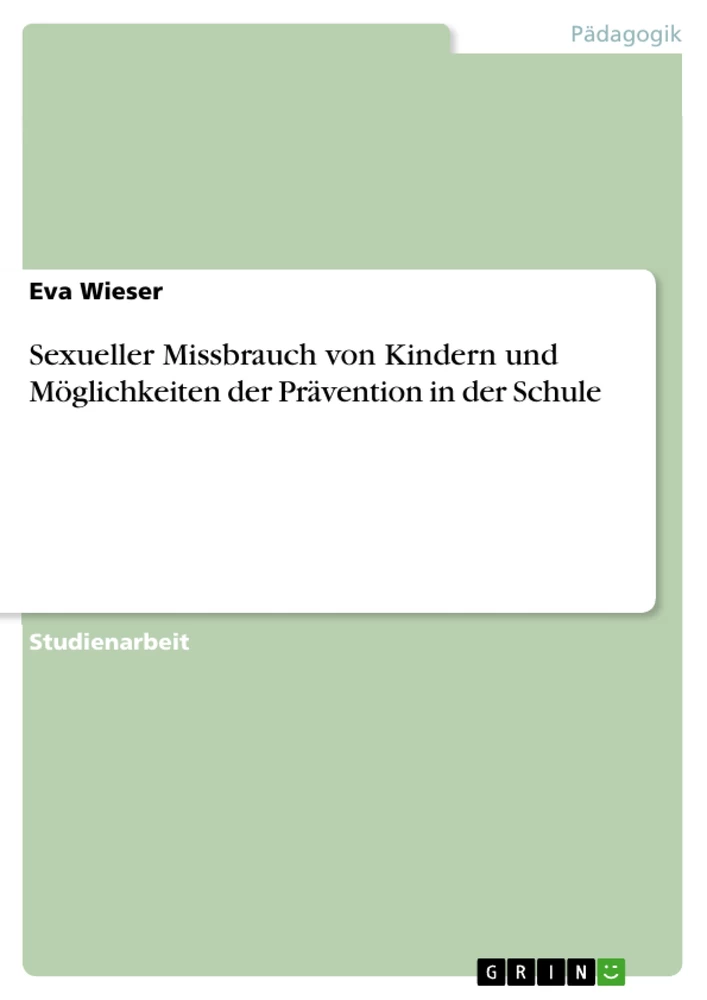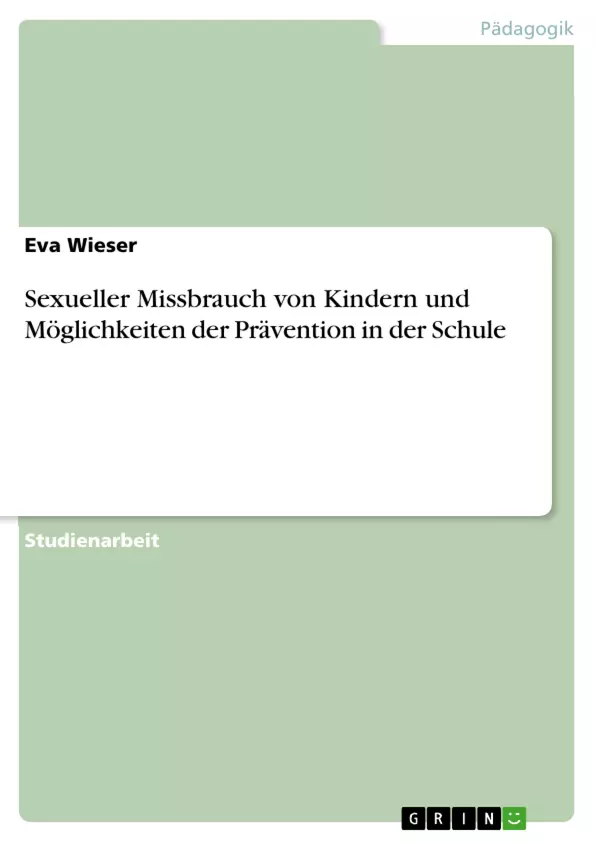Wie kann es zu sexuellen Übergriffen an Kindern kommen, ohne dass jemand Verdacht schöpft – sogar innerhalb der Familie? Gibt es ein bestimmtes Muster, nach dem die Täter vorgehen? Wie entwickeln sich die Opfer Jahre nach der Tat? Wie viele Opfer gibt es jährlich?
In dieser Arbeit setze ich mich mit den aufgezählten Fragen und angrenzenden Bereichen auseinander. Nach einer umfassenden Definition wird bzgl. des Täters auf folgende Fragestellungen besonders Wert gelegt: Gibt es Tätertypen? Welchen Bezug haben sie zum Kind? Welche Strategien nutzen sie, um sexuelle Handlungen an Kindern zu begehen?
Im Anschluss daran werden Fakten und Daten vorgestellt, um ein Bild über die Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs in Deutschland sowie über das Opfer-Täter-Verhältnis zu verschaffen. Es wird auch geklärt, warum drei Viertel aller sexuellen Missbrauchsfälle ausgerechnet auf Mädchen ausgeübt werden. Des Weiteren greife ich ausführlich die Frage auf, wie sich die Opfer von sexuellem Missbrauch langfristig entwickeln.
Im darauffolgenden Kapitel wird erläutert, warum Prävention bereits in der Grundschule so bedeutsam ist, und was in einem Präventionsprogramm alles enthalten sein sollte. Daraufhin wird ein Präventionsbaustein mit einem konkreten Praxisbeispiel näher ausgeführt. Zum Schluss äußere ich meine Meinung in einem kurz gehaltenen Fazit, wobei zum einen auf meine eigenen Erfahrungen bzgl. Aufklärung und zum anderen auf meine Absicht für die Zukunft eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Hinführung zur Thematik
- Was ist sexueller Missbrauch?
- Annäherung an den Begriff „sexueller Kindesmissbrauch“
- Schwierigkeit einer Definition
- Täter von sexuellen Übergriffen an Kinder
- Profil der Sexualstraftäter
- Strategien der Täter
- Kindliche Opfer von sexuellen Übergriffen
- Prävalenz von sexuellen Missbrauchserfahrungen
- Sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen
- Langfristige Entwicklung der Opfer
- Prävention in der Schule als Lernfeld
- Begründung für Prävention in der Schule
- Konkrete Präventionsbausteine
- Praktische Umsetzung
- Vorüberlegungen
- Praxisbeispiel zum Präventionsbaustein „Der eigene Körper“
- Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs an Kindern. Ziel ist es, ein umfassendes Bild dieses komplexen Themas zu zeichnen, indem die Definition, Täterprofile, Opferentwicklung und Präventionsmöglichkeiten beleuchtet werden. Dabei werden die spezifischen Herausforderungen in der Definition, die vielfältigen Strategien der Täter und die langfristigen Folgen für die Opfer aufgezeigt.
- Definition und Abgrenzung von sexuellem Kindesmissbrauch
- Profil und Strategien von Tätern sexueller Übergriffe
- Häufigkeit und Ausmaß sexueller Übergriffe an Kindern
- Langfristige Entwicklung von Opfern sexuellen Missbrauchs
- Prävention in der Schule als Instrument zur Sensibilisierung und Schutz
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Das erste Kapitel führt in das Thema sexueller Missbrauch an Kindern ein und zeigt die Relevanz und Aktualität des Themas anhand aktueller Ereignisse auf. Die Arbeit stellt verschiedene Fragestellungen in den Vordergrund, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
- Das zweite Kapitel widmet sich dem Begriff des sexuellen Kindesmissbrauchs und verdeutlicht die Schwierigkeiten, eine allgemeingültige Definition zu finden. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten des Missbrauchs und die unterschiedlichen Fachausdrücke, die in der Literatur verwendet werden.
- Das dritte Kapitel untersucht die Profile von Tätern und die Strategien, die sie zur Ausführung sexueller Übergriffe anwenden. Es werden verschiedene Muster und Verhaltensweisen beschrieben, wobei die Abhängigkeit zwischen Täter und Opfer als entscheidender Faktor hervorgehoben wird.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Opfern sexuellen Missbrauchs. Es werden statistische Daten zur Häufigkeit des Missbrauchs in Deutschland vorgestellt und die besonderen Herausforderungen für Mädchen und Jungen als Opfer beleuchtet. Zudem wird die langfristige Entwicklung von Opfern und die möglichen Folgen des Missbrauchs behandelt.
- Das fünfte Kapitel erörtert die Bedeutung von Prävention in der Schule als Lernfeld. Es werden verschiedene Präventionsbausteine vorgestellt und die praktische Umsetzung anhand eines konkreten Praxisbeispiels verdeutlicht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch, Täterprofile, Opferentwicklung, Prävention, Schule, Sexualisierte Gewalt, Definitionsprobleme, Strategien der Täter, Langfristige Folgen, Schutzmaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird sexueller Kindesmissbrauch definiert?
Es gibt keine einheitliche Definition, da der Begriff viele Facetten umfasst. Fachliteratur unterscheidet oft zwischen verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt und Missbrauch.
Welche Strategien nutzen Täter bei sexuellem Missbrauch?
Täter nutzen oft gezielte Manipulationsstrategien, um das Vertrauen des Kindes zu gewinnen und eine Abhängigkeit zu schaffen, häufig innerhalb des sozialen Nahfelds.
Warum sind Präventionsprogramme in der Grundschule wichtig?
Prävention in der Grundschule sensibilisiert Kinder für ihre eigenen Körpergrenzen und ermutigt sie, sich bei Übergriffen Hilfe zu suchen.
Gibt es typische Langzeitfolgen für die Opfer?
Opfer von sexuellem Missbrauch können langfristige psychische und soziale Beeinträchtigungen entwickeln, die ihre gesamte Lebensführung beeinflussen.
Wie ist das Opfer-Täter-Verhältnis in Deutschland?
Statistiken zeigen, dass ein Großteil der Missbrauchsfälle im familiären oder sozialen Umfeld stattfindet, wobei Mädchen häufiger betroffen sind als Jungen.
Was beinhaltet der Präventionsbaustein „Der eigene Körper“?
Dieser Baustein vermittelt Kindern ein Bewusstsein für körperliche Selbstbestimmung und hilft ihnen, "gute" von "schlechten" Berührungen zu unterscheiden.
- Quote paper
- Eva Wieser (Author), 2015, Sexueller Missbrauch von Kindern und Möglichkeiten der Prävention in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/306086