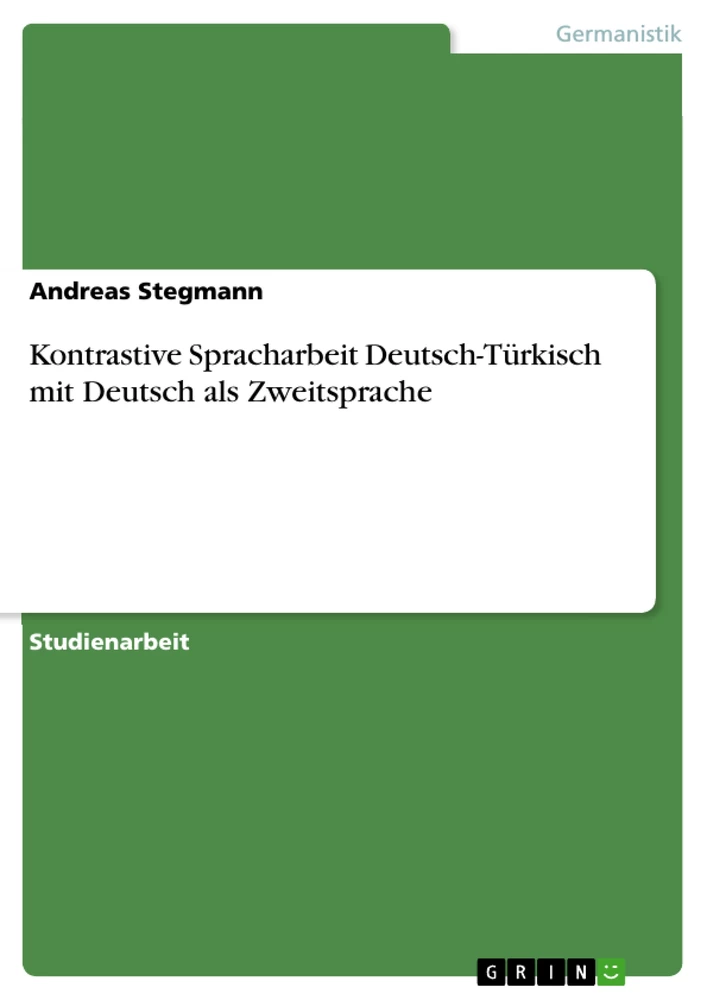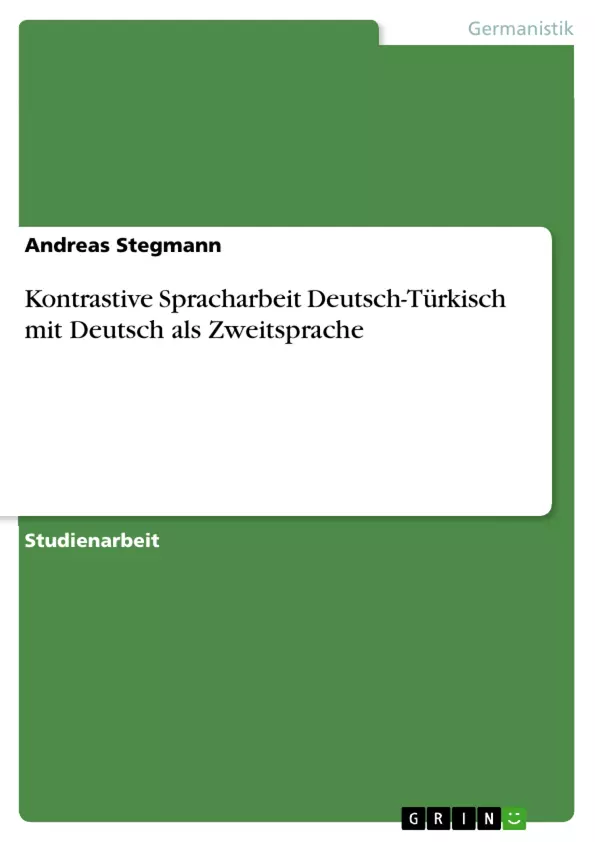Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat in der Comedy- und Medienlandschaft ein Phänomen stattgefunden, welches die Massen polarisiert. Diverse Künstler türkischer Herkunft haben damit begonnen, in einem verstümmelten, überspitzten Slang zu reden und damit ganze Fussballstadien zu füllen. In der Wissenschaft ist dieser Slang als Kiezdeutsch bekannt, in den Medien eher abwertend als Kanakendeutsch.
Was diese Künstler mit vollem Bewusstsein praktizierten, ist für viele Jugendliche leider der tatsächliche Sprachgebrauch. Mehrheitlich steht man diesem Phänomen kritisch gegenüber und nur vereinzelt treten Stimmen aus der Forschung auf, welche diese Sprachvariation als Soziolekt oder normale Jugendsprache verteidigend in Schutz nehmen. Hinzukommend ist die Diskussion um die Defizite des deutschen Bildungssystems allgegenwärtig und der dringende Handlungsbedarf scheint unausweichlicher denn je. Eine ausschlaggebende Determinante der Bildungsmisere ist die Mehrsprachigkeit innerhalb des Bildungssystems.
Schaut man sich deutsche Schulen genauer an, so sind SchülerInnen nicht-deutscher Herkunft schon längst in das gewohnte Bild integriert. Eltern, Schüler und Lehrer scheinen sich damit glücklicherweise abgefunden zu haben. Lange ging man davon aus, das Integration ein automatischer Prozess sei, der sich von selbst vollziehe. Jedoch gehen mit dem Begriff Einwanderungsland auch einige Verbindlichkeiten und Aufgaben für eine Nation einher.
In der vorliegenden Arbeit untersucht der Autor die bildungstheoretische, aber vor allem auch linguistische Thematik der Mehrsprachigkeit und sucht ferner nach Ursachen der Problematik und Maßnahmen zur Auflösung der Zweiklassen-Gesellschaft innerhalb der Schule. Schließlich muss auch Bürgern nicht-deutscher Herkunft eine moderate Chance auf Bildungserfolge geboten werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.0 Definitionen
- 1.1 Erstspracherwerb
- 1.2 Zweitspracherwerb
- 1.3 Interdependenzhypothese
- 1.4 Interlanguagehypothese
- 2.0 Bildungstheoretische Legitimation der L1-Förderung
- 2.1 Zielvereinbarung nach Maßgabe didaktischer Aspekte
- 2.2 Mehrsprachigkeit – Eine Notwendigkeit zur gelingenden Integration
- 2.3 Kognitive Vorteile durch Mehrsprachigkeit
- 3.0 Spracherwerb als Fundament der Schriftsprache
- 3.1 Alphabetisierung in zwei Sprachen
- 3.2 Konkretes Problem – der Buchstabe S - Veranschaulichung
- 3.2.1 1. Schritt: Erarbeitung der Gemeinsamkeit – das stimmlose S
- 3.2.2 2. Schritt: Einführung des türkischen Z – Vergleich mit dem stimmhaften S
- 3.2.3 3. Schritt: Gleicher Buchstabe - Unterschiedlicher Laut
- 4.0 Linguistische Betrachtung der Erwerbssprachen
- 4.1 Vergleich der deutschen und türkischen Sprache
- 4.2 Häufigste Fehlerquellen für Schüler mit türkischer L1 und deren Ursachen
- 4.3 Anforderungen an Förderkonzepte
- 5.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die bildungstheoretischen und linguistischen Aspekte der Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem, insbesondere im Hinblick auf Schüler*innen mit türkischer Muttersprache. Sie sucht nach Ursachen für bildungsbezogene Herausforderungen und möglichen Lösungsansätzen zur Überwindung von Sprachbarrieren und zur Förderung der Integration. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich des Deutschen und Türkischen und der Entwicklung geeigneter Förderkonzepte.
- Bildungstheoretische Legitimation der Förderung der Erstsprache (L1)
- Linguistischer Vergleich von Deutsch und Türkisch
- Häufige Fehlerquellen und deren Ursachen bei Schüler*innen mit türkischer L1
- Anforderungen an effektive Förderkonzepte für mehrsprachige Schüler*innen
- Der Einfluss der Erstsprache auf den Zweitspracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Phänomen von "Kiezdeutsch" und die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem, insbesondere im Kontext der PISA-Studie. Sie begründet die Notwendigkeit, Sprachbarrieren zu überwinden und die Chancen für Schüler*innen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Die Arbeit fokussiert sich auf die Untersuchung der bildungstheoretischen und linguistischen Aspekte der Mehrsprachigkeit, sucht nach Ursachen der Problematik und entwickelt Lösungsansätze für eine inklusive Bildung.
1.0 Definitionen: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Erstspracherwerb (L1), Zweitspracherwerb (L2), simultanen und sukzessiven Spracherwerb. Es werden die Interdependenzhypothese, welche die Wechselwirkung zwischen L1 und L2 beschreibt, und die Interlanguagehypothese, die den Zweitspracherwerb als kreativen Prozess mit der Bildung einer Lernsprache darstellt, erläutert. Der substraktive Bilingualismus und die Konzepte von BICS und CALP werden ebenfalls diskutiert. Die Bedeutung einer differenzierten Entwicklung der Erstsprache für den Erfolg im Zweitspracherwerb wird hervorgehoben.
2.0 Bildungstheoretische Legitimation der L1-Förderung: Dieses Kapitel argumentiert für die Bedeutung der Förderung der Erstsprache (L1) für Schüler*innen mit Migrationshintergrund. Es betont die Wichtigkeit didaktischer Zielsetzungen, insbesondere die phonologische und syntaktische Bewusstheit, sowie den Erwerb metasprachlicher Fähigkeiten (language awareness). Die positive Interdependenz zwischen L1- und L2-Entwicklung wird betont. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Kompetenzen, die über reine sprachliche Fertigkeiten hinausgehen.
3.0 Spracherwerb als Fundament der Schriftsprache: Dieses Kapitel befasst sich mit der Alphabetisierung in zwei Sprachen und erläutert konkrete Herausforderungen anhand des Beispiels des Buchstabens "S" im Deutschen und Türkischen. Es beschreibt einen dreistufigen Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderungen, der die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Laute in beiden Sprachen berücksichtigt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der phonologischen Unterschiede und der Entwicklung von Strategien zur Bewältigung dieser Unterschiede.
4.0 Linguistische Betrachtung der Erwerbssprachen: Dieses Kapitel vergleicht die deutsche und türkische Sprache, analysiert häufige Fehlerquellen bei Schüler*innen mit türkischer Muttersprache und deren Ursachen. Es leitet daraus Anforderungen an Förderkonzepte ab, die sowohl die linguistischen Unterschiede als auch die individuellen Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigen. Das Kapitel betont den Zusammenhang zwischen linguistischen Unterschieden und den Schwierigkeiten im Spracherwerb.
Schlüsselwörter
Erstspracherwerb (L1), Zweitspracherwerb (L2), Interdependenzhypothese, Interlanguagehypothese, Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), phonologische Bewusstheit, syntaktische Bewusstheit, kognitive Vorteile, Förderkonzepte, türkische Sprache, Integration, Bildung, Sprachbarrieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem - Fokus Türkisch
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die bildungstheoretischen und linguistischen Aspekte der Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem, insbesondere für Schüler*innen mit türkischer Muttersprache. Sie analysiert Herausforderungen, sucht nach Ursachen und entwickelt Lösungsansätze zur Überwindung von Sprachbarrieren und zur Förderung der Integration.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die bildungstheoretische Legitimation der Förderung der Erstsprache (L1), einen linguistischen Vergleich von Deutsch und Türkisch, häufige Fehlerquellen und deren Ursachen bei Schüler*innen mit türkischer L1, Anforderungen an effektive Förderkonzepte, und den Einfluss der Erstsprache auf den Zweitspracherwerb. Konkrete Beispiele, wie die Schwierigkeiten mit dem Buchstaben "S", werden ebenfalls erläutert.
Welche Definitionen werden im Text geklärt?
Der Text klärt grundlegende Begriffe wie Erstspracherwerb (L1), Zweitspracherwerb (L2), simultanen und sukzessiven Spracherwerb, die Interdependenzhypothese und die Interlanguagehypothese. Substraktiver Bilingualismus, BICS und CALP werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird die Bedeutung der L1-Förderung begründet?
Die Bedeutung der L1-Förderung wird durch die Betonung didaktischer Zielsetzungen (phonologische und syntaktische Bewusstheit, metasprachliche Fähigkeiten), die positive Interdependenz zwischen L1- und L2-Entwicklung und den Fokus auf die Entwicklung über reine sprachliche Fertigkeiten hinausgehende Kompetenzen begründet.
Wie wird der Spracherwerb als Fundament der Schriftsprache dargestellt?
Der Text beschreibt die Alphabetisierung in zwei Sprachen und erläutert Herausforderungen anhand des Buchstabens "S". Ein dreistufiger Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderungen, der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Laute in beiden Sprachen berücksichtigt, wird vorgestellt.
Wie werden die deutsche und die türkische Sprache linguistisch verglichen?
Der linguistische Vergleich analysiert häufige Fehlerquellen bei Schüler*innen mit türkischer Muttersprache und deren Ursachen. Daraus werden Anforderungen an Förderkonzepte abgeleitet, die sowohl linguistische Unterschiede als auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Erstspracherwerb (L1), Zweitspracherwerb (L2), Interdependenzhypothese, Interlanguagehypothese, Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), phonologische Bewusstheit, syntaktische Bewusstheit, kognitive Vorteile, Förderkonzepte, türkische Sprache, Integration, Bildung, Sprachbarrieren.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu Definitionen, zur bildungstheoretischen Legitimation der L1-Förderung, zum Spracherwerb als Fundament der Schriftsprache, zu einem linguistischen Vergleich der Sprachen und ein Fazit. Jedes Kapitel befasst sich detailliert mit den im jeweiligen Titel genannten Aspekten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Bedeutung der L1-Förderung, der Herausforderungen des Zweitspracherwerbs und der Notwendigkeit von Förderkonzepten, die die linguistischen Unterschiede zwischen Deutsch und Türkisch und die individuellen Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigen.
- Arbeit zitieren
- Andreas Stegmann (Autor:in), 2014, Kontrastive Spracharbeit Deutsch-Türkisch mit Deutsch als Zweitsprache, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/305338