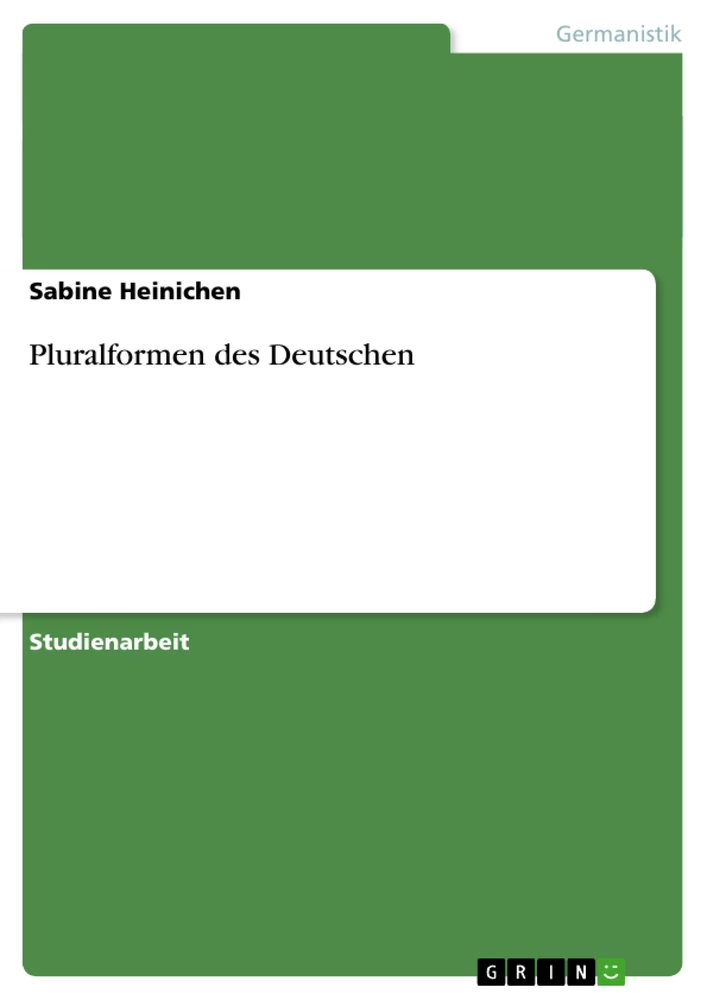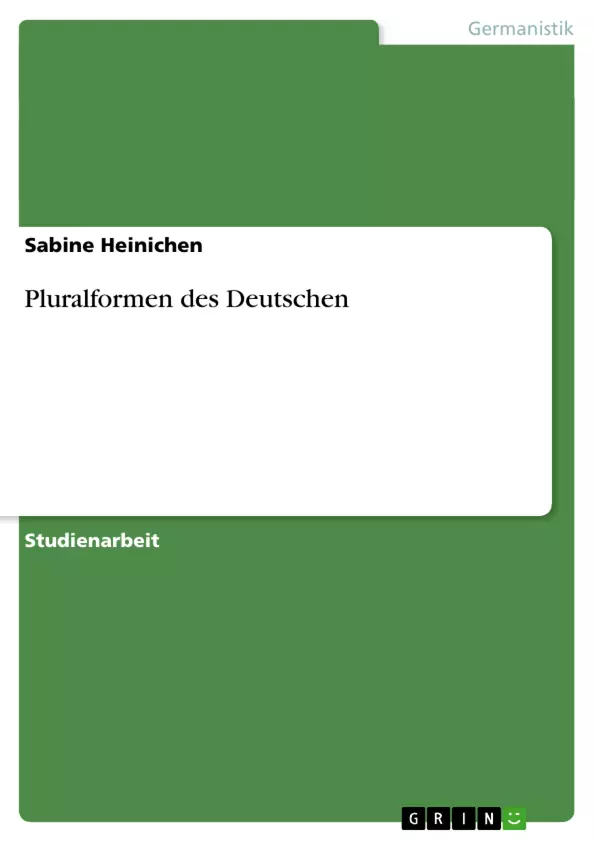Die zahlreichen Pluralformen des Deutschen sorgen bei fremdsprachigen Lernern immer wieder für Verwirrung, doch auch die Muttersprachler haben bei einzelnen Beispielen ihre Probleme. Trotzdem zeigen sich im Alltagsgebrauch meist kaum Schwierigkeiten. Wie ist das möglich? Welche Paradigmen und Grundlagen gehen diesem Gebrauch voraus? Die vorliegende Hausarbeit soll zwei verschiedene Auffassungen der deutschen Pluralflexion und deren Hintergründe vorstellen. Ich möchte ferner ihre Leistung für den Lerner und Fremdsprachler kritisch betrachten. Die ältere der beiden Auffassungen stammt von Wurzel (1994), der ich mich hier zuerst widmen möchte. Anschließend soll die neuere Theorie von Wunderlich (1999) untersucht werden. Letztendlich möchte ich versuchen, beide Theorien zu vergleichen und gemeinsame Schnittpunkte aufzuzeigen. Vor der Vorstellung von Wurzels und Wunderlichs Versuchen, die Pluralflexion einfacher, übersichtlicher und logischer zu erklären, möchte ich zunächst einmal die "klassische" Darstellung und Erklärung neueren und älteren Gebrauchsgrammatiken aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Pluralauffassungen in Gebrauchsgrammatiken
- 2.1. Pluralformen bei Jung (1968)
- 2.2. Pluralformen bei Heuer et. al. (2001)
- 2.2. Fazit
- 3. Wurzels (1994) Analyse der Pluralflexion
- 3.1. Vorüberlegungen
- 3.2. Die Erfassung der Substantivflexion
- 3.2.1. Getrennte Singular- und Pluralparadigmen
- 3.2.2. Einheitliche Paradigmen
- 3.2.3. Einheitliche Paradigmen (unter Betrachtung der Flexionsklassenmarkiertheit)
- 3.3. Wurzels Beitrag für das Erlernen der Pluralparadigmen
- 4. Wunderlichs (1999) Erfassung der Pluralflexion
- 4.1. Die Flexionsklassen
- 4.1.1. A: Untypische Nomen
- 4.1.2. B: Typische, nichtfeminine, nichtumlautende Nomen
- 4.1.3. C: Umlautende Nomen
- 4.1.4. D: Nichtfeminine mit r-Plural
- 4.1.5. E: Feminine Nomen ohne Umlaut
- 4.1.6. F: Nichtfeminine Nomen mit n-Plural
- 4.1.7. G: Nomen mit unterschiedlichen Singular und Pluralstämmen
- 4.1.8. H: Reguläre, schwache Nomen
- 4.1.9. I: Nichtreguläre, schwache Nomen
- 4.1.10. Zusammenfassende Betrachtung der Flexionsklassen von Wunderlich
- 4.2. Wunderlichs optimalitätstheoretischer Beitrag zur Pluralflexion
- 4.3. Wunderlichs Beitrag für das Erlernen der Pluralflexion
- 4.1. Die Flexionsklassen
- 5. Zusammenfassender Vergleich der Beiträge von Wunderlich und Wurzel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert zwei unterschiedliche Ansätze zur Erklärung der deutschen Pluralflexion: den Ansatz von Wurzel (1994) und den von Wunderlich (1999). Ziel ist es, die jeweiligen Stärken und Schwächen für Lernende aufzuzeigen und einen vergleichenden Überblick über beide Theorien zu bieten.
- Vergleichende Analyse der Pluralflexionstheorien von Wurzel und Wunderlich.
- Bewertung der Eignung beider Theorien für den Spracherwerb.
- Untersuchung der Komplexität der deutschen Pluralbildung.
- Analyse der Darstellung der Pluralflexion in Gebrauchsgrammatiken.
- Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den beiden Ansätzen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der komplexen deutschen Pluralbildung ein und hebt die Schwierigkeiten für Mutter- und Fremdsprachler hervor. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit, zwei unterschiedliche Theorien der Pluralflexion vorzustellen und deren Nützlichkeit für Lernende kritisch zu bewerten. Die Arbeit fokussiert sich auf die Ansätze von Wurzel (1994) und Wunderlich (1999), wobei Wurzel zuerst behandelt wird.
2. Pluralauffassungen in Gebrauchsgrammatiken: Dieses Kapitel vergleicht die Darstellung der Pluralflexion in traditionellen Gebrauchsgrammatiken, insbesondere bei Jung (1968) und Heuer et al. (2001). Es zeigt, dass die traditionellen Ansätze die Komplexität der Pluralbildung nur unzureichend auflösen und für Lernende oft unverständlich bleiben. Der Vergleich hebt die unterschiedlichen Klassifizierungssysteme und deren Limitationen hervor, beispielsweise die fehlenden Erklärungen für Umlautungen oder assimilierte Pluralformen bei Jung, sowie die unübersichtliche Vielzahl an Endungen bei Heuer et al. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende Diskussion der theoretischen Ansätze von Wurzel und Wunderlich, die eine systematischere Erklärung der Pluralflexion anstreben.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Analyse der deutschen Pluralflexion nach Wurzel (1994) und Wunderlich (1999)
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert und vergleicht zwei unterschiedliche Ansätze zur Erklärung der deutschen Pluralflexion: den Ansatz von Wurzel (1994) und den von Wunderlich (1999). Das Hauptziel ist es, die Stärken und Schwächen beider Ansätze für Lernende aufzuzeigen und einen umfassenden Vergleich zu bieten.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Theorien zur Pluralflexion von Hans-Jürgen Wurzel (1994) und Dieter Wunderlich (1999). Dabei wird jeweils die Systematik der Pluralbildung, die Klassifizierung der Nomen und die Eignung für den Spracherwerb untersucht.
Wie werden die Theorien von Wurzel und Wunderlich vorgestellt?
Die Hausarbeit beschreibt detailliert die Ansätze von Wurzel und Wunderlich. Für Wurzel wird die Analyse der Substantivflexion mit ihren unterschiedlichen Paradigmen (getrennte vs. einheitliche) behandelt. Für Wunderlich wird die Klassifizierung der Nomen in verschiedene Flexionsklassen mit ihren spezifischen Merkmalen (Umlaut, -n, -r, etc.) erläutert. Beide Ansätze werden im Hinblick auf ihre Eignung für das Erlernen der deutschen Pluralflexion bewertet.
Welche Rolle spielen Gebrauchsgrammatiken?
Die Hausarbeit untersucht zunächst die Darstellung der Pluralflexion in traditionellen Gebrauchsgrammatiken (z.B. Jung 1968, Heuer et al. 2001). Der Vergleich zeigt die Unzulänglichkeiten dieser traditionellen Ansätze auf und begründet die Notwendigkeit einer systematischeren Erklärung wie sie von Wurzel und Wunderlich angeboten werden.
Was sind die zentralen Themen der Hausarbeit?
Zentrale Themen sind der vergleichende Überblick über die Pluralflexionstheorien von Wurzel und Wunderlich, die Bewertung ihrer Eignung für den Spracherwerb, die Untersuchung der Komplexität der deutschen Pluralbildung und die Analyse der Darstellung der Pluralflexion in traditionellen Gebrauchsgrammatiken.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Pluralauffassungen in Gebrauchsgrammatiken, Wurzels Analyse der Pluralflexion, Wunderlichs Erfassung der Pluralflexion und einen zusammenfassenden Vergleich der Beiträge von Wunderlich und Wurzel. Jedes Kapitel geht detailliert auf die jeweiligen Aspekte ein.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit fasst die Stärken und Schwächen der Ansätze von Wurzel und Wunderlich zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich ihrer Eignung für den Spracherwerb. Es wird ein Vergleich der beiden Theorien vorgenommen, um ihre jeweiligen Vor- und Nachteile für Lernende aufzuzeigen.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Studierende der Linguistik, Germanistik und Sprachwissenschaft, die sich mit der deutschen Morphologie und dem Spracherwerb beschäftigen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über zwei bedeutende Theorien zur Erklärung der komplexen deutschen Pluralflexion.
- Quote paper
- Sabine Heinichen (Author), 2004, Pluralformen des Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/30515