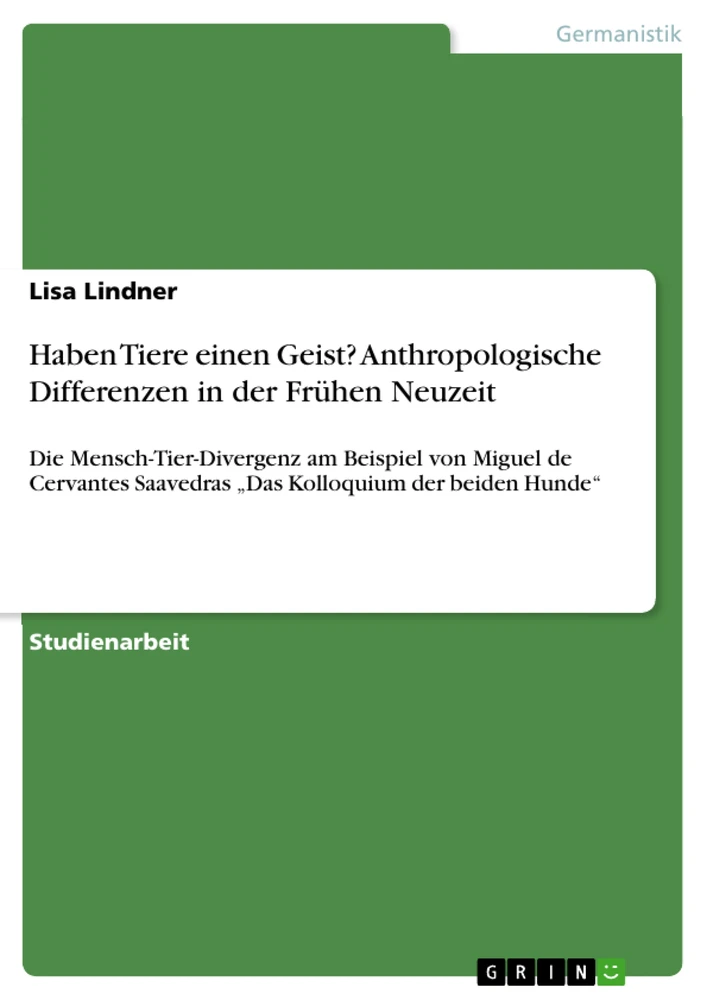Der Rolle des Geistes der Tiere wurde in der frühneuzeitlichen Philosophie ein großer Stellenwert zugesprochen.
Die Meinung anerkannter Philosophen wie Michel de Montaigne, René Descartes und David Hume bewegt sich von Montaignes Kritik der Verächter der Tiervernunft über Descartes Ablehnung eines tierischen Geistes zu Humes Verteidigung einer naturalistischen Betrachtungsweise unseres Geistes als einem tierlichen Geist.
Die anthropologische Differenz fragt nach dem Verhältnis zwischen menschlichem Lebens und dem Geist des Tieres.
Das Interesse an der Unterscheidung zwischen Mensch und Tier ist also nicht nur philosophisch, sondern vor allem anthropologisch begründet.
Das philosophisch-anthropologische Interesse am Tier ist eines humaner Selbstverständigung; und ein Schwergewicht innerhalb dieser Selbstverständigung bildet die Philosophie des Geistes.
Dabei ist zwischen der konsequenten Unterscheidung zwischen Mensch und Tier und der Annahme, dass auch der Mensch nur ein Tier ist, zu differenzieren.
Doch sind eben jene Charakteristika wie die menschliche Sprache, das Vermögen der Kommunikation, das Aufbauen einer Existenz oder etwa die Vernunft nicht auch ebenso einfach zu widerlegen? Die Philosophie des Geistes ist der Schlüssel zur anthropologischen Differenz.
Es sind vor allem die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, welche die größte Divergenz zulassen und die immer wieder in philosophischen und anthropologischen Forschungsansätzen aufgegriffen werden.
Im Folgenden soll untersucht werden, inwiefern sich die unterschiedlichen philosophischen Ansätze unterscheiden und begründen lassen und welche anthropologische Weltanschauung besonders in der Frühen Neuzeit vertreten war.
Am Beispiel der bereits genannten Philosophen Montaigne und Descartes soll jene Differenzierung sichtbar gemacht und verglichen werden.
Diesen Diskurs verschärfte auch Miguel de Cervantes Saavedras Novelle „Das Kolloquium der beiden Hunde“ von 1613.
Die analytischen Erkenntnisse, welche im ersten Teil primär durch Markus Wilds Studie zur anthropologischen Differenz in der Frühen Neuzeit am Beispiel der drei Philosophen Montaigne, Descartes und Hume gewonnen werden, sollen daher in einem zweiten Teil anschließend anhand Cervantes’ beispielhafter Erzählung ausgewertet und beurteilt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Anthropologische Differenzierungsmethoden im Kontext der Frühen Neuzeit
- 1. Philosophische Strategien unter Rückbezug auf die Historie
- 1.1 Differentialismus und Assimilationismus
- 1.2 Historischer Zugang - Der aristotelische Hintergrund
- 2. Tendenzen einer anthropologischen Differenz am Beispiel der Philosophen Montaigne und Descartes
- 2.1 Michel de Montaigne – Das Tier als vernünftiges Wesen
- 2.2 René Descartes - Das Tier als Maschine
- 1. Philosophische Strategien unter Rückbezug auf die Historie
- II. Die Mensch-Tier-Divergenz im Kontext von Miguel de Cervantes Saavedras „Das Kolloquium der beiden Hunde“
- 1. Miguel de Cervantes Saavedras exemplarische Novellen
- 1.1 Die Novelle Cervantes' als Exempel
- 1.3 Das Kolloquium der beiden Hunde
- 2. Die Frage nach der anthropologischen Differenz in Cervantes „Das Kolloquium der beiden Hunde“
- 2.1 Selbstreflexion des tierischen Sprachvermögens durch die beiden Hunde Cipión und Berganza
- 2.2 Der Vernunftbegriff in Kohärenz mit dem Sprachvermögen
- 2.3 Cervantes' Novelle im Rückbezug auf Montaignes Philosoph
- 1. Miguel de Cervantes Saavedras exemplarische Novellen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die anthropologische Differenz zwischen Mensch und Tier in der Frühen Neuzeit. Sie analysiert philosophische Ansätze zur Definition dieser Differenz und beleuchtet die Rolle des Sprachvermögens und der Vernunft. Im Fokus steht ein Vergleich verschiedener philosophischer Positionen und deren Anwendung auf ein literarisches Beispiel.
- Philosophische Strategien zur Bestimmung der Mensch-Tier-Differenz (Differentialismus vs. Assimilationismus)
- Der Vernunftbegriff bei Tieren und dessen Verbindung zum Sprachvermögen
- Analyse der anthropologischen Differenz in der Philosophie Montaignes und Descartes
- Die Darstellung der Mensch-Tier-Beziehung in Cervantes' „Das Kolloquium der beiden Hunde“
- Die Bedeutung von Sprache und Vernunft als Unterscheidungsmerkmale zwischen Mensch und Tier
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der anthropologischen Differenz zwischen Mensch und Tier in der Frühen Neuzeit ein. Sie betont die Bedeutung der philosophischen Auseinandersetzung mit dem "Geist der Tiere" bei Denkern wie Montaigne, Descartes und Hume und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Merkmalen, die Mensch und Tier unterscheiden, in den Mittelpunkt. Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz, der philosophische Analysen mit einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung von Cervantes' "Kolloquium der beiden Hunde" verbindet.
I. Anthropologische Differenzierungsmethoden im Kontext der Frühen Neuzeit: Dieses Kapitel untersucht verschiedene philosophische Strategien zur Bestimmung der anthropologischen Differenz. Es differenziert zwischen Differentialismus und Assimilationismus, wobei der Differentialismus auf kognitive Unterschiede, insbesondere das Sprachvermögen, als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal setzt. Der Assimilationismus hingegen betont die Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier. Das Kapitel beleuchtet den historischen Kontext, insbesondere den aristotelischen Hintergrund, und analysiert die Positionen von Montaigne und Descartes als exemplarische Beispiele für unterschiedliche philosophische Ansätze.
II. Die Mensch-Tier-Divergenz im Kontext von Miguel de Cervantes Saavedras „Das Kolloquium der beiden Hunde“: Dieses Kapitel analysiert Cervantes' Novelle "Das Kolloquium der beiden Hunde" im Hinblick auf die anthropologische Differenz. Es untersucht die Selbstreflexion der sprechenden Hunde Cipión und Berganza über ihr Sprachvermögen und die Frage nach der Vernunft bei Tieren. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Sprachfähigkeit und Vernunft als mögliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Mensch und Tier und dem Bezug zu Montaignes Philosophie.
Schlüsselwörter
Anthropologische Differenz, Frühe Neuzeit, Mensch-Tier-Verhältnis, Philosophie des Geistes, Sprachvermögen, Vernunft, Montaigne, Descartes, Cervantes, „Das Kolloquium der beiden Hunde“, Differentialismus, Assimilationismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Anthropologische Differenz zwischen Mensch und Tier in der Frühen Neuzeit
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die anthropologische Differenz zwischen Mensch und Tier in der Frühen Neuzeit. Sie analysiert philosophische Ansätze zur Definition dieser Differenz und beleuchtet die Rolle des Sprachvermögens und der Vernunft. Ein Vergleich verschiedener philosophischer Positionen und deren Anwendung auf ein literarisches Beispiel steht im Mittelpunkt.
Welche philosophischen Ansätze werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene philosophische Strategien zur Bestimmung der anthropologischen Differenz, insbesondere den Differentialismus (Fokus auf kognitive Unterschiede, Sprachvermögen) und den Assimilationismus (Betonung der Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier). Der historische Kontext, insbesondere der aristotelische Hintergrund, wird beleuchtet. Exemplarisch werden die Positionen von Montaigne und Descartes untersucht.
Welche Rolle spielen Montaigne und Descartes in der Arbeit?
Montaigne und Descartes werden als exemplarische Beispiele für unterschiedliche philosophische Ansätze zur anthropologischen Differenz herangezogen. Ihre Positionen bezüglich des Tieres (Montaigne: Tier als vernünftiges Wesen; Descartes: Tier als Maschine) werden analysiert und verglichen.
Welche Rolle spielt Cervantes' "Das Kolloquium der beiden Hunde"?
Cervantes' Novelle "Das Kolloquium der beiden Hunde" dient als literarisches Beispiel zur Analyse der anthropologischen Differenz. Die Selbstreflexion der sprechenden Hunde Cipión und Berganza über ihr Sprachvermögen und die Frage nach der Vernunft bei Tieren werden untersucht. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Sprachfähigkeit und Vernunft als mögliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Mensch und Tier und dem Bezug zu Montaignes Philosophie.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind: Anthropologische Differenz, Frühe Neuzeit, Mensch-Tier-Verhältnis, Philosophie des Geistes, Sprachvermögen, Vernunft, Differentialismus, Assimilationismus. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Sprache und Vernunft als Unterscheidungsmerkmale zwischen Mensch und Tier.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, zwei Hauptkapiteln und einer Zusammenfassung/einem Ausblick. Kapitel I untersucht philosophische Differenzierungsmethoden der Frühen Neuzeit, Kapitel II analysiert Cervantes' "Das Kolloquium der beiden Hunde" im Hinblick auf die anthropologische Differenz.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Welche Merkmale unterscheiden Mensch und Tier in der Frühen Neuzeit, und wie werden diese Merkmale in philosophischen und literarischen Texten dargestellt?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verbindet philosophische Analysen mit einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung. Sie verwendet einen vergleichenden Ansatz, um verschiedene philosophische Positionen zu analysieren und auf ein literarisches Beispiel anzuwenden.
- Quote paper
- Lisa Lindner (Author), 2014, Haben Tiere einen Geist? Anthropologische Differenzen in der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/302895