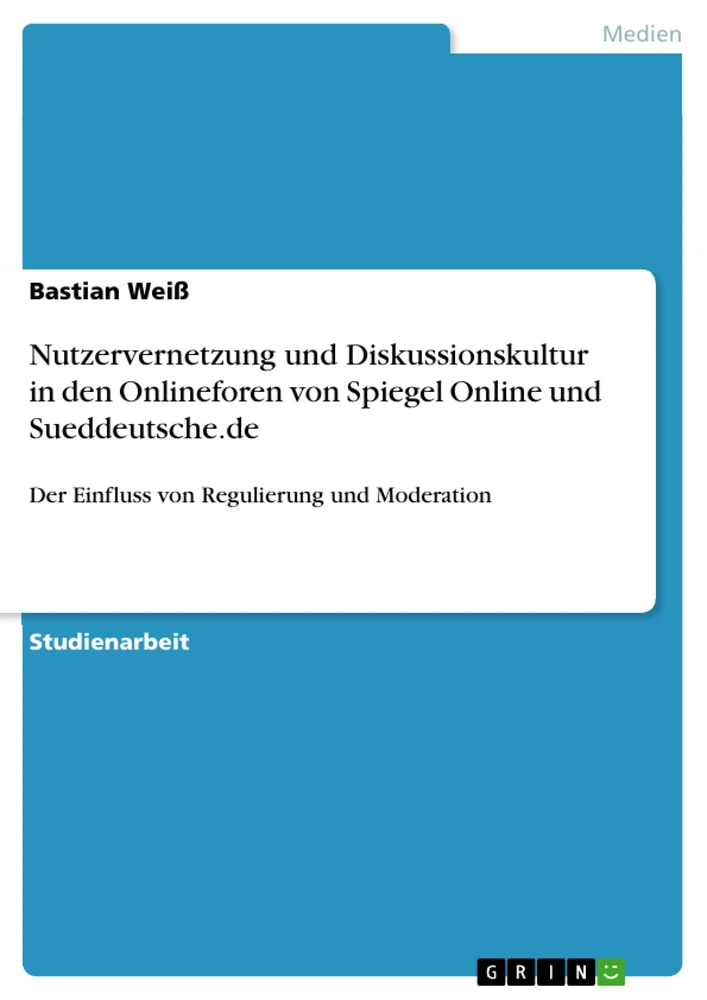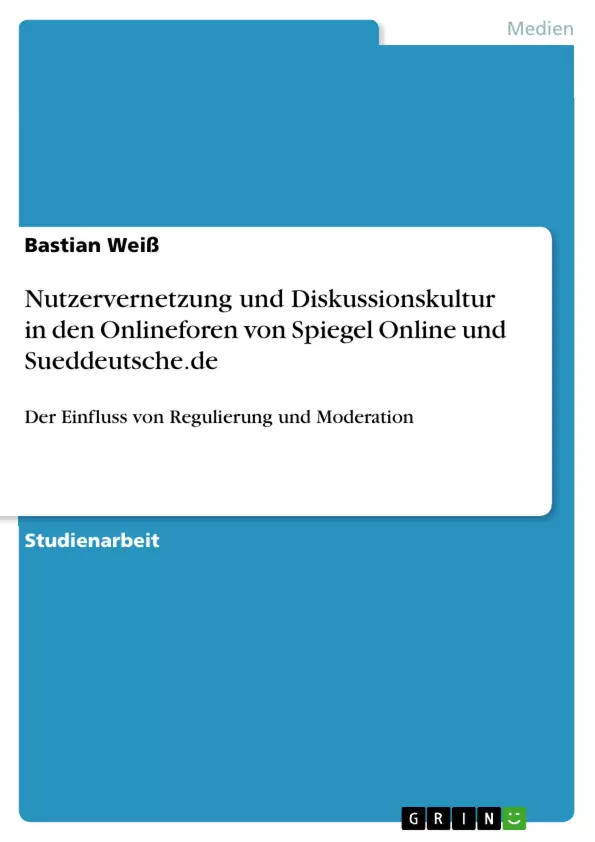Mit der Ukraine-Krise wurde eine Vertrauenskrise zwischen Journalisten und ihren Lesern medial reflektiert und inszeniert. Sie offenbarte sich nicht zuletzt in den Nutzerforen der Zeitungen, in denen Artikel diskutiert und teils scharf kritisiert werden - so scharf, dass sich äußernde User mit Begriffen wie "Putinversteher" diskreditiert werden.
Diese Arbeit nimmt solche Entwicklungen zum Anlass, die Diskussionskultur solcher Foren aus kultur-/figurationssoziologischer Perspektive beispielhaft an zwei Themen auf den Portalen Spiegel Online und Sueddeutsche.de zu untersuchen.
Unter Gesichtspunkten der Figurationssoziologie sind dabei Fragen zu klären wie: Welche Ziele verfolgen die Nutzer? Gibt es Meinungsführer? Wird aufeinander Bezug genommen, oder diskutiert man nebeneinander und damit aneinander vorbei? Welche sprachlichen Konventionen bilden sich aus?
Wie wird auf Provokationen reagiert, wie leicht driftet eine Diskussion ab?
Stets spielt in der Onlinekommunikation die Moderation eine wichtige Rolle. Trolle, Spam, Shitstorms - es gibt zahlreiche Phänomene mit plakativen Namen, an denen eine Forendiskussion scheitern kann.
Die Arbeit setzt daher einen Fokuspunkt auf den Vergleich der zwei unterschiedlich rigiden Regulierungsansätze der Onlineplattformen von Spiegel und SZ.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Methodik
- 1.2. Material
- 2. Grundlagen
- 2.1. Die Plattformen Spiegel Online und Sueddeutsche.de
- 2.2. Theoretische Konzepte
- 3. Analyse
- 3.1. Nutzeroberflächen von Spiegel Online und Sueddeutsche.de
- 3.2. Kommunikationsanalyse
- 3.2.1. Nutzertypen und ihre Ziele
- 3.2.2. Gepflogenheiten, Umgangston und Streitkultur
- 3.3. Vergleich
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht aus kultursoziologischer Perspektive die Diskussions- und Vernetzungsprozesse von Nutzern in den Onlineforen von Spiegel Online und der Süddeutschen Zeitung. Im Fokus stehen die Ziele der Nutzer, die Entstehung von Meinungsführerschaft, die Kommunikationsmuster (Referenzierung, Nebeneinander-Diskussion), sprachliche Konventionen, Reaktionen auf Provokationen und das Abdriften von Diskussionen. Der Einfluss unterschiedlicher Moderationsstrategien auf die Nutzerinteraktion soll anhand eines Vergleichs der beiden Plattformen explorativ untersucht werden.
- Analyse der Nutzerziele und -typen in Online-Foren
- Untersuchung der Kommunikationsmuster und -strukturen in den Foren
- Einfluss von Moderation und Regulierung auf die Diskussionskultur
- Vergleich der Diskussionskulturen auf Spiegel Online und Süddeutsche.de
- Exploration der Bedingungen für gelingende und scheiternde Online-Diskussionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt das sinkende Vertrauen in die Medien aufgrund von Missständen und der verbreiteten „Lügenpresse“-Rhetorik. Sie thematisiert den Wandel vom klassischen „One-to-Many“-Journalismus hin zu interaktiveren Formen wie Online-Foren und deren Potenzial sowie Herausforderungen (Spam, Trolle, Shitstorms). Die Arbeit untersucht exemplarisch an Spiegel Online und Süddeutsche.de die Nutzervernetzung und -diskussion in deren Foren aus kultursoziologischer Perspektive, fokussiert auf Nutzerziele, Meinungsführerschaft, Kommunikationsmuster, sprachliche Konventionen und Reaktionen auf Provokationen, sowie den Einfluss unterschiedlicher Moderationsstrategien.
1.1. Methodik: Diese Sektion beschreibt die gewählte qualitative Inhaltsanalyse eines thematisch vergleichbaren Diskussionsstrangs auf beiden Plattformen, basierend auf dem Ansatz von Bettina Hollstein. Es wird ein interpretativer „Nachvollzug von Sinn und Sinnbezügen“ angestrebt, um die Bedingungen für gelingende (Austausch, Bezugnahme, Respekt) und scheiternde (Flaming, Trolling) Diskussionen zu untersuchen. Der theoretische Rahmen wird in Kapitel 2.2. erläutert, die Analyse des Materials in Kapitel 3, und ein Vergleich in Kapitel 3.3. durchgeführt. Der begrenzte Umfang erlaubt nur eine explorative Vorgehensweise, die Tendenzen aufzeigt und Hinweise für weitere Forschung gibt.
1.2. Material: Hier wird das für die Analyse verwendete Material spezifiziert: Diskussionsstränge zu einem ähnlichen Thema (CIA-Folterbericht) auf Spiegel Online und Süddeutsche.de. Die Auswahl begründet sich auf thematische Ähnlichkeit und Umfang der Kommentare (112 bei Spiegel, 129 bei Süddeutsche, Stand Februar 2015). Es wird kurz auf forschungsethische Aspekte eingegangen, da die Foren öffentlich zugänglich sind.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel (nicht detailliert im Ausgangstext) würde vermutlich theoretische Grundlagen zur Online-Kommunikation, Netzwerkanalyse, und Figurationssoziologie vorstellen, um den analytischen Rahmen der Arbeit zu etablieren.
3. Analyse: Dieser Abschnitt (ebenfalls nicht im Detail beschrieben) würde die detaillierte Analyse der ausgewählten Forenbeiträge umfassen, unterteilt in die Analyse der Nutzeroberflächen und die Kommunikationsanalyse (Nutzertypen, Ziele, Gepflogenheiten, Umgangston). Ein Vergleich der Ergebnisse für beide Plattformen würde den Abschluss dieses Kapitels bilden.
Schlüsselwörter
Nutzervernetzung, Online-Foren, Diskussionskultur, Spiegel Online, Süddeutsche.de, Moderation, Regulierung, Kommunikationsanalyse, Inhaltsanalyse, qualitative Forschung, Figurationssoziologie, Online-Kommunikation, Meinungsführerschaft, CIA-Folterbericht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Online-Foren auf Spiegel Online und Süddeutsche.de
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Diskussions- und Vernetzungsprozesse von Nutzern in den Online-Foren von Spiegel Online und der Süddeutschen Zeitung aus kultursoziologischer Perspektive. Der Fokus liegt auf den Zielen der Nutzer, der Entstehung von Meinungsführerschaft, den Kommunikationsmustern, sprachlichen Konventionen, Reaktionen auf Provokationen und dem Einfluss unterschiedlicher Moderationsstrategien.
Welche Methodik wurde angewendet?
Es wurde eine qualitative Inhaltsanalyse eines thematisch vergleichbaren Diskussionsstrangs auf beiden Plattformen durchgeführt, basierend auf dem Ansatz von Bettina Hollstein. Es wurde ein interpretativer „Nachvollzug von Sinn und Sinnbezügen“ angestrebt, um die Bedingungen für gelingende und scheiternde Diskussionen zu untersuchen.
Welches Material wurde analysiert?
Die Analyse basiert auf Diskussionssträngen zum Thema CIA-Folterbericht auf Spiegel Online und Süddeutsche.de (jeweils ca. 100 Kommentare, Stand Februar 2015). Die Auswahl erfolgte aufgrund der thematischen Ähnlichkeit und des Umfangs der Kommentare. Die Foren sind öffentlich zugänglich.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der Nutzerziele und -typen, die Untersuchung der Kommunikationsmuster und -strukturen, den Einfluss von Moderation und Regulierung, den Vergleich der Diskussionskulturen auf beiden Plattformen und die Exploration der Bedingungen für gelingende und scheiternde Online-Diskussionen.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich (obwohl im Ausgangstext nicht detailliert beschrieben) vermutlich auf theoretische Grundlagen zur Online-Kommunikation, Netzwerkanalyse und Figurationssoziologie, um den analytischen Rahmen zu etablieren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (mit Methodik und Materialbeschreibung), einen Grundlagenteil (theoretischer Rahmen), einen Analyseteil (mit Unterkapiteln zu Nutzeroberflächen und Kommunikationsanalyse, inklusive eines Vergleichs) und einen Schluss.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nutzervernetzung, Online-Foren, Diskussionskultur, Spiegel Online, Süddeutsche.de, Moderation, Regulierung, Kommunikationsanalyse, Inhaltsanalyse, qualitative Forschung, Figurationssoziologie, Online-Kommunikation, Meinungsführerschaft, CIA-Folterbericht.
Welche konkreten Aspekte der Online-Kommunikation werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Nutzertypen und ihre Ziele, die Gepflogenheiten, den Umgangston und die Streitkultur in den Online-Foren. Es wird untersucht, wie sich die Kommunikationsmuster (Referenzierung, Nebeneinander-Diskussion) und sprachliche Konventionen auf die Diskussionen auswirken.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit wird eine explorative Vorgehensweise angewendet, die Tendenzen aufzeigt und Hinweise für weitere Forschung liefert. Es werden Erkenntnisse zu den Bedingungen für gelingende und scheiternde Online-Diskussionen erwartet.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Diskussionskultur in Online-Foren von etablierten Medien zu untersuchen und die Einflüsse von Moderation und Nutzerverhalten auf die Qualität der Online-Debatte zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Bastian Weiß (Autor:in), 2015, Nutzervernetzung und Diskussionskultur in den Onlineforen von Spiegel Online und Sueddeutsche.de, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/302571