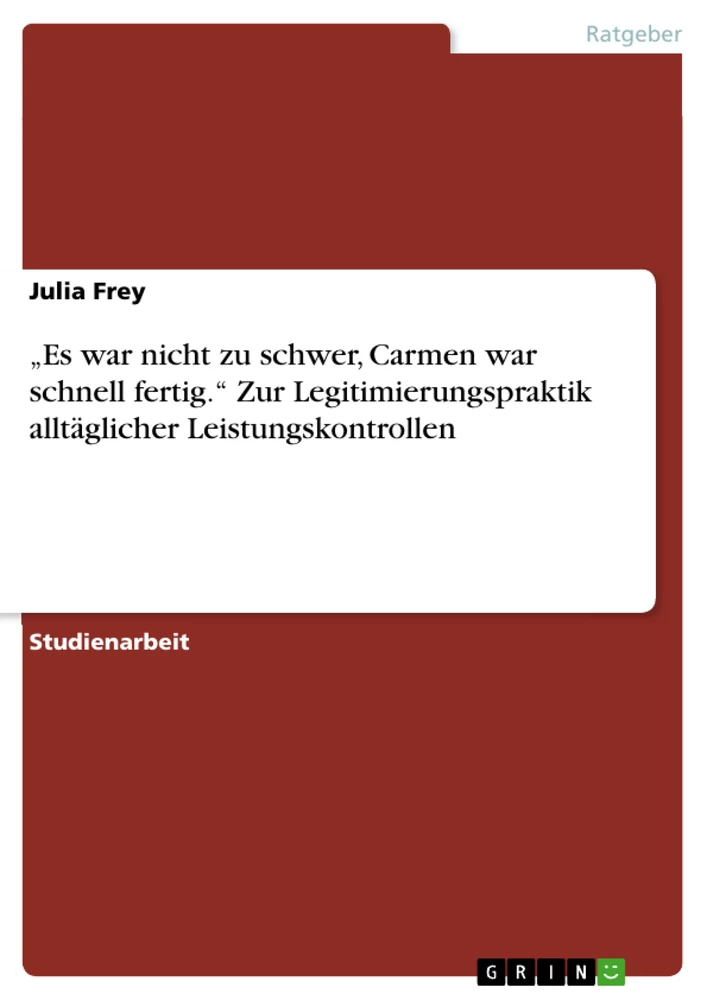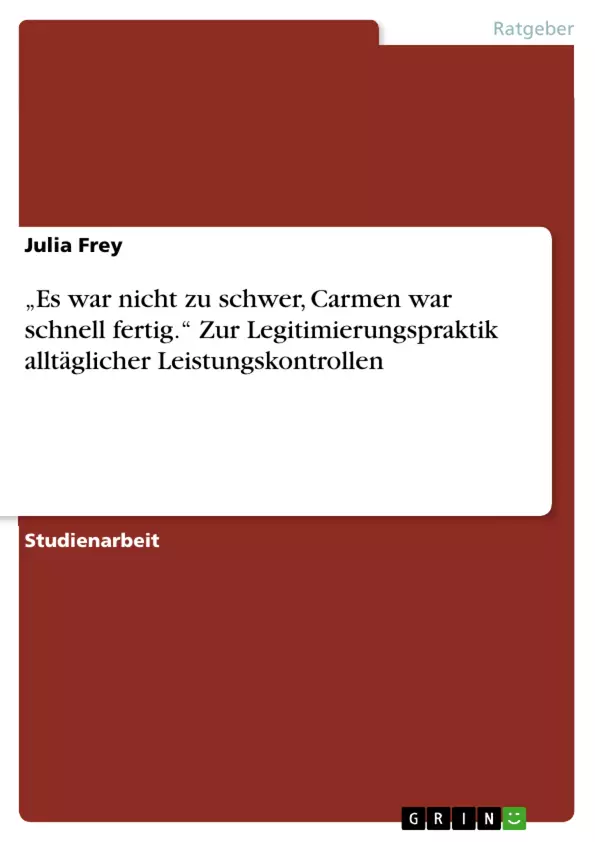„Unterricht verläuft systematisch und geplant, d. h. in methodisch strukturierter Weise, durch die ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll.“ (Rabenstein 2010, S. 25). Diese Zielerreichung ist einer Kontrolle unterzogen, welche sich zum Beispiel in Form einer mit Ziffernoten bewerteten Leistungskontrolle der Schülerinnen und Schüler (SuS) niederschlägt.
Jene Notenvergabe soll neben anderen zu erfüllenden Kriterien vor allem objektiv verlaufen. Dennoch wird sie im Unterricht immer wieder „verhandelt“. Dabei wird die jeweilige Note für die einzelnen SuS subjektiv bedeutsam „gemacht“. Die Erklärungen sollen die erteilte Note zu der Person, die sie erhält, in Verhältnis setzen (Vgl. Zaborowski et al. 2012, S. 172). Eine Zwei ist eben keinesfalls nur eine Zwei, sondern etwa für eine Schülerin oder einen Schüler eine ganz tolle Leistung, während sie für eine/n andere/n eine kleine Enttäuschung darstellt.
Zaborowski zufolge kommt die schulische Praxis gar nicht umhin, Noten zu relativieren, und damit zu subjektivieren, sonst könne sie einigen SuS niemals Erfolge vermitteln und andere aufgrund permanenten Erfolges kaum noch motivieren (ebd.).
Letztlich ist diese Subjektivierung von Zensuren auch notwendig, um diese als objektive Konstruktionen zu stabilisieren und so ihre Legitimität zu sichern (ebd.).
Subjektivierung stellt jedoch nur eine mögliche Strategie dar, die jeweilige Note zu legitimieren. Im Schulalltag finden sich zahlreiche weitere Strategien, um Noten und nicht zuletzt die Notenvergabe selbst für legitim zu erklären. Aus der Distanz betrachtet, scheint diesen Legitimierungsversuchen eine gewisse Eigenlogik innezuwohnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematik und Allgemeines Vorgehen
- Methode
- Unterrichtsforschung
- Objektive Hermeneutik
- Unterrichtsqualitätsforschung
- Leistungsbewertung - Theoretischer Hintergrund
- Funktionen von Leistungsbewertungen
- Legitimation von Noten
- Analyse der 1. Unterrichtssequenz (siehe Anhang A)
- Analyse mithilfe der Objektiven Hermeneutik (Rekonstruktive Analyse)
- Routinen
- Legitimierungsstrategien
- Analyse unter dem Aspekt der Unterrichtsqualitätsforschung
- Analyse der 2. Unterrichtssequenz (siehe Anhang B)
- Analyse mithilfe der Objektiven Hermeneutik (Rekonstruktive Analyse)
- Routinen
- Legitimierungsstrategien
- Analyse unter dem Aspekt der Unterrichtsqualitätsforschung
- Fazit
- Vergleich der untersuchten Sequenzen
- Schlusswort
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Legitimierungspraktik alltäglicher Leistungskontrollen im Unterricht. Sie analysiert, wie Lehrerinnen und Lehrer Noten im Unterricht „verhandeln“ und ihre Bewertung für die Schülerinnen und Schüler subjektiv bedeutsam machen, um die Legitimität von Noten zu sichern. Die Arbeit untersucht zwei Unterrichtssequenzen, in denen es zu Leistungskontrollen kommt, mithilfe der Objektiven Hermeneutik und der Unterrichtsqualitätsforschung.
- Legitimierung von Noten im Unterricht
- Objektive Hermeneutik als Analysemethode
- Unterrichtsqualitätsforschung als Analysemethode
- Rekonstruktion von Routinen und Legitimierungsstrategien
- Vergleich verschiedener Analysemethoden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert das allgemeine Vorgehen. Sie beschreibt die Notwendigkeit, Leistungskontrollen im Unterricht zu legitimieren und die verschiedenen Strategien, die Lehrerinnen und Lehrer dafür einsetzen. Die Methode der Objektiven Hermeneutik und der Unterrichtsqualitätsforschung wird vorgestellt.
Kapitel 2 beleuchtet die Unterrichtsforschung und fokussiert auf die Objektive Hermeneutik und die Unterrichtsqualitätsforschung. Die Objektive Hermeneutik wird als eine strikt analytische Methode zur Rekonstruktion von objektiven Sinn- und Bedeutungsstrukturen vorgestellt. Die Unterrichtsqualitätsforschung hingegen fokussiert auf die Evaluation der Unterrichtsqualität.
Kapitel 3 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der Leistungsbewertung. Es werden die Funktionen von Leistungsbewertungen und die Legitimation von Noten diskutiert.
Kapitel 4 analysiert die erste Unterrichtssequenz mithilfe der Objektiven Hermeneutik und der Unterrichtsqualitätsforschung. Es werden Routinen und Legitimierungsstrategien identifiziert, die in der Sequenz zum Einsatz kommen.
Kapitel 5 analysiert die zweite Unterrichtssequenz mithilfe der Objektiven Hermeneutik und der Unterrichtsqualitätsforschung. Es werden ebenfalls Routinen und Legitimierungsstrategien identifiziert und analysiert.
Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Analyse beider Unterrichtssequenzen zusammen und vergleicht die Ergebnisse beider Analysemethoden.
Schlüsselwörter
Schulpädagogik, Unterrichtsforschung, Objektive Hermeneutik, Unterrichtsqualitätsforschung, Leistungskontrolle, Legitimation, Noten, Routinen, Legitimierungsstrategien, Analysemethoden
- Quote paper
- Julia Frey (Author), 2015, „Es war nicht zu schwer, Carmen war schnell fertig.“ Zur Legitimierungspraktik alltäglicher Leistungskontrollen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/301984