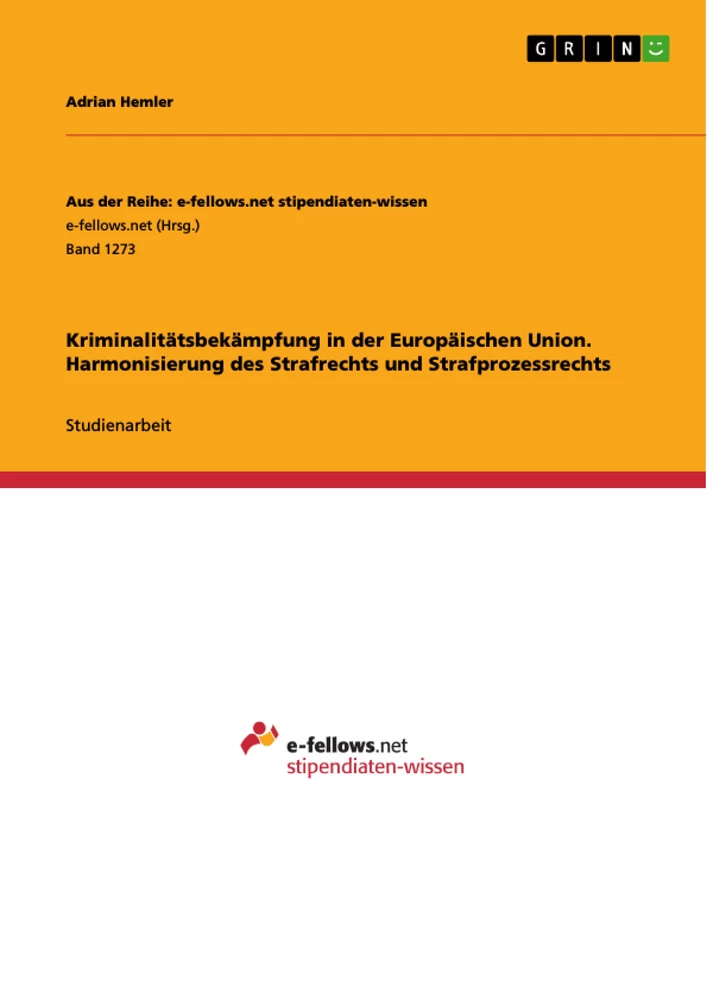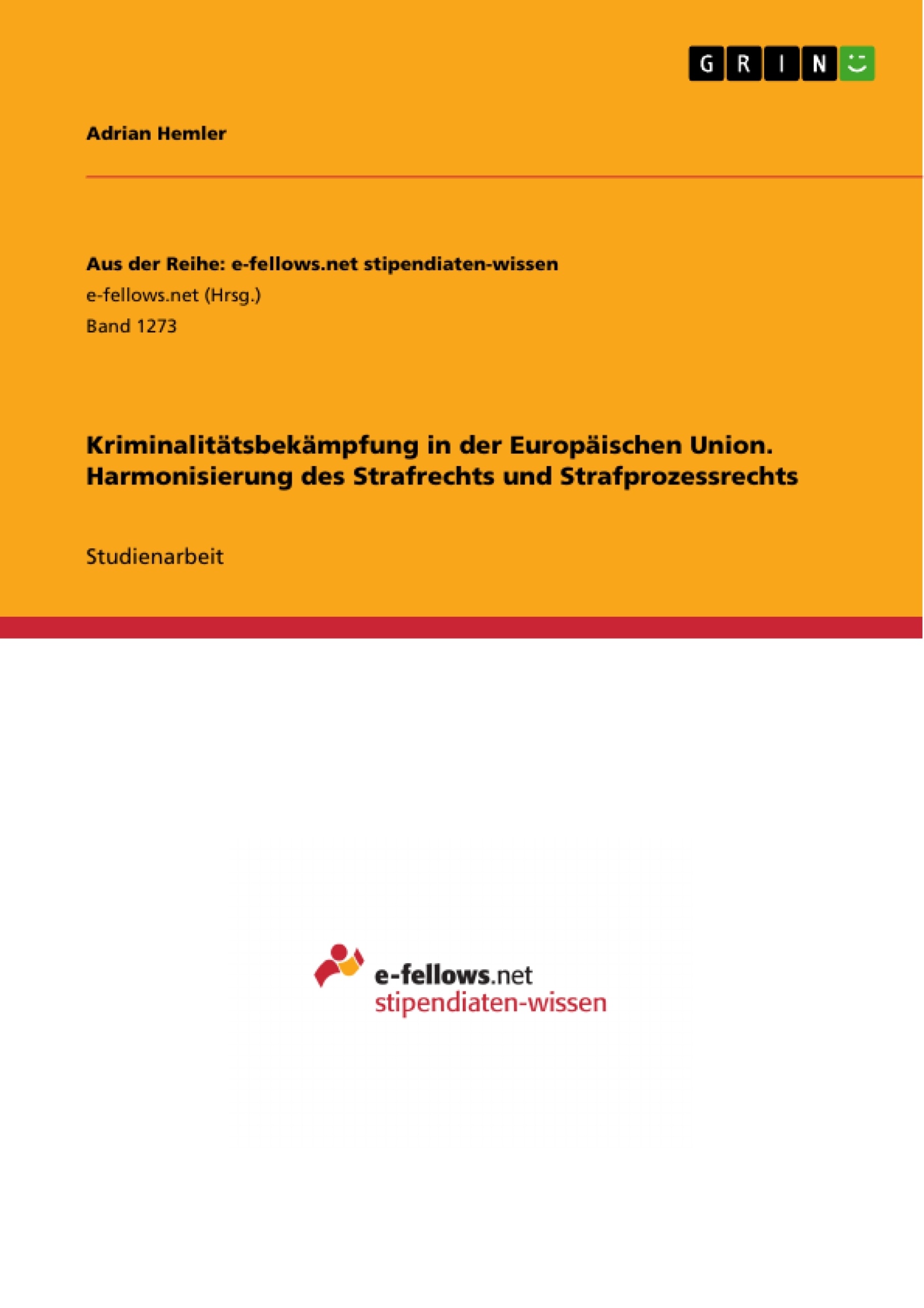In einer Europäischen Union, in der häufig nur verlassene Grenzanlagen daran erinnern, dass die europäischen Grundfreiheiten vor wenigen Dekaden keine Selbstverständlichkeit waren, führen unsichtbare Schlagbäume dem nationalen Recht weiterhin seine Territorialgebundenheit vor Augen. Das zeigt sich besonders im Bereich des Strafrechts und Strafprozessrechts.
Die technischen, wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Globalisierung und Europäisierung fördern eine zunehmende Anzahl transnationaler Sachverhalte zutage, die von der mitgliedsstaatlichen Strafgewalt nicht mehr allein erfasst werden können. Daneben sorgt auch der Missbrauch der Grundfreiheiten für die Zunahme grenzüberschreitender Straftaten: So birgt etwa die Kapitalverkehrsfreiheit neben ihrem Nutzen als unabdingbare Grundlage des Binnenmarkts auch die Möglichkeit zur Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte.
Daher stehen der EU im Vertrag von Lissabon sektorielle Kompetenzen im Bereich des Strafrechts und Strafprozessrechts zur Verfügung. Diese und ihre Grenzen stehen im Fokus dieser Untersuchung, die im März 2014 als Studienabschlussarbeit im Fachbereich Rechtswissenschaften im Schwerpunkt Internationales Recht verfasst wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Europäische Union und ihre Strafrechtspolitik
- Die Kompetenzgrundlagen der EU im Strafrecht
- Die Ziele der Europäischen Strafrechtspolitik
- Die Methoden der Europäischen Strafrechtspolitik
- Harmonisierung des Strafrechts
- Das Konzept der Strafrechtsharmonisierung
- Die Harmonisierung des materiellen Strafrechts
- Die Harmonisierung des Strafprozessrechts
- Die Auswirkungen der Strafrechtsharmonisierung auf die nationale Strafrechtsordnung
- Die Auswirkungen auf das materielle Strafrecht
- Die Auswirkungen auf das Strafprozessrecht
- Die Auswirkungen auf die Rechtsprechung
- Die Zukunft der Strafrechtsharmonisierung in der Europäischen Union
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Harmonisierung des Strafrechts und Strafprozessrechts in der Europäischen Union. Sie analysiert die Kompetenzgrundlagen der EU im Strafrecht, die Ziele der Europäischen Strafrechtspolitik und die Methoden der Harmonisierung. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Strafrechtsharmonisierung auf die nationale Strafrechtsordnung sowie die Zukunft der Strafrechtsharmonisierung in der Europäischen Union beleuchtet.
- Kompetenzgrundlagen der EU im Strafrecht
- Ziele der Europäischen Strafrechtspolitik
- Methoden der Strafrechtsharmonisierung
- Auswirkungen der Strafrechtsharmonisierung auf die nationale Strafrechtsordnung
- Zukunft der Strafrechtsharmonisierung in der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Strafrechtsharmonisierung in der Europäischen Union ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Europäischen Union und ihrer Strafrechtspolitik. Es analysiert die Kompetenzgrundlagen der EU im Strafrecht, die Ziele der Europäischen Strafrechtspolitik und die Methoden der Europäischen Strafrechtspolitik. Das dritte Kapitel widmet sich der Harmonisierung des Strafrechts. Es erläutert das Konzept der Strafrechtsharmonisierung und untersucht die Harmonisierung des materiellen Strafrechts sowie die Harmonisierung des Strafprozessrechts. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der Strafrechtsharmonisierung auf die nationale Strafrechtsordnung. Es analysiert die Auswirkungen auf das materielle Strafrecht, das Strafprozessrecht und die Rechtsprechung. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Zukunft der Strafrechtsharmonisierung in der Europäischen Union.
Schlüsselwörter
Strafrechtsharmonisierung, Europäische Union, Strafrecht, Strafprozessrecht, Kompetenzgrundlagen, Ziele, Methoden, Auswirkungen, Zukunft
- Quote paper
- Adrian Hemler (Author), 2014, Kriminalitätsbekämpfung in der Europäischen Union. Harmonisierung des Strafrechts und Strafprozessrechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/300054