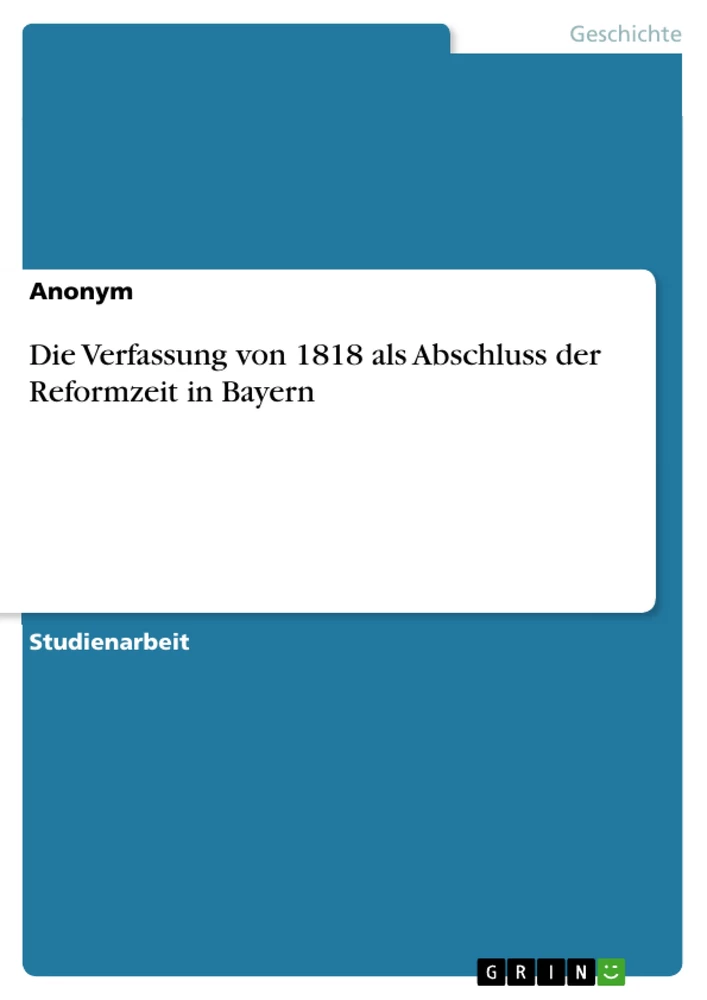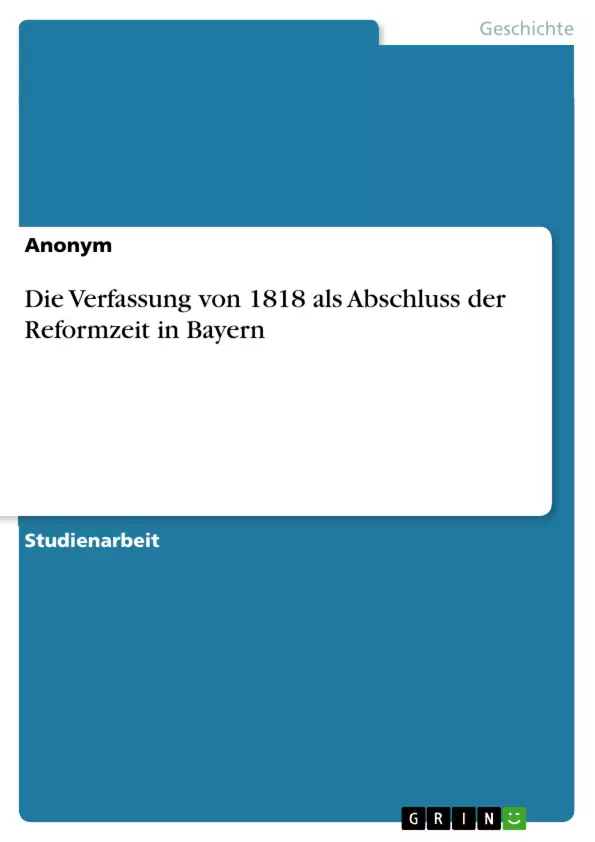Am 15. August 1769 erblickte ein Junge in Ajaccio auf Korsika das Licht der Welt, der ein halbes Jahrhundert später die alte Ordnung Europas grundlegend verändert haben sollte. Die Rede ist von Napoléon Bonaparte.
Der Bedeutung dieses Mannes hat Thomas Nipperdey mit seinem berühmt gewordenen Zitat „Am Anfang war Napoleon" beigepflichtet. Der Historiker begann 1983 mit diesem Satz sein berühmtes Werk „Deutsche Geschichte 1800-1866“ und räumte somit dem Einfluss Napoleons für die Umwälzungen des langen 19. Jahrhunderts einen hohen Stellenwert ein.
Ihren Anfang nahmen die tiefgreifenden Veränderungen des politisch-sozialen Systems mit dem Ereignis der Französischen Revolution, die „tiefe Spuren in der geistigen und politischen Entwicklung“ in vielen Ländern Europas hinterließ. Aber „für die Deutschen“, erklärt Nipperdey „ist der Umsturz der alten Ordnung reale Erfahrung erst unter Napoleon und in der Form des Militär-Imperiums geworden.“
Seit 1792 weitete Frankreich unter seinem Konsul durch die Revolutionskriege seinen Einfluss auf Europa aus. Durch die Mediatisierung und die Säkularisierung im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses im Jahre 1803 konnten viele der deutschen Fürsten ihre Gebiete vergrößern. Mit dem Ziel weiterer territorialer Gewinne wechselten „viele Fürsten 1805 endgültig in das Lager Napoleons“. So wurde unter anderem auch Bayern zum Königreich.
Inhaltsverzeichnis
- Die Bedeutung der rheinbündischen Reformen
- Analyse der bayerischen Verfassung von 1818 als Abschluss der Reformzeit
- Die Rolle der Ständeversammlung
- Aufbau der Kammern
- Kompetenzverteilung zwischen Monarch und Volksvertretung
- Ungleichheit der politischen Mitwirkung
- Durchsetzung der inneren Souveränität des Staates
- Verwaltungs- und Beamtenreform
- Die Stellung des Adels und der Fortbestand ständischer Privilegien
- Der Souveränitätsanspruch des Staates gegenüber der Kirche
- Aufbau einer egalitären Staatsbürgergesellschaft
- Die Stellung des Individuums im Staat
- Der Gleichheitsgrundsatz
- Die verfassungsmäßig garantierten Grund- und Freiheitsrechte
- Die Sicherung der Person und des Eigentums
- Die Presse- und Gewissensfreiheit
- Die Rolle der Ständeversammlung
- Die Verfassung von 1818 - eine Momentaufnahme auf dem Weg in die Moderne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die bayerische Verfassung von 1818 im Kontext der rheinbündischen Reformen und untersucht, wie sie die bestehende Ordnung umgestaltete und den Weg in die Moderne ebnete. Dabei werden die Rolle der Ständeversammlung, die Durchsetzung der inneren Souveränität des Staates und der Aufbau einer egalitären Staatsbürgergesellschaft in den Fokus genommen.
- Die Rolle der Ständeversammlung und die Gestaltung der Machtverhältnisse zwischen Monarch und Volksvertretung
- Die Durchsetzung der inneren Souveränität des Staates und die Abschaffung ständischer Privilegien
- Die Einführung von Grund- und Freiheitsrechten und der Aufbau einer egalitären Staatsbürgergesellschaft
- Die Bedeutung der rheinbündischen Reformen für die Entwicklung Bayerns und die deutsche Geschichte
- Die Verfassung von 1818 als Meilenstein auf dem Weg zur modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Bedeutung der rheinbündischen Reformen
Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss der französischen Revolution und Napoleons auf die Umwälzungen in Europa, insbesondere in Deutschland. Es untersucht die Rheinbundreformen und ihre Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Staaten, wobei die negativen Bewertungen in der frühen deutschen Nationalgeschichtsschreibung und die spätere Umbewertung der Rheinbundreformen als wichtige Schritte zur Modernisierung beleuchtet werden.
Analyse der bayerischen Verfassung von 1818 als Abschluss der Reformzeit
Dieser Abschnitt analysiert die bayerische Verfassung von 1818 im Detail. Er behandelt die Rolle der Ständeversammlung, die Kompetenzen von Monarch und Volksvertretung und die Ungleichheiten der politischen Mitwirkung. Weiterhin wird die Durchsetzung der inneren Souveränität des Staates durch die Verwaltungs- und Beamtenreform, die Abschaffung ständischer Privilegien und die Stärkung des Staates gegenüber der Kirche beleuchtet. Schließlich werden die wichtigsten Elemente des Aufbaus einer egalitären Staatsbürgergesellschaft, wie die Stellung des Individuums im Staat, der Gleichheitsgrundsatz und die garantierten Grund- und Freiheitsrechte, untersucht.
Schlüsselwörter
Bayerische Verfassung von 1818, Rheinbundreformen, Ständeversammlung, innere Souveränität, Staatsbürgergesellschaft, Grund- und Freiheitsrechte, Gleichheitsgrundsatz, aufgeklärter Absolutismus, Napoleon, französische Revolution, deutsche Geschichte, Modernisierung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Die Verfassung von 1818 als Abschluss der Reformzeit in Bayern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/299978