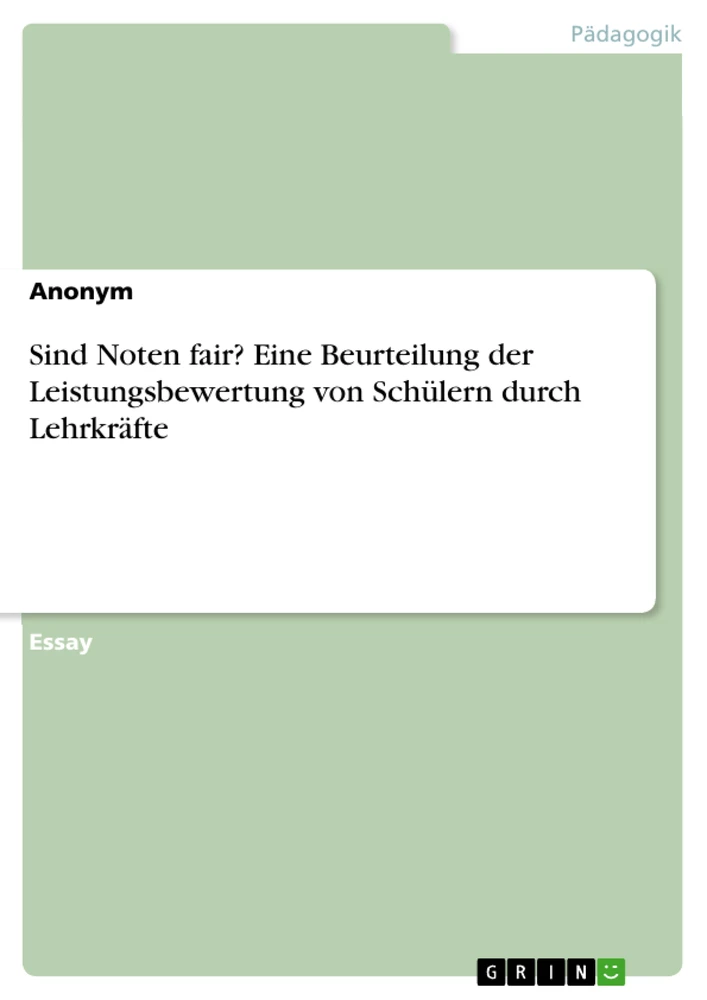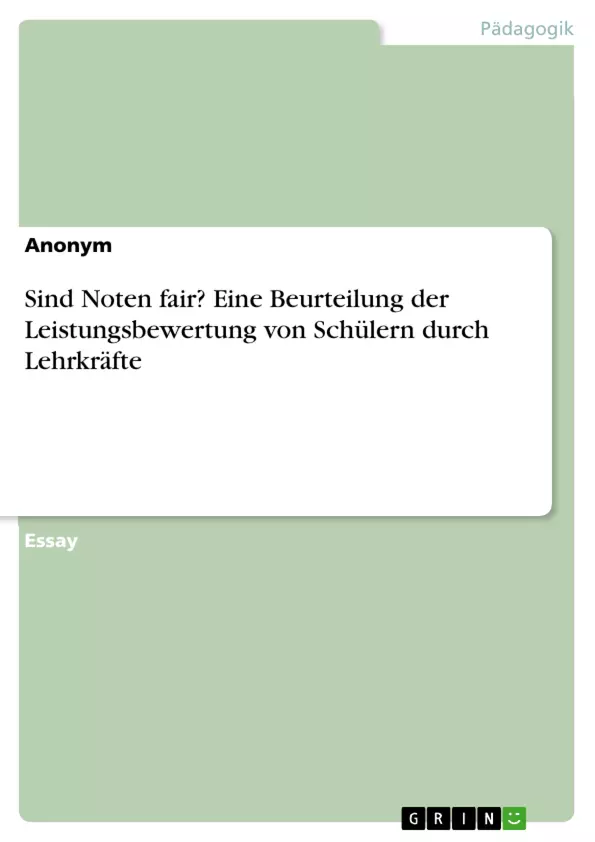Die heute bekannte Form der Notengebung entstand zu Beginn des 19. Jahrhundert. Als Vorläufer der Zensuren gilt das Benefizienzeugnis, das Schülern von mittellosen Eltern ausgestellt wurde, die sich eines Stipendiums als würdig erwiesen haben. Im Vordergrund standen hier weniger Lernerfolge, sondern vielmehr Fleiß, Wohlverhalten und Gottesfürchtigkeit. Allmählich setzte sich dann das Zeugnis in seiner heutigen Form durch. Jeder Schüler bekam nun individuelle Rückmeldung über die schulischen Leistungen auf einem amtlichen Dokument attestiert. Der Grund hierfür lag in der Erkenntnis Preußens, dass der Adel alleine nicht mehr in der Lage sei, die Leistungspositionen eines modernen Staates angemessen zu besetzen. Genau hier setzte sich das Leistungsprinzip durch. Anstelle von Geburt, Religion, Geschlecht, etc. bestimmt nun individuelle Leistung die Position in der Gesellschaft (vgl. Wengert 2004, S. 295). Und genau diese Leistung spiegelt sich in den Noten wider. Um 1850 etablierten sich zunächst drei Bewertungsstufen, die dann allmählich erweitert wurden. Die heute bekannte Notenskala von eins bis sechs wurde erst 1938 eingeführt (vgl. Kuss 2003). Im Zuge der Demokratisierung hat die individuelle Leistung heute noch viel größere Bedeutung als früher. „Nie zuvor hat sich eine Gesellschaft so bewußt darum bemüht, die Fähigkeiten und Eigenschaften ihrer Mitglieder zu bewerten und zu beurteilen“ (Tewes 1976, S. 89). Die Schule als Institution basiert auf einem leistungsorientierten System. Die Noten werden zur Entscheidung über die Chancenzuweisung für den Schüler herangezogen. Dies beschreibt bereits eine erste Funktion der Notengebung.
Mit der hier vorliegenden Arbeit möchte ich die Leistungsbewertung von Schülern durch die Lehrkräfte beurteilen. Hierzu sollen zunächst einige Funktionen der Notengebung erläutert und dann kritisch betrachtet werden. Anschließend werden Bezugssysteme und deren Einfluss auf Noten vorgestellt. Weiterhin sollen die Gütekriterien einer jeder Leistungsbewertung erläutert und dann Störfaktoren in der Benotung bezüglich der Objektivität aufgezeigt werden. Zum Schluss soll im Fazit eine endgültige Einschätzung hinsichtlich der Fairness von Noten gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Funktion von Noten
- Probleme der Funktionen von Notengebung
- Selektionsprinzip
- Sozialisierungsfunktion
- Kontroll- oder Rückmeldefunktion
- Motivationsfunktion
- Bezugs-systeme und ihr Einfluss auf Notengebung
- Sozialnorm oder klasseninternes Bezugssystem
- Individuelle Bezugsnorm
- Sachliche Bezugsnorm
- Gütekriterien
- Objektivität
- Reliabilität
- Validität
- Subjektive Fehlerquellen
- Halo-Effekt
- Hof-Effekt
- Primacy- und Recency-Effekt
- Logikfehler
- Kontrastfehler
- Milde- und Strenge-Effekt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der kritischen Beurteilung der Leistungsbewertung von Schülern durch Lehrkräfte. Sie analysiert die Funktionen von Notengebung, beleuchtet die Probleme, die mit diesen Funktionen verbunden sind, untersucht die verschiedenen Bezugssysteme, die bei der Notengebung eine Rolle spielen, und diskutiert die Gütekriterien und die subjektiven Fehlerquellen, die bei der Benotung auftreten können. Ziel der Arbeit ist es, eine umfassende Einschätzung hinsichtlich der Fairness und der Objektivität von Noten zu geben.
- Funktionen von Noten
- Probleme der Funktionen von Notengebung
- Einfluss von Bezugssystemen auf die Notengebung
- Gütekriterien und Fehlerquellen bei der Benotung
- Fairness und Objektivität von Noten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt einen historischen Überblick über die Entstehung der Notengebung im 19. Jahrhundert. Sie erläutert die Bedeutung des Leistungsprinzips für die heutige Gesellschaft und die Rolle der Schule als Institution, die auf einem leistungsorientierten System basiert.
Funktion von Noten
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Funktionen von Noten. Neben der Funktion der Selektion, die in einem dreigliedrigen und hierarchisch strukturierten Bildungssystem eine wichtige Rolle spielt, werden die Sozialisierungsfunktion, die Kontroll- und Rückmeldefunktion sowie die Motivationsfunktion von Noten diskutiert.
Probleme der Funktionen von Notengebung
Hier werden die Funktionen der Notengebung kritisch betrachtet. Das Selektionsprinzip wird in Bezug auf die Frage nach der Fairness und der Chancengleichheit hinterfragt. Die Sozialisierungsfunktion wird als unproblematisch eingestuft, während die Kontroll- und Rückmeldefunktion sowie die Motivationsfunktion aufgrund ihrer begrenzten Aussagekraft und der Möglichkeit zur Leistungsverminderung kritisch diskutiert werden.
Bezugs-systeme und ihr Einfluss auf Notengebung
Das Kapitel erläutert die drei wichtigsten Bezugssysteme, die bei der Notengebung eine Rolle spielen: die Sozialnorm oder das klasseninterne Bezugssystem, die individuelle Bezugsnorm und die sachliche Bezugsnorm. Der Einfluss dieser Bezugssysteme auf die Notengebung wird detailliert dargestellt.
Gütekriterien
Dieses Kapitel widmet sich den Gütekriterien der Leistungsbewertung: Objektivität, Reliabilität und Validität. Die Bedeutung dieser Kriterien für die Fairness und die Aussagekraft von Noten wird verdeutlicht.
Subjektive Fehlerquellen
Das Kapitel behandelt verschiedene subjektive Fehlerquellen, die bei der Benotung auftreten können, wie z.B. der Halo-Effekt, der Hof-Effekt, der Primacy- und Recency-Effekt, der Logikfehler, der Kontrastfehler und der Milde- und Strenge-Effekt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen der Leistungsbewertung in der Schule, darunter Notengebung, Selektion, Sozialisation, Kontrollfunktion, Motivationsfunktion, Bezugssysteme (Sozialnorm, individuelle Bezugsnorm, sachliche Bezugsnorm), Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität), und subjektive Fehlerquellen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Sind Noten fair? Eine Beurteilung der Leistungsbewertung von Schülern durch Lehrkräfte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/298443