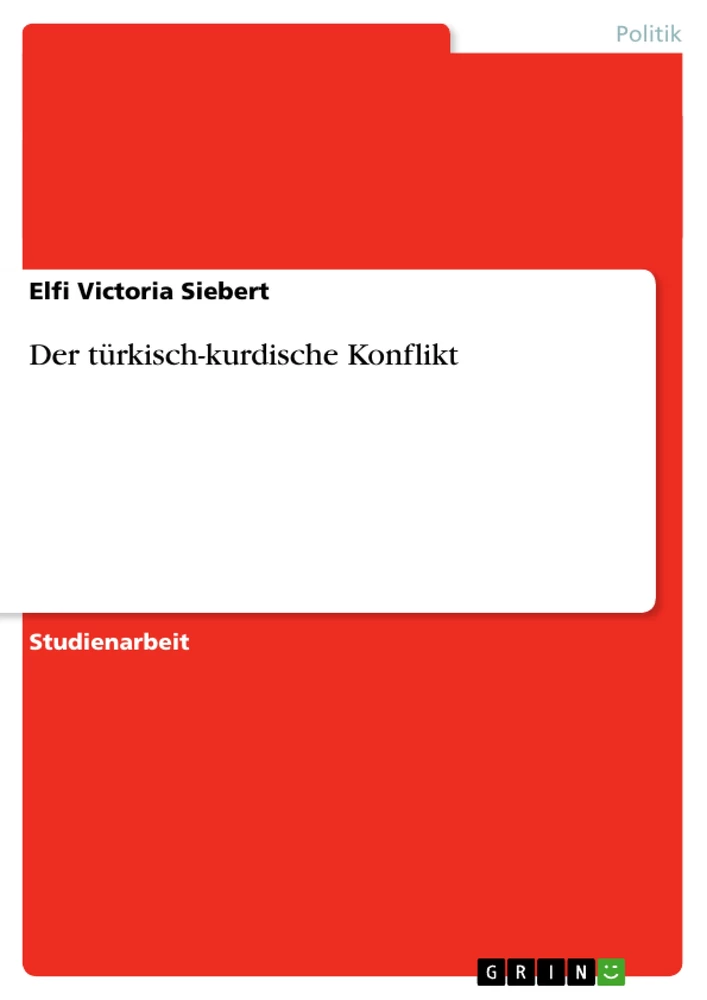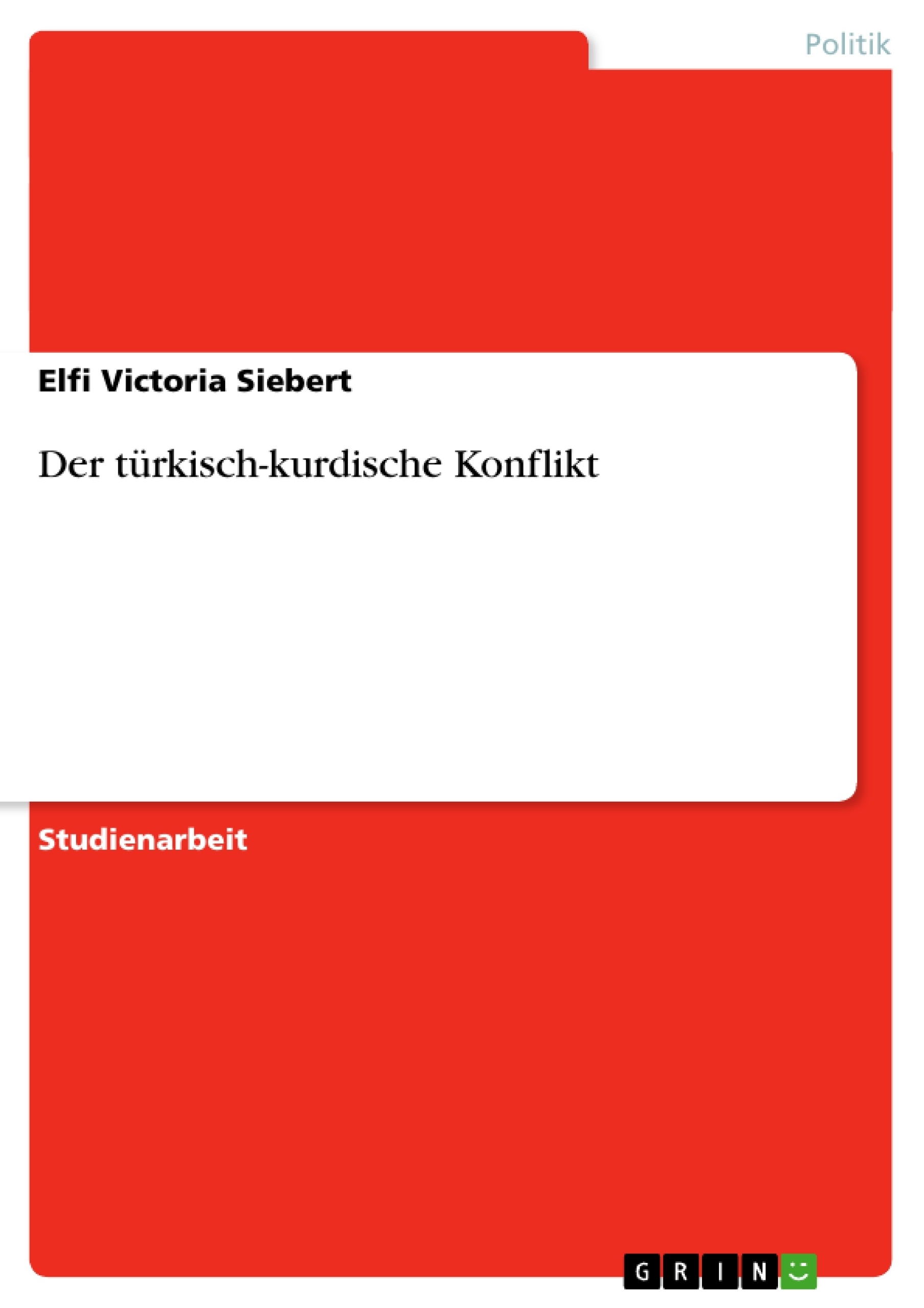Einleitung
Mitte Februar 1999 wurde der kurdische PKK-Führer Abdullah Öcalan am Flughafen von Nairobi vom türkischen Militärgeheimdienst festgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sich in der griechischen Botschaft Kenia versteckt gehalten. Vier Monate zuvor hatte seine Flucht von Syrien aus, wo er sich seit 1979 aufhielt und die Aktionen der PKK organisierte, begonnen und führte ihn über Griechenland, Russland, Italien, Belarus, wieder Griechenland, letztlich nach Kenia. Seiner Verhaftung folgte die Aufgabe des offenen Kampfes der PKK gegen den türkischen Staat. Dem vorausgegangen war ein jahrelanger gewaltsam ausgetragener Konflikt. Jüngste Meldungen aus der Türkei berichten von einer scheinbar gänzlich anderen Sachlage. Ehemaligen Kämpfern der PKK werden von türkischer Seite Amnestie-Angebote gemacht, mit dem Ziel diese in die Gesellschaft wieder einzugliedern. 1 Von einer „türkische(n) Revolution“ ist die Rede; und sogar das traditionell einflussstark in Verfassung und Staatsverständnis verankerte türkische Militär ist auf dem Rückzug aus der Politik und gibt sich reformfreudig.2
Es könnte der Eindruck entstehen in den letzten vier Jahren habe sich vieles in der Türkei geändert. Der türkisch-kurdische Konflikt ist beigelegt und Staatsreformen werden wohlwollend angegangen. Demzufolge stünde einem EU-Beitritt der Türkei nicht mehr viel im Wege. Ganz so einsichtig und überschaubar gestaltet es sich jedoch nicht. Der türkisch-kurdische Konflikt bestand nicht nur aus den Auseinandersetzungen zwischen der PKK und dem türkischen Militär. Dies war lediglich die äußere Erscheinungsform, die durch die Medien immer wieder an die Weltöffentlichkeit drang. Die Ursachen und Hintergründe hingegen haben eine weitaus komplexere und vielschichtigere Gestalt. Und auch der Weg in die Europäische Union ist noch nicht so freigeräumt wie es oberflächlich den Anschein haben mag. Es ist der Gegenstand dieser Arbeit hinter die Kulissen des türkisch-kurdischen Konflikts in Vergangenheit und Gegenwart zu blicken. Dabei kann keinesfalls der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Vielmehr liegt der Fokus darauf, verschiedene essentielle Faktoren zu analysieren, den Konflikt sowohl in die türkische als kurdische Gesellschaft einzufügen, die Rolle der Akteure zu beleuchten, den internationalen Kontext zu skizzieren und schließlich den Bezug und die Bedeutung des Konflikts zu einem EU-Beitritt der Türkei herzustellen.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der türkisch-kurdische Konflikt
- Die Perzeptionen des Konflikts
- Historische Hintergründe
- Friedensabkommen von Sèvres und Lausanne
- Kemalismus und Staatsverständnis der Türkei
- Die Kurdische Identität und Gesellschaftsstruktur
- Die türkische Kurdenpolitik
- Die Rolle des türkischen Militärs
- Die PKK
- Die transnationale Dimension des Kurdenkonflikts
- Der türkisch-kurdische Konflikt und die Europäische Union
- Historischer Abriss der Beziehungen zwischen Europa und der Türkei
- Die Anfänge der türkischen Westorientierung
- Vom Assoziierungsabkommen, über Zollunion zur Beitrittspartnerschaft
- Menschenrechte und Reformen in der Gegenwart
- Die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien
- Die sozioökonomische Lage im Südosten der Türkei
- Historischer Abriss der Beziehungen zwischen Europa und der Türkei
- Fazit und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den türkisch-kurdischen Konflikt in seiner historischen Entwicklung und gegenwärtigen Bedeutung. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf den Konflikt, die komplexen Ursachen und Hintergründe sowie die Rolle der Akteure, insbesondere der türkischen Regierung und der PKK. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit der Konflikt die EU-Beitrittsperspektive der Türkei beeinflusst und welche Reformen notwendig wären, um diesen Konflikt zu lösen und die europäischen Werte zu erfüllen.
- Die unterschiedlichen Perzeptionen des Konflikts aus türkischer und kurdischer Sicht
- Die historischen und gesellschaftlichen Wurzeln des türkisch-kurdischen Konflikts
- Die Rolle der türkischen Regierung und des türkischen Militärs im Konflikt
- Die Position der PKK und ihre Rolle im Konflikt
- Die Bedeutung des Konflikts für die EU-Beitrittsperspektive der Türkei
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und stellt den zeitgeschichtlichen Kontext des türkisch-kurdischen Konflikts dar. Es beleuchtet die Verhaftung von Abdullah Öcalan im Jahr 1999 und die damit verbundenen Veränderungen in der türkischen Politik.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Perspektiven auf den Konflikt, sowohl aus türkischer als auch aus kurdischer Sicht. Es beleuchtet die historischen Hintergründe des Konflikts und analysiert die unterschiedlichen Identitätskonzepte, die den Konflikt prägen.
Das dritte Kapitel untersucht die Beziehung zwischen dem türkisch-kurdischen Konflikt und der EU. Es betrachtet die historischen Beziehungen zwischen der Türkei und Europa sowie die Entwicklung der türkischen EU-Beitrittspolitik. Es analysiert die Bedeutung der Menschenrechtslage und der Reformen in der Türkei im Kontext der EU-Beitrittsverhandlungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem türkisch-kurdischen Konflikt, dem türkischen Staatsverständnis, den Beziehungen zwischen der Türkei und der EU, der kurdischen Identität, der PKK, dem Kemalismuss, der Menschenrechtslage in der Türkei, der EU-Beitrittsperspektive der Türkei und den Reformen in der Türkei.
- Arbeit zitieren
- Elfi Victoria Siebert (Autor:in), 2003, Der türkisch-kurdische Konflikt, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28884