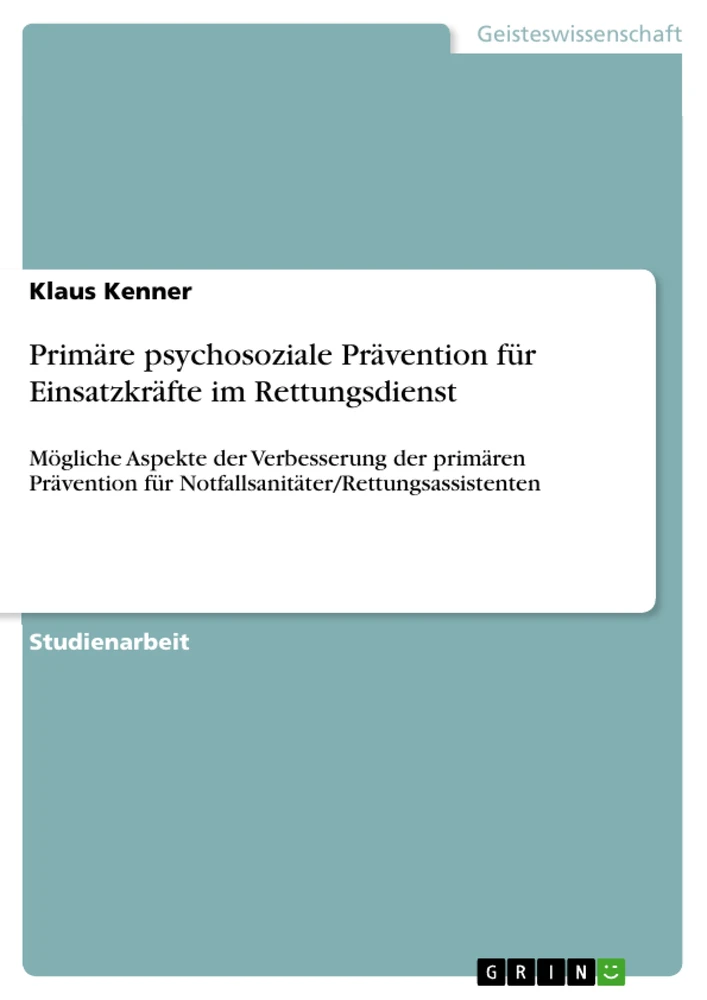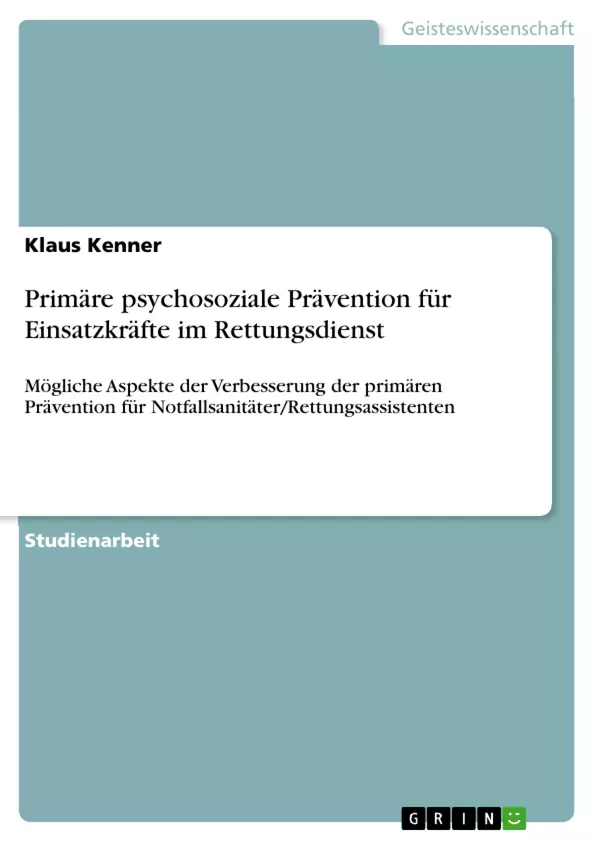Die Notfallsanitäter, als zukünftige Einsatzkräfte im Rettungsdienst sollen laut § 4 des Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) diverse Aufgaben eigenständig durchführen und im Rahmen der Mitwirkung sogar heilkundliche Maßnahmen anwenden dürfen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie sich zukünftig weitaus häufiger ohne Notarzt an der Einsatzstelle befinden und somit mehr Verantwortung tragen. Ihre Arbeit ist jetzt schon durch Zeit- bzw. Leistungsdruck am Einsatzort, die Konfrontation mit schwerwiegenden und tödlichen Verletzungen und Erkrankungen, die ständige Bereitschaft zum Einsatz, Schichtdienst, Misserfolge und ein fehlendes Feedback über Behandlungsverläufe gekennzeichnet. Hinzu kommen Interaktionen im sozialen Gefüge auf einer Rettungswache mit Kollegen und Vorgesetzten, die Konflikte bergen. Dies Alles stellen Belastungsfaktoren nicht nur im physischen, sondern auch im psychischen Sinne dar. (vgl. Bengel, 2004)
Die wichtigste Ressource einer Organisation, die es zu bewahren und zu vergrößern gilt, ist die Ressource Mensch, die durch ständig wiederkehrende Risiken und teilweise extreme Arbeitsbedingungen belastet wird (vgl. Mitchell, Everly, 2005).
Die primäre psychosoziale Prävention stellt dabei eine wichtige Säule zum Erhalt der Gesundheit und der Arbeitskraft dar.
In der folgenden Hausarbeit wird der Frage nachgegangen:
Wie kann der Notfallsanitäter/Rettungsassistent besser auf einen belastenden Einsatz vorbereitet werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2.1 geschichtliche Entwicklung von Belastungsstörungen
- 2.2 geschichtliche Entwicklung der psychosozialen Notfallversorgung
- 3 Stress im Katastrophenschutz
- 4 Qualitätsstandards und Leitlinien der psychosozialen Notfallversorgung in Bezug auf primäre Prävention
- 4.1 Der Entstehungsprozess der Qualitätsstandards und Leitlinien
- 4.2 Ergebnisse in Bezug auf die primäre Prävention
- 5 Optimierungspotential der primären Prävention im Rettungsdienst
- 5.1 Arbeitsorganisation
- 5.2 Soziale Beziehungen
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der primären psychosozialen Prävention für Einsatzkräfte im Rettungsdienst, insbesondere für Notfallsanitäter/Rettungsassistenten. Sie analysiert die Entwicklung der primären Prävention im Kontext der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) und untersucht die Qualitätsstandards und Leitlinien zur Verbesserung der Prävention. Die Arbeit beleuchtet das Optimierungspotential der primären Prävention im Rettungsdienst im Hinblick auf die Arbeitsorganisation und das soziale Gefüge am Arbeitsplatz.
- Entwicklung der primären Prävention im Kontext der PSNV
- Stress im Katastrophenschutz
- Qualitätsstandards und Leitlinien der PSNV in Bezug auf primäre Prävention
- Optimierungspotential der primären Prävention im Rettungsdienst
- Chancen durch das neue Berufsbild Notfallsanitäter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der primären Prävention im Rettungsdienst ein und beleuchtet die Herausforderungen, denen Notfallsanitäter/Rettungsassistenten im Rahmen ihrer Arbeit ausgesetzt sind. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der primären Prävention im Kontext der PSNV und erläutert die Entstehung von Belastungsstörungen. Kapitel 3 behandelt das Thema Stress im Katastrophenschutz. Kapitel 4 analysiert die Qualitätsstandards und Leitlinien der PSNV und deren Relevanz für die primäre Prävention. In Kapitel 5 wird das Optimierungspotential der primären Prävention im Rettungsdienst im Hinblick auf die Arbeitsorganisation und das soziale Gefüge am Arbeitsplatz untersucht.
Schlüsselwörter
Primäre psychosoziale Prävention, Rettungsdienst, Notfallsanitäter, Rettungsassistent, Belastungsstörungen, Stress, Katastrophenschutz, Qualitätsstandards, Leitlinien, PSNV, Arbeitsorganisation, Soziale Beziehungen.
- Quote paper
- Klaus Kenner (Author), 2014, Primäre psychosoziale Prävention für Einsatzkräfte im Rettungsdienst, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/287915