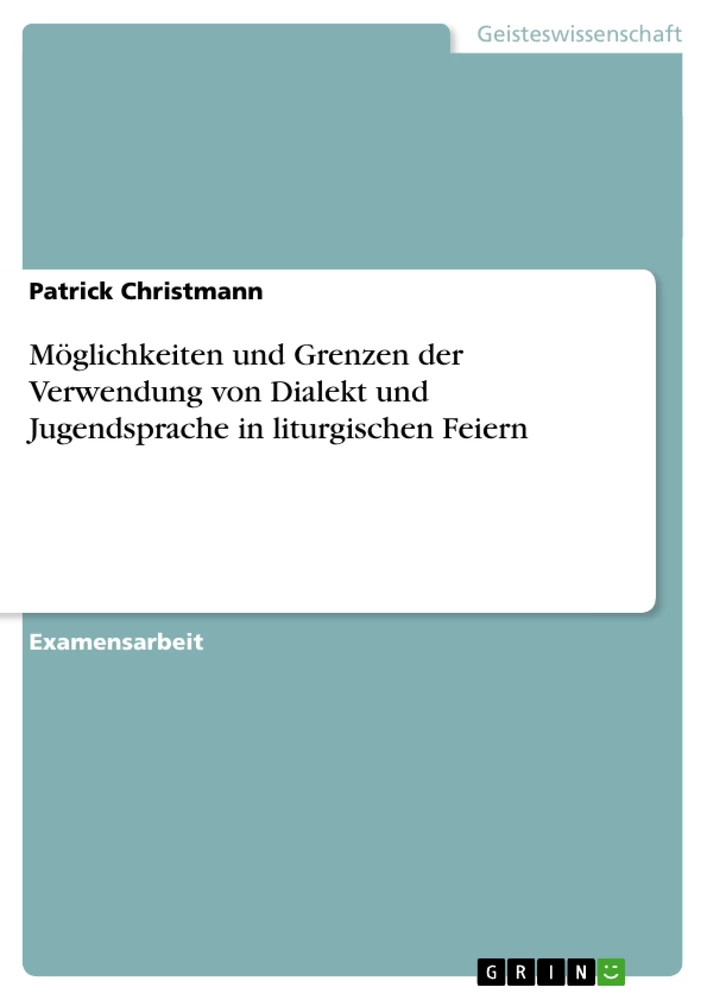Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit es möglich ist, Dialekt und Jugendsprache in liturgischen Feiern zu verwenden. Das bisher wissenschaftlich kaum untersuchte Thema ist gerade heute aktuell:
Gottesdienste, liturgische Feiern und die Kirche im Allgemeinen haben in der heutigen Gesellschaft scheinbar nur einen geringen Stellenwert. Ein Aspekt könnte der sein, den ich in meiner Arbeit untersuche: Vielleicht, weil die Sprache der Kirche, die Sprache der Liturgie und deren Feiern nicht die Sprache der Gläubigen ist. Das Gedicht von Alfons Jestl (siehe S. 1) bringt dies zum Ausdruck. Die Menschen werden von der Kirche und ihrem Glauben nicht mehr angesprochen. Gebete und Texte scheinen zu Formeln erstarrt zu sein, die es Bedarf aufzubrechen. Oder sind gerade diese Gebete und Texte, diese liturgische Sprache ein Zeichen des Zusammenhalts der Kirche und ihres tiefen Glaubens?
Worte müssen verstanden werden, müssen die Sinne ansprechen und den Menschen in seinem Leben und seiner Zukunftsgestaltung bestärken und unterstützen. Der Dialekt und die Jugendsprache vermögen dies im alltäglichen Umgang untereinander und miteinander. Kann und darf die Freude und Lebenskraft die aus dem Dialekt und der Jugendsprache entspringt (und spricht) auch Verwendung in der Liturgie finden?
Die Frage nach der Sprache in der Liturgie scheint, nachdem das Hochdeutsche Eingang in die Liturgie fand, nicht mehr gestellt zu werden. Doch die Probleme der Kirche und des Kirchenbesuchs hängen vielleicht doch damit zusammen, dass die Kirche eine „andere Sprache“ wie die Gläubigen spricht. Nicht nur in ihren Enzykliken und Verlautbarungen, sondern auch in ihrer Sprache, in ihrem Sprechen an sich.
Die vorliegende Arbeit stellt deshalb die Frage, inwieweit die Verwendung von Dialekt und Jugendsprache neue Zugänge und neue Möglichkeiten in und eine neue Identifikation mit der Liturgie bewirken kann, aber auch wo die Verwendung von Dialekt und Jugendsprache in der Liturgie an ihre Grenzen stößt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A Theoretische Betrachtungen
- 1. Definition von Dialekt
- 1.1. Das Wort „Dialekt“ und seine Bedeutung
- 1.2. Definitionen und Definitionsansätze für „Dialekt“
- 1.3. Zusammenfassung und Versuch einer eigenen Definition von Dialekt
- 2. Herkunft und Geschichte der deutschen Dialekte
- 3. Definition von Jugendsprache
- 3.1. Jugendsprache als Sprache im Jugendalter
- 3.2. Definitionen und Definitionsansätze für „Jugendsprache“
- 3.3. Zusammenfassung und Versuch einer eigenen Definition
- 4. Definition des Begriffs: „liturgischen Feiern“
- 4.1. Definitionsansätze zu den Begriffen „Liturgie“ und „liturgischen Feiern“
- 4.2. Der Begriff „Liturgie“ und seine Bedeutung (Katholisches Liturgieverständnis) gemäß dem 2. Vatikanischen Konzil
- 4.3. Evangelisches Liturgieverständnis
- 5. Theologie-geschichtlicher Bezug
- 5.1. „Sprache“ und Bibel
- 5.1.1. Sprache der Heiligen Schrift
- 5.1.1.1. „Sprache“ im AT
- 5.1.1.1.1. Die Sprache in der Zeit des AT
- 5.1.1.1.2. Das Thema „Sprache“ und deren Auseinandersetzung im AT
- 5.1.1.2. „Sprache“ im NT
- 5.1.1.2.1. Die Sprache in der Zeit des NT
- 5.1.1.2.2. Das Thema „Sprache“ und deren Auseinandersetzung im NT
- 5.1.1.1. „Sprache“ im AT
- 5.1.2. Bibelübersetzungen
- 5.1.2.1. Bibelübersetzungen des AT
- 5.1.2.2. Bibelübersetzungen des NT und der gesamten Bibel
- 5.1.1. Sprache der Heiligen Schrift
- 5.2. Sprache in der Missionierung
- 5.3. Sprache in der Katechese
- 5.1. „Sprache“ und Bibel
- 6. Die Sprache der Kirche in der liturgischen Praxis
- 6.1. Vom Urchristentum bis zum Beginn des Mittelalters
- 6.2. Vom Mittelalter bis zum Beginn der Reformation
- 6.3. Entwicklung in der katholischen Kirche seit dem 16. Jahrhundert bis zum II. Vatikanischen Konzil
- 6.4. Entwicklung in den christlichen Kirchen seit dem 16. Jahrhundert
- 6.5. Entwicklung in der evangelischen Kirche seit dem 16. Jahrhundert
- 6.6. Entwicklung in der kath. Kirche seit dem II. Vatikanischen Konzil
- 6.6.1. Teile des Konzilsbeschluss „Sacrasanctum Concilium“
- 6.6.2. Die ersten vier Instruktionen zur Liturgiekonstitution
- 6.6.3. Die aktuelle fünfte Instruktion zur Liturgiekonstitution
- 1. Definition von Dialekt
- B Praktische Betrachtungen
- 1. Der Einzug des Dialektes und der Jugendsprache in die kirchlichte Liturgie
- 2. Gründe für und gegen die Verwendung des Dialekts und der Jugendsprache in liturgischen Feiern
- 3. Möglichkeiten zur Verwendung des Dialektes und der Jugendsprache
- 4. Stellungnahmen der Landeskirchen, Bistümer und Priester
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung von Dialekt und Jugendsprache in liturgischen Feiern. Ziel ist es, die theologischen, geschichtlichen und praktischen Aspekte dieser Frage zu beleuchten und eine fundierte Einschätzung abzugeben.
- Definition und Abgrenzung von Dialekt und Jugendsprache
- Theologiegeschichtliche Entwicklung der Sprache in der Liturgie
- Argumente für und gegen den Einsatz von Dialekt und Jugendsprache
- Praktische Beispiele und Umsetzungsmöglichkeiten
- Stellungnahmen von Kirchen und Theologen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Relevanz der Fragestellung bezüglich der Verwendung von Dialekt und Jugendsprache in liturgischen Feiern. Sie skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der Arbeit und benennt die Forschungsfrage.
A Theoretische Betrachtungen: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden Dialekt und Jugendsprache definiert, ihre historische Entwicklung nachgezeichnet und der Begriff „liturgische Feiern“ geklärt. Der theologisch-geschichtliche Bezug wird durch die Analyse der Sprache in der Bibel und deren Übersetzungen sowie deren Bedeutung in Mission und Katechese hergestellt. Die Entwicklung der Sprache in der liturgischen Praxis von den Anfängen des Christentums bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil wird ausführlich dargestellt, wobei die jeweiligen Epochen und Konfessionen differenziert betrachtet werden.
B Praktische Betrachtungen: Im zweiten Teil der Arbeit werden die praktischen Aspekte behandelt. Es wird der Einzug von Dialekt und Jugendsprache in die kirchliche Liturgie analysiert, differenziert nach katholischen und evangelischen Traditionen. Die Argumente für und gegen eine solche Verwendung werden gegeneinander abgewogen, konkrete Möglichkeiten und Beispiele für die Integration von Dialekt und Jugendsprache in liturgische Feiern vorgestellt (Bibelübersetzungen, Lieder, Gebete, Predigten). Schließlich werden Stellungnahmen von Landeskirchen, Bistümern und Priestern zu diesem Thema zusammengetragen und bewertet.
Schlüsselwörter
Dialekt, Jugendsprache, Liturgie, Liturgische Feiern, Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Bibelübersetzung, Sprachentwicklung, Theologiegeschichte, Mission, Katechese, Inklusion, Exklusion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verwendung von Dialekt und Jugendsprache in liturgischen Feiern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung von Dialekt und Jugendsprache in liturgischen Feiern. Sie beleuchtet die theologischen, geschichtlichen und praktischen Aspekte dieser Frage und gibt eine fundierte Einschätzung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Dialekt und Jugendsprache, die theologiegeschichtliche Entwicklung der Sprache in der Liturgie, Argumente für und gegen den Einsatz von Dialekt und Jugendsprache, praktische Beispiele und Umsetzungsmöglichkeiten sowie Stellungnahmen von Kirchen und Theologen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Der theoretische Teil definiert Dialekt und Jugendsprache, verfolgt deren historische Entwicklung und klärt den Begriff „liturgische Feiern“. Er analysiert den theologisch-geschichtlichen Bezug, die Sprache in der Bibel und deren Übersetzungen sowie deren Bedeutung in Mission und Katechese. Die Entwicklung der Sprache in der liturgischen Praxis wird von den Anfängen des Christentums bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil dargestellt. Der praktische Teil analysiert den Einzug von Dialekt und Jugendsprache in die kirchliche Liturgie, bewertet Argumente für und gegen deren Verwendung, präsentiert konkrete Beispiele und sammelt Stellungnahmen von Kirchen und Priestern.
Welche Definitionen werden verwendet?
Die Arbeit bietet eigene Definitionen von Dialekt und Jugendsprache an, basierend auf einer ausführlichen Auseinandersetzung mit bestehenden Definitionsansätzen. Der Begriff „liturgische Feiern“ wird ebenfalls präzise definiert, unter Berücksichtigung des katholischen und evangelischen Liturgieverständnisses.
Wie wird der theologisch-geschichtliche Kontext behandelt?
Der theologisch-geschichtliche Kontext wird durch die Analyse der Sprache in der Bibel (Altes und Neues Testament), deren Übersetzungen, sowie deren Bedeutung in der Mission und Katechese beleuchtet. Die Entwicklung der Sprache in der liturgischen Praxis wird von den Anfängen des Christentums bis zur Gegenwart nachgezeichnet, differenziert nach katholischen und evangelischen Kirchen.
Welche praktischen Aspekte werden betrachtet?
Praktische Aspekte umfassen die Analyse des Einzugs von Dialekt und Jugendsprache in die Liturgie, die Abwägung von Argumenten für und gegen deren Verwendung, die Vorstellung konkreter Beispiele (z.B. Bibelübersetzungen, Lieder, Gebete, Predigten) und die Zusammenfassung von Stellungnahmen von Landeskirchen, Bistümern und Priestern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dialekt, Jugendsprache, Liturgie, Liturgische Feiern, Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Bibelübersetzung, Sprachentwicklung, Theologiegeschichte, Mission, Katechese, Inklusion, Exklusion.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach den Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung von Dialekt und Jugendsprache in liturgischen Feiern.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die theologischen, geschichtlichen und praktischen Aspekte der Verwendung von Dialekt und Jugendsprache in liturgischen Feiern zu beleuchten und eine fundierte Einschätzung abzugeben.
- Quote paper
- Patrick Christmann (Author), 2003, Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung von Dialekt und Jugendsprache in liturgischen Feiern, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28788