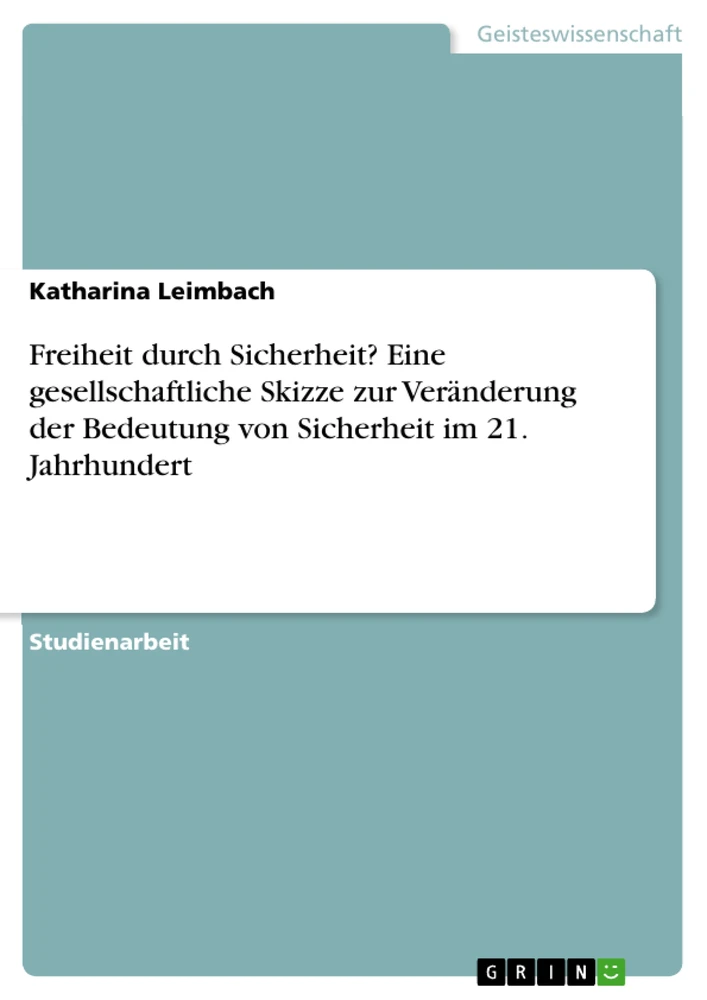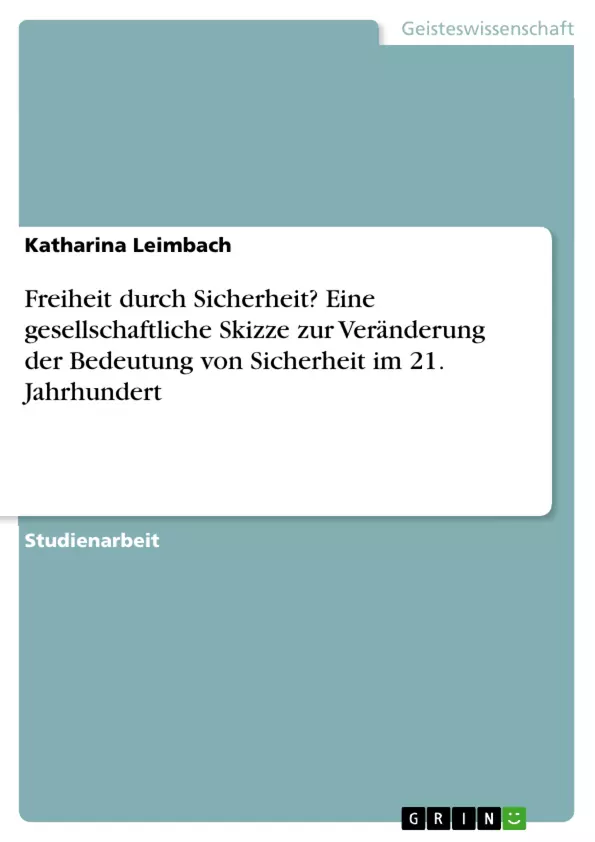Das 21. Jahrhundert ist spezifiziert durch Globalisierung, gesellschaftliche Differenzierung und technische Entwicklung, aber diese Dimensionen stehen im Schatten der einstürzenden Twin Towers am 11. September 2001 in New York, Amerika. Die Ereignisse von 9/11 zeigten eine fürchterliche Potenzierung von Zerstörungskraft, wenn organisierter, religiös oder politisch motivierter Terror sich mit technisch-physikalischer Energie verbindet und führte zu einem Gefühl der Hilflosigkeit seitens der westlichen Regierungen (vgl. Denninger 2002: 1). Diese Hilflosigkeit manifestierte sich in einem Zwang zur Sicherheit. Denn die Anschläge auf das World Trade Center wurden indirekt als Anschläge auf Demokratie und westliche Werte empfunden und sollten von nun an durch spezielle Sicherheitsmaßnahmen bewahrt werden.
Wie diese Maßnahmen aussehen und was sie bewirken, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Was Sicherheit aber überhaupt im Kontext der 2000er Jahre als Begriff definiert, wird einleitend beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Problemumriss: Sicherheit als Begrifflichkeit
- Wandel oder fortlaufende Entwicklung? – Änderung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes
- Das erste und zweite Sicherheitspaket
- Wandel oder Entwicklung rechtlicher Grundlagen?
- Die Dimension Recht als Rechtfertigung? – und die Furcht vor Terror
- Sicherheitsrisiko: der Bürger
- Die Internationale Sicherheitsgesellschaft
- Technisierung der Kontrolle
- INDECT
- Zusammenfassung
- Sicherheitsrisiko: der Bürger
- Fazit Folgen für die Öffentlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderungen des Sicherheitsbegriffs im 21. Jahrhundert, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Sie analysiert, wie die Ereignisse von 9/11 den Umgang mit Sicherheit in Deutschland beeinflusst haben und welche Auswirkungen dies auf die Gesellschaft hat. Die Arbeit beleuchtet sowohl juristische als auch gesellschaftliche Aspekte.
- Der Wandel des Sicherheitsbegriffs nach 9/11
- Die Rolle des Rechts und der Sicherheitspolitik
- Die Auswirkungen auf die Freiheit der Bürger
- Die Technisierung der sozialen Kontrolle
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung von Sicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
Problemumriss: Sicherheit als Begrifflichkeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Sicherheit" im Kontext der Arbeit. Es wird deutlich gemacht, dass Sicherheit ein vielschichtiger Begriff ist, der unterschiedlich interpretiert werden kann. Drei zentrale Bedeutungen werden herausgestellt: der politisch-existenzielle Sicherheitsbegriff, die innere Sicherheit und die Rechtssicherheit. Das Kapitel legt die Grundlage für die weitere Analyse, indem es verschiedene Facetten des Sicherheitsbegriffs beleuchtet und aufzeigt, dass Sicherheit nicht nur Schutz vor physischer Gefahr, sondern auch die Aufrechterhaltung sozialer Ordnung und Rechtssicherheit umfasst. Der Text betont die Komplexität des Begriffs und die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition. Die Arbeit wird im Kontext des Spannungsverhältnisses zwischen Sicherheit und Freiheit innerhalb einer demokratischen Gesellschaft positioniert.
Wandel oder fortlaufende Entwicklung? – Änderung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Veränderungen im Bereich der Sicherheitspolitik nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Es untersucht, ob es sich um einen grundlegenden Wandel oder lediglich um eine Fortführung bestehender Entwicklungen handelt. Die Analyse konzentriert sich auf die Reaktion der deutschen Bundesregierung und die eingeleiteten Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit die neuen Gesetze und Maßnahmen die Sicherheit tatsächlich erhöhen und welche Konsequenzen diese für die Bürgerrechte und die gesellschaftliche Freiheit haben. Die Diskussion um die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit wird hier explizit angesprochen.
Die Dimension Recht als Rechtfertigung? – und die Furcht vor Terror: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Sicherheitsmaßnahmen auf die Bürger und ihre Freiheiten. Es untersucht, inwieweit die Furcht vor Terror als Rechtfertigung für Eingriffe in die Grundrechte dienen kann. Die Rolle von Überwachungsmaßnahmen und technologischen Entwicklungen im Bereich der Sicherheitskontrolle wird analysiert. Der Text dürfte dabei auch die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen dieser Entwicklungen diskutieren, sowie möglicherweise Beispiele von Überwachungsprogrammen nennen. Das Kapitel hinterfragt kritisch die Verhältnismäßigkeit der Sicherheitsmaßnahmen und ihre potenziellen Folgen für den Rechtsstaat.
Schlüsselwörter
Sicherheit, Terrorismus, Rechtsstaat, Freiheit, soziale Kontrolle, Überwachung, Terrorismusbekämpfung, 9/11, Gesetzgebung, Demokratie, Bürgerrechte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Wandel des Sicherheitsbegriffs nach 9/11
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Sicherheitsbegriffs im 21. Jahrhundert, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Ereignisse auf den Umgang mit Sicherheit in Deutschland und deren gesellschaftliche Folgen, sowohl juristisch als auch gesellschaftlich.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Wandel des Sicherheitsbegriffs nach 9/11, die Rolle von Recht und Sicherheitspolitik, die Auswirkungen auf die Bürgerrechte, die Technisierung der sozialen Kontrolle und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Sicherheit. Sie analysiert auch die Änderungen des Terrorismusbekämpfungsgesetzes (erste und zweite Sicherheitspakete) und die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus mehreren Kapiteln: Das erste Kapitel definiert den Begriff "Sicherheit" in seinen verschiedenen Facetten (politisch-existenziell, innere Sicherheit, Rechtssicherheit). Das zweite Kapitel analysiert die Änderungen des Terrorismusbekämpfungsgesetzes nach 9/11 und fragt nach grundlegendem Wandel oder Weiterentwicklung bestehender Tendenzen. Das dritte Kapitel untersucht die Auswirkungen von Sicherheitsmaßnahmen auf die Bürger und ihre Freiheiten, die Rolle der Furcht vor Terror als Rechtfertigung für Eingriffe in Grundrechte und die ethischen Implikationen der Technisierung der Kontrolle (z.B. INDECT).
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht im Fazit Schlussfolgerungen für die Öffentlichkeit bezüglich der Auswirkungen des Wandels des Sicherheitsbegriffs und der damit einhergehenden Maßnahmen. Genaueres zum Fazit wird in der vollständigen Arbeit dargelegt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sicherheit, Terrorismus, Rechtsstaat, Freiheit, soziale Kontrolle, Überwachung, Terrorismusbekämpfung, 9/11, Gesetzgebung, Demokratie, Bürgerrechte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Wandel des Sicherheitsbegriffs nach 9/11 zu untersuchen und dessen Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft zu analysieren. Sie beleuchtet dabei sowohl die rechtlichen als auch die gesellschaftlichen Aspekte.
- Arbeit zitieren
- Katharina Leimbach (Autor:in), 2014, Freiheit durch Sicherheit? Eine gesellschaftliche Skizze zur Veränderung der Bedeutung von Sicherheit im 21. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/285229