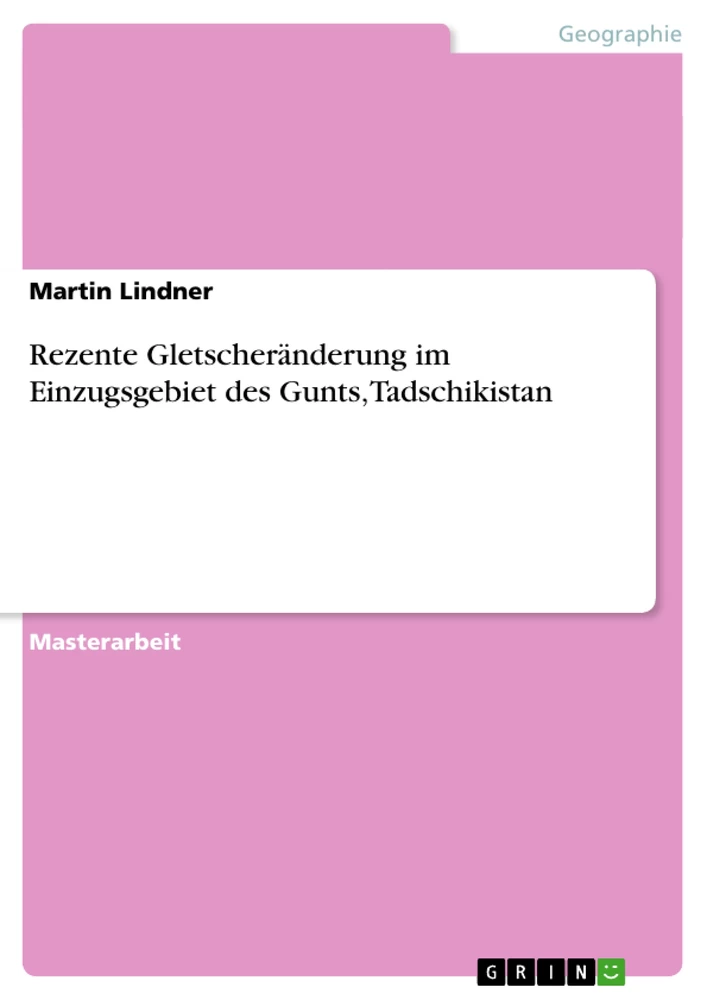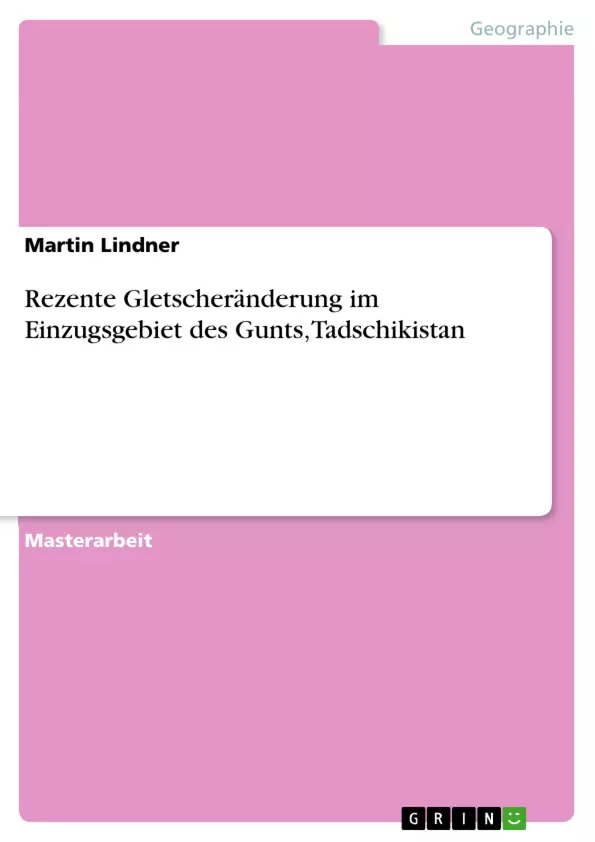Das viel diskutierte Aralsee-Einzugsgebiet, welches hauptsächlich durch die Hochgebirge Zentralasiens gespeist wird, ist durch Wasserknappheit geprägt. Infolge der Klimaerwärmung kann von einem Rückgang der dortigen Gletscher ausgegangen werden. Für das Verständnis und zur Modellierung dieses hydrologischen Systems sind daher verlässliche Daten über die rezente und aktuelle Vergletscherung essenziell. Aufgrund von fehlenden Daten zur Massenbilanz wurde eine satellitenbasierte Untersuchung der flächenhaften und volumetrischen Gletscheränderung für das Einzugsgebiet des Gunts (Tadschikistan) durchgeführt. Zur Erfassung der Flächenänderung wurden multitemporale Satellitenbilder der letzten Jahrzehnte (Corona KH-4B, Landsat MSS/TM, Terra ASTER und RapidEye) klassifiziert. Um Aussagen über die Volumenänderung zu treffen, wurde die Höhendifferenz aus einem Geländemodell basierend auf Corona-Stereodaten und SRTM-Daten gebildet. Um flächendeckende Informationen über das Gletschervolumen zu erhalten, wurde die Verteilung der Gletscherdicke modelliert. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Rückgang der Gletscherfläche von 189,6 km2 (b=23,7 %) zwischen 1977 und 2011. Die spezifische Massenbilanz von −0,399ma-1 Wasseräquivalent im Zeitraum 1977–1998 ging auf −0,662ma-1 (1998–2011) zurück. Der jährliche Massenverlust von 0,36 Gigatonnen trägt zu rund 12,2% des mittleren jährlichen Abflusses des Gunts bei.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Pamir, Gorno Badakhshan und der Gunt
- 1.1.1 Geographische, klimatologische und hydrologische Situation
- 1.1.2 Politische, wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Entwicklung
- 1.1.3 Wassernutzungskonflikt in Zentralasien
- 1.2 Das Projekt PAMIRWater
- 1.3 Ziel der Arbeit
- 1.3.1 Forschungsfragen
- 1.3.2 Forschungsstand
- 2 Daten und Grundlagen
- 2.1 Übersicht der verwendeten Daten
- 2.2 Topographische Karten
- 2.3 Gletscherinventar
- 2.3.1 Katalog Lednikov
- 2.3.2 WGI
- 2.3.3 GLIMS
- 2.3.4 RGI
- 2.4 Optische Daten
- 2.4.1 Spionage-Satelliten
- 2.4.2 Landsat
- 2.4.3 ASTER
- 2.4.4 RapidEye
- 2.4.5 SPOT
- 2.4.6 Zusammenfassung - optische Satellitendaten
- 2.5 Radar-Daten
- 2.5.1 SRTM
- 2.5.2 Weitere geeignete Radar-Satellitendaten
- 2.6 Laserscan-Daten (ICESat)
- 2.7 Global Navigation Satellite System
- 2.7.1 Grundlegendes zur Satellitennavigation
- 2.7.2 Positionsbestimmung
- 2.7.3 Fehlereinflüsse
- 2.7.4 Möglichkeiten zur Verminderung der Messfehler
- 2.7.5 GPS-Messung im Gelände
- 2.8 Meteorologische und hydrologische Daten
- 3 Methoden der Fernerkundung zur Untersuchung von Gletscheränderungen
- 3.1 Grundlegendes zur Gletscherfernerkundung
- 3.2 Evaluierung verschiedener Datengrundlagen
- 3.2.1 Genauigkeit der Generalstabskarte in Hinblick auf Gletschergrenzen und Isohypsen
- 3.2.2 Genauigkeit der bestehenden Gletscherinventare
- 3.2.3 Vergleich der vertikalen Genauigkeit verschiedener Geländemodelle
- 3.2.4 Postprocessing der GPS-Punkte
- 3.2.5 Analyse über die Verwendbarkeit von Google Earth zur Erfassung von Passpunkten
- 3.3 Erfassung der planimetrischen Gletscheränderung
- 3.3.1 Auswahl der Daten
- 3.3.2 Preprocessing
- 3.3.3 Klassifizierungsmethoden zur Erfassung der Gletscherfläche
- 3.3.4 Postprocessing der Klassifizierung
- 3.3.5 Abschätzung der Unsicherheiten der Ergebnisse
- 3.4 Erfassung der volumetrischen Gletscheränderung
- 3.4.1 Auswahl der Daten
- 3.4.2 Preprocessing
- 3.4.3 Erstellung von Geländemodellen (mittels Stereophotogrammetrie)
- 3.4.4 Differenz zweier Geländemodelle
- 3.4.5 Eisdicken-Modellierung
- 3.5 Auswertung der hydrometrischen und meteorologischen Daten
- 3.5.1 Abfluss
- 3.5.2 Niederschlag und Temperatur
- 3.5.3 Seefläche und -spiegel
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Evaluierung verschiedener Datengrundlagen
- 4.1.1 Genauigkeit der Generalstabskarte in Hinblick auf Gletschergrenzen und Isohypsen
- 4.1.2 Genauigkeit der bestehenden Gletscherinventare
- 4.1.3 Vergleich der vertikalen Genauigkeit verschiedener Geländemodelle
- 4.1.4 Postprocessing der GPS-Punkte
- 4.1.5 Geometrische Referenz - Vergleich von Google Earth und RapidEye
- 4.2 Planimetrische Gletscheränderung
- 4.2.1 Flächenänderung im EZG Gunt
- 4.2.2 Flächenänderung im TEZG Pathkurdara
- 4.2.3 Betrachtung relevanter Gletscherparameter
- 4.3 Volumetrische Gletscheränderung
- 4.3.1 Methodische Ergebnisse
- 4.3.2 Änderung des Gletschervolumens
- 4.3.3 Volumenänderung basierend auf Glab Top
- 4.4 Zusammenhang zwischen Umweltparametern und Gletscherrückgang
- 4.4.1 Niederschlag und Temperatur
- 4.4.2 Abfluss
- 4.4.3 Seefläche
- 5 Diskussion
- 5.1 Geeignete Daten und Methoden zur Erfassung der Gletscheränderung
- 5.1.1 Evaluierung der Datengrundlage
- 5.1.2 Daten und Methoden zur Erfassung der Gletscherfläche
- 5.1.3 Daten und Methoden zur Erfassung des Gletschervolumens
- 5.2 Veränderung von Gletscherfläche und -volumen
- 5.2.1 Veränderung der Gletscherfläche
- 5.2.2 Veränderung des Gletschervolumens
- 5.3 Korrelation mit hydrometrischen und meteorologischen Daten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht rezente Gletscheränderungen im Einzugsgebiet des Gunts in Tadschikistan. Ziel ist die quantitative Erfassung der planimetrischen und volumetrischen Gletscherveränderungen und die Analyse des Zusammenhangs mit klimatischen und hydrologischen Parametern.
- Quantitative Bestimmung der Gletscherflächenveränderung
- Bestimmung der Gletschervolumenänderung
- Analyse der Genauigkeit verschiedener Datensätze (z.B. Satellitenbilder, Karten)
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Gletscherschmelze und klimatischen Faktoren (Niederschlag, Temperatur)
- Bewertung verschiedener Methoden zur Gletscherüberwachung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel führt in das Untersuchungsgebiet, den Pamir und das Einzugsgebiet des Gunts in Tadschikistan, ein. Es beschreibt die geographische, klimatologische und hydrologische Situation, die politische, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung sowie den Wassernutzungskonflikt in Zentralasien. Weiterhin wird das PAMIRWater Projekt vorgestellt und das Ziel der Arbeit, die Erforschung der Gletscherveränderungen im Einzugsgebiet des Gunts, definiert. Die Forschungsfragen und der aktuelle Forschungsstand werden ebenfalls dargelegt.
2 Daten und Grundlagen: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die verwendeten Datenquellen, darunter topographische Karten, verschiedene Gletscherinventare (Katalog Lednikov, WGI, GLIMS, RGI), optische Satellitendaten (Spionage-Satelliten, Landsat, ASTER, RapidEye, SPOT), Radardaten (SRTM), Laserscan-Daten (ICESat), GPS-Daten und meteorologische sowie hydrologische Daten. Die Eigenschaften und die jeweilige Eignung der verschiedenen Datensätze werden umfassend erläutert.
3 Methoden der Fernerkundung zur Untersuchung von Gletscheränderungen: In diesem Kapitel werden die Methoden zur Erfassung der planimetrischen und volumetrischen Gletscheränderungen detailliert beschrieben. Es beinhaltet die Evaluierung der Genauigkeit der verwendeten Datengrundlagen, die Auswahl und Vorverarbeitung der Daten, die Klassifizierungsmethoden zur Bestimmung der Gletscherfläche, die Erstellung von Geländemodellen mittels Stereophotogrammetrie und die Berechnung der Volumenänderung. Die Abschätzung der Unsicherheiten der Ergebnisse wird ebenfalls behandelt.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Analysen. Es beinhaltet die Ergebnisse der Genauigkeitsprüfung der Datengrundlagen, die quantifizierten Veränderungen der Gletscherfläche und des Gletschervolumens, sowie die Analyse des Zusammenhangs zwischen Umweltparametern (Niederschlag, Temperatur, Abfluss, Seefläche) und dem Gletscherrückgang. Die Ergebnisse werden detailliert erläutert und grafisch dargestellt.
5 Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse im Kontext der angewandten Methoden und Datengrundlagen. Es bewertet die Eignung der verwendeten Daten und Methoden zur Erfassung der Gletscheränderungen und interpretiert die Ergebnisse hinsichtlich der beobachteten Veränderungen von Gletscherfläche und -volumen sowie deren Korrelation mit hydrometrischen und meteorologischen Daten. Die Diskussion geht auf mögliche Fehlerquellen und Unsicherheiten ein.
Schlüsselwörter
Gletscher, Gletscheränderung, Pamir, Tadschikistan, Gunt, Fernerkundung, Satellitendaten, GPS, Planimetrie, Volumetrische Gletschermessung, Hydrometeorologie, Klimawandel, Wassernutzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Rezente Gletscheränderungen im Einzugsgebiet des Gunts in Tadschikistan"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht rezente Gletscheränderungen im Einzugsgebiet des Gunts in Tadschikistan. Ziel ist die quantitative Erfassung der planimetrischen und volumetrischen Gletscherveränderungen und die Analyse des Zusammenhangs mit klimatischen und hydrologischen Parametern.
Welche geografische Region wird untersucht?
Die Studie konzentriert sich auf das Einzugsgebiet des Gunts im Pamir-Gebirge in Tadschikistan. Die geographische, klimatologische und hydrologische Situation dieser Region wird detailliert beschrieben.
Welche Daten wurden verwendet?
Die Analyse basiert auf einer Vielzahl von Datenquellen, darunter topographische Karten, verschiedene Gletscherinventare (Katalog Lednikov, WGI, GLIMS, RGI), optische Satellitendaten (Spionage-Satelliten, Landsat, ASTER, RapidEye, SPOT), Radardaten (SRTM), Laserscan-Daten (ICESat), GPS-Daten und meteorologische sowie hydrologische Daten. Die Eigenschaften und die Eignung der einzelnen Datensätze werden im Detail erläutert.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet Methoden der Fernerkundung zur Erfassung der planimetrischen und volumetrischen Gletscheränderungen. Dies beinhaltet die Evaluierung der Genauigkeit der verwendeten Datengrundlagen, die Auswahl und Vorverarbeitung der Daten, die Klassifizierungsmethoden zur Bestimmung der Gletscherfläche, die Erstellung von Geländemodellen mittels Stereophotogrammetrie und die Berechnung der Volumenänderung. Die Abschätzung der Unsicherheiten der Ergebnisse wird ebenfalls behandelt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse umfassen die quantifizierten Veränderungen der Gletscherfläche und des Gletschervolumens im Untersuchungsgebiet. Es wird der Zusammenhang zwischen Umweltparametern (Niederschlag, Temperatur, Abfluss, Seefläche) und dem Gletscherrückgang analysiert. Die Ergebnisse werden detailliert erläutert und grafisch dargestellt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Diskussion bewertet die Eignung der verwendeten Daten und Methoden zur Erfassung der Gletscheränderungen und interpretiert die Ergebnisse hinsichtlich der beobachteten Veränderungen von Gletscherfläche und -volumen sowie deren Korrelation mit hydrometrischen und meteorologischen Daten. Die Diskussion geht auf mögliche Fehlerquellen und Unsicherheiten ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Gletscher, Gletscheränderung, Pamir, Tadschikistan, Gunt, Fernerkundung, Satellitendaten, GPS, Planimetrie, Volumetrische Gletschermessung, Hydrometeorologie, Klimawandel, Wassernutzung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einführung, Daten und Grundlagen, Methoden der Fernerkundung zur Untersuchung von Gletscheränderungen, Ergebnisse und Diskussion. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung detailliert beschrieben.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die quantitative Bestimmung der Gletscherflächen- und Volumenveränderung und die Analyse des Zusammenhangs mit klimatischen und hydrologischen Faktoren. Die Genauigkeit verschiedener Datensätze wird ebenfalls analysiert.
Welche Bedeutung hat die Arbeit?
Die Arbeit liefert wichtige Erkenntnisse über den Einfluss des Klimawandels auf Gletscher im Hochgebirge und trägt zum Verständnis der Auswirkungen auf die Wasserressourcen in der Region bei. Sie bewertet verschiedene Methoden zur Gletscherüberwachung.
- Arbeit zitieren
- Martin Lindner (Autor:in), 2013, Rezente Gletscheränderung im Einzugsgebiet des Gunts, Tadschikistan, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/283627