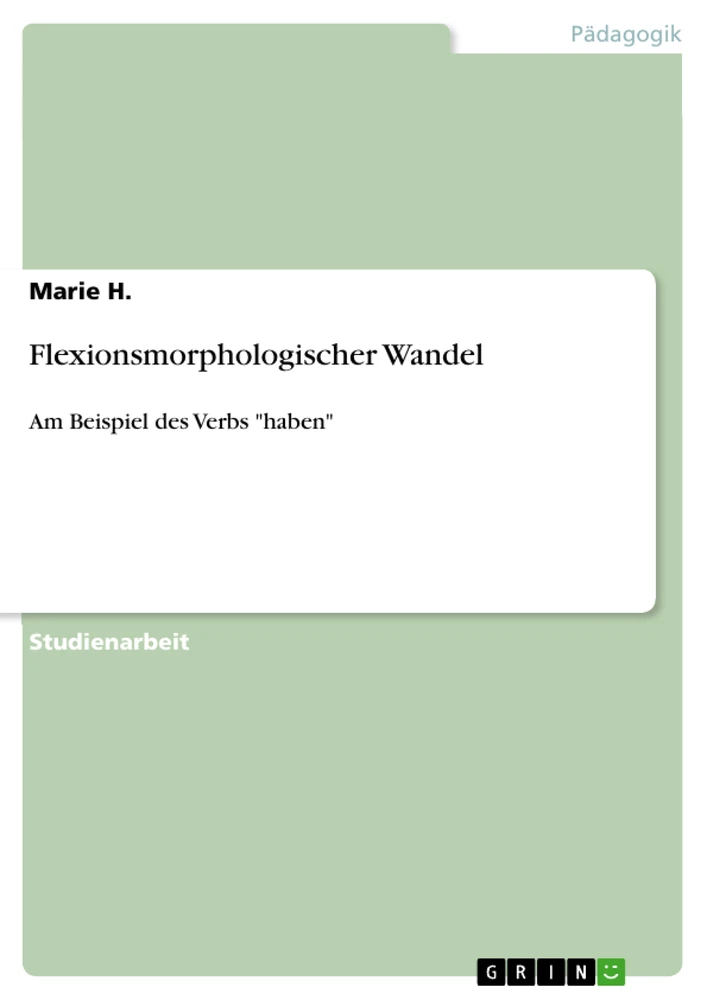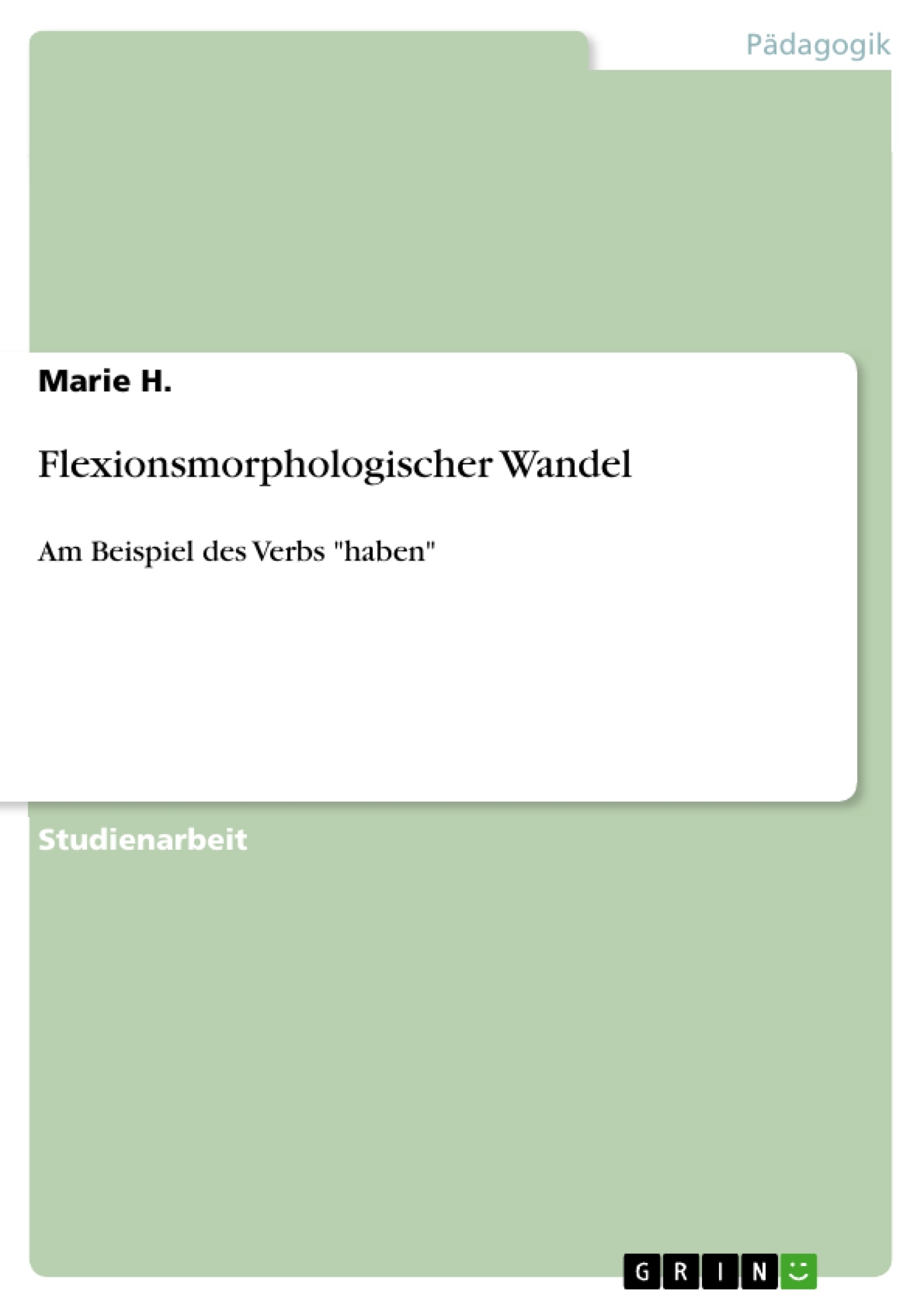Die deutsche Sprache erfuhr im Laufe der letzten Jahrhunderte Veränderungen, die sie zu dem machte, was sie heute ist: ein komplexes System, das aus mehreren ineinander verflochtenen Subsystemen besteht, zu denen auch die Morphologie gehört. Die Morphologie ist „die Lehre von den formalen Wortausprägungen und von den Wortbildungsprozessen […]; […] sie [kann] als die Lehre vom Bau der Wörter [bezeichnet werden]“ (Linke 1996: 47). Interessant für die vorliegende Arbeit ist hierbei die Lehre der formalen Wortausprägungen, auch bekannt als Flexionsmorphologie. Inwiefern diese im Laufe der Geschichte die deutsche Sprache einem Wandel unterzogen hat, soll sie anhand von Beispielen im sprachhistorischen Kontext präsentieren. Dabei wird sich auf den Wandel der Lehre der formalen Wortausprägungen (Flexionen) vom Mittelhochdeutschen über das Frühneuhochdeutsche bis hin zum Neuhochdeutschen konzentriert, sowie das Althochdeutsche kurz erwähnt.
Zur Analyse des Wandels werden zunächst folgende Punkte umrissen: Analogien, Kategorien und ihre Hierarchien, das Verhältnis von Form und Funktion der Flexionsmorphologie und der Einfluss der Gebrauchsfrequenz. Im Laufe der Arbeit wird deutlich werden, wie eng diese Strukturen miteinander verbunden für einen morphologischen Wandel in der Sprache verantwortlich sind. Schließlich wird der flexionsmorphologische Wandel des Verbs haben kurz angerissen.
Die Arbeit soll den Vorweg zu einem Ausblick auf die Zukunft im Hinblick auf die Gründe der Entwicklung der deutschen Sprache von der Vergangenheit zum Heute bilden, welcher im Fazit wieder aufgegriffen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wie untersucht man Flexionswandel?
- 2.1. Analogien
- 2.2. Flexionskategorien und ihre Hierarchiesierung
- 3. Verhältnis von Form und Funktion
- 3.1. Verstöße gegen Uniformität und Transparenz
- 3.2. Fusionsgrad zwischen lexikalischer Basis und grammatischer Information
- 3.3. Morphologisch basierte Sprachtypologie
- 4. Die Tokenfrequenz
- 5. Das Verb haben: die Entstehung einer flexivischen Unregelmäßigkeit
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Flexionswandel im Deutschen, insbesondere am Beispiel des Verbs „haben“. Ziel ist es, die Faktoren zu beleuchten, die diesen Wandel beeinflussen. Dabei wird der Fokus auf die sprachhistorische Entwicklung gelegt, von althochdeutsch bis neuhochdeutsch.
- Analogien als Triebkraft des Flexionswandels
- Die Rolle von Flexionskategorien und ihrer Hierarchie
- Das Verhältnis von Form und Funktion in der Flexionsmorphologie
- Der Einfluss der Tokenfrequenz auf morphologische Veränderungen
- Die Entwicklung der Flexion des Verbs „haben“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Flexionswandels im Deutschen ein und beschreibt die Morphologie als ein wichtiges Subsystem der deutschen Sprache. Sie skizziert den Forschungsansatz, der sich auf die Entwicklung der Flexion vom Mittelhochdeutschen bis zum Neuhochdeutschen konzentriert, und benennt die zentralen Aspekte der Analyse: Analogien, Flexionskategorien, das Verhältnis von Form und Funktion sowie die Tokenfrequenz. Die Arbeit soll einen Ausblick auf die Entwicklung der deutschen Sprache geben und im Fazit wieder aufgegriffen werden.
2. Wie untersucht man Flexionswandel?: Dieses Kapitel erläutert die Methoden zur Untersuchung von Flexionswandel. Es wird der Begriff der Analogie definiert und deren Bedeutung für den Flexionswandel herausgestellt. Schwache Verben werden als produktive Muster für Analogien identifiziert. Weiterhin wird die Rolle der Flexionskategorien (Tempus, Modus, Numerus) und ihrer Hierarchisierung im Kontext des Wandels diskutiert. Der Abbau der Dualform im Laufe der germanischen Sprachgeschichte dient als Beispiel für die Relevanzhierarchie der Kategorien. Die Untersuchung von Analogien allein reicht jedoch nicht aus, um den Flexionswandel vollständig zu erklären.
Schlüsselwörter
Flexionsmorphologie, Flexionswandel, Deutsch, Analogie, Flexionskategorien, Tempus, Modus, Numerus, Verb haben, Sprachgeschichte, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Tokenfrequenz, Form-Funktion-Relation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Flexionswandel im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Flexionswandel im Deutschen, insbesondere am Beispiel des Verbs „haben“. Der Fokus liegt auf der sprachhistorischen Entwicklung von althochdeutsch bis neuhochdeutsch. Analysiert werden die Faktoren, die diesen Wandel beeinflussen, unter anderem Analogien, die Rolle von Flexionskategorien und ihrer Hierarchie, das Verhältnis von Form und Funktion in der Flexionsmorphologie und der Einfluss der Tokenfrequenz.
Welche Methoden werden zur Untersuchung des Flexionswandels eingesetzt?
Die Arbeit erläutert Methoden zur Untersuchung von Flexionswandel. Ein zentraler Begriff ist die Analogie, deren Bedeutung für den Flexionswandel hervorgehoben wird. Schwache Verben werden als produktive Muster für Analogien identifiziert. Die Rolle der Flexionskategorien (Tempus, Modus, Numerus) und ihrer Hierarchisierung im Kontext des Wandels wird ebenfalls diskutiert. Der Abbau der Dualform in der germanischen Sprachgeschichte dient als Beispiel für die Relevanzhierarchie der Kategorien.
Welche Rolle spielen Analogien beim Flexionswandel?
Analogien werden als eine wichtige Triebkraft des Flexionswandels identifiziert. Schwache Verben dienen als produktive Muster für Analogien. Die Arbeit verdeutlicht jedoch, dass die Untersuchung von Analogien allein nicht ausreicht, um den Flexionswandel vollständig zu erklären.
Welche Bedeutung haben Flexionskategorien und ihre Hierarchie?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Flexionskategorien (Tempus, Modus, Numerus) und ihrer Hierarchisierung im Kontext des Flexionswandels. Der Abbau der Dualform im Laufe der germanischen Sprachgeschichte wird als Beispiel für die Relevanzhierarchie dieser Kategorien angeführt.
Wie wird das Verhältnis von Form und Funktion betrachtet?
Die Arbeit analysiert das Verhältnis von Form und Funktion in der Flexionsmorphologie im Kontext des Flexionswandels. Es werden Aspekte wie Verstöße gegen Uniformität und Transparenz sowie der Fusionsgrad zwischen lexikalischer Basis und grammatischer Information untersucht. Die morphologisch basierte Sprachtypologie wird ebenfalls in Bezug gesetzt.
Welche Rolle spielt die Tokenfrequenz?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Tokenfrequenz auf morphologische Veränderungen im Zusammenhang mit dem Flexionswandel.
Wie wird die Entwicklung des Verbs „haben“ dargestellt?
Die Arbeit untersucht detailliert die Entwicklung der Flexion des Verbs „haben“ als ein konkretes Beispiel für den Flexionswandel im Deutschen, von althochdeutsch bis neuhochdeutsch.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Wie untersucht man Flexionswandel?, Verhältnis von Form und Funktion, Die Tokenfrequenz, Das Verb haben: die Entstehung einer flexivischen Unregelmäßigkeit, und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Flexionswandels im Deutschen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Flexionsmorphologie, Flexionswandel, Deutsch, Analogie, Flexionskategorien, Tempus, Modus, Numerus, Verb haben, Sprachgeschichte, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Tokenfrequenz, Form-Funktion-Relation.
- Quote paper
- Marie H. (Author), 2014, Flexionsmorphologischer Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/282929