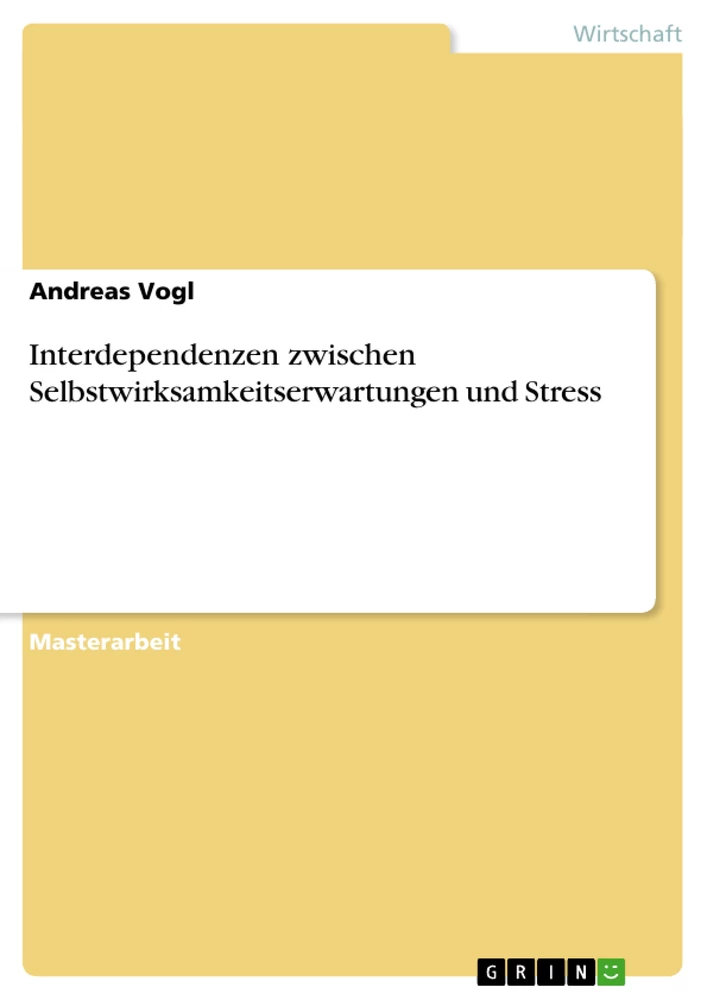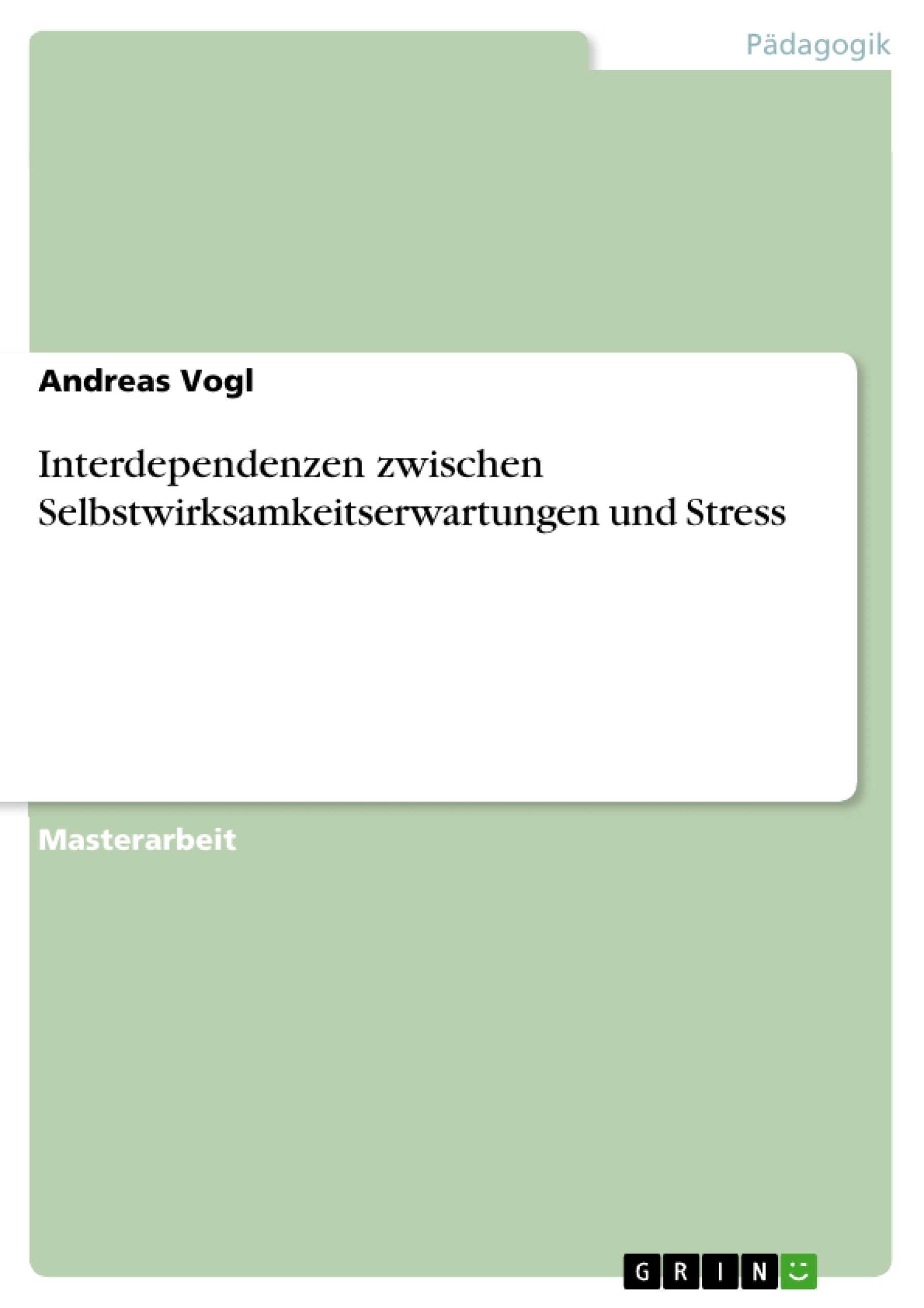Nahezu jede zweite Frühverrentung in Deutschland im Jahr 2012 ist auf psychische Erkrankungen zurückzuführen (BUNDESPSYCHOTHERAPEUTENKAMMER 2013, 4). Dieses Ergebnis ist erschreckend und alarmierend zugleich. Der Schaden dürfte für die Volkswirtschaft, die sozialen Systeme und vor allem für die Betroffenen selbst, enorm sein.
In einer repräsentativen Befragung von Erwerbstätigen in Deutschland gaben 46 Prozent der ca. 35.000 Befragten an, dass Stress und Arbeitsdruck in den letzten beiden Jahren in ihrem Arbeitsumfeld zugenommen haben. Ferner gaben 20 Prozent der Befragten an, dass sie praktisch immer oder häufig bis an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit gehen müssen. Jeder Zweite fühlt sich an seinem Arbeitsplatz folglich immer oder häufig starkem Termin und Leistungsdruck ausgesetzt (JANSEN 2000, 5ff.).
Zu den anstrengendsten Berufen mit erhöhter psychosozialer Beanspruchung zählen im Allgemeinen diejenigen, in denen zwischenmenschliche Beziehungen eine große Rolle spielen. Vor allem Lehrkräfte sind solchen hohen psychischen Belastungen ausgesetzt. Neben der Dienstunfähigkeit und dem vorgezogenen Ruhestand als Folge einer psychischen Erkrankung, gilt es zu beachten, „dass ohne Lehrergesundheit eine hohe Qualität des Lehrens und Lernens auf Dauer nicht möglich ist“ (SCHAARSCHMIDT 2009, 605).
SCHAARSCHMIDT (2009, 607ff.) konnte in einer bundesweit angelegten Studie mit 7.413 Lehrkräften zeigen, dass in der Berufsgruppe der Lehrer eine besonders problematische Beanspruchungssituation vorliegt und deshalb die Lehrerarbeit mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Zeitdruck oder Verwaltungsaufgaben sind Beispiele für Stressoren, mit denen Lehrpersonen konfrontiert sind (GOLYSZNY, KÄRNER & SEMBILL 2012, 222). Auch in den Unterrichtspausen ist häufig keine Erholung möglich, oftmals ist die Stresseinwirkung in diesen Phasen durch Trubel und Lärm sogar am höchsten (SCHAARSCHMIDT 2009, 605).
Die Gesunderhaltung des eigenen Körpers sowie der Seele sollte folglich als Basis für die Leistungsfähigkeit des Menschen und deshalb als oberstes Ziel angesehen werden um sowohl private, als auch berufliche Anforderungen, erfolgreich meistern zu können (BUNDESPSYCHOTHERAPEUTENKAMMER 2013, 33). [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Das Konzept der Selbstwirksamkeit
- 2.1.1 Definitionen und Abgrenzung
- 2.1.2 Allgemeine und spezifische Selbstwirksamkeit
- 2.1.3 Individuelle und kollektive Selbstwirksamkeit
- 2.1.4 Entstehung und Beeinflussung von Selbstwirksamkeit
- 2.1.5 Rahmenbedingungen von Selbstwirksamkeitserwartungen
- 2.2 Stress
- 2.2.1 Definitionen und Abgrenzung
- 2.2.2 Das transaktionale Stressmodell
- 2.2.3 Die Stressmessung
- 2.3 Interdependenzen zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und Stress
- 2.3.1 Selbstwirksamkeit als Ressource gegen Stress
- 2.3.2 Die gegenseitige Beeinflussung von Selbstwirksamkeit und Stress
- 2.3.3 Empirische Befunde
- 3 Forschungsfrage und Thesen
- 3.1 Forschungsfrage
- 3.2 Thesen
- 4 Untersuchungsmethode
- 4.1 Theoretischer Hintergrund
- 4.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING
- 4.1.2 Frequenzanalyse
- 4.2 Datenerhebung
- 4.2.1 Operationalisierung
- 4.2.2 Auswahl der Abstracts und Stichprobe
- 5 Auswertungsergebnisse
- 5.1 Ergebnisse aus dem „allgemeinen“ Bereich
- 5.1.1 Ergebnisse der Rubrik „Publikationsinformationen“
- 5.1.2 Ergebnisse der Rubrik „Forschungseinrichtung“
- 5.1.3 Ergebnisse der Rubrik „Stichprobe“
- 5.1.4 Ergebnisse der Rubrik „Methodischer Ansatz“
- 5.1.5 Ergebnisse der Rubrik „Formen der Selbstwirksamkeit“
- 5.2 Ergebnisse aus dem „thesenrelevanten“ Bereich
- 5.2.1 Ergebnisse der Rubrik „Art der Stressmessung“
- 5.2.2 Ergebnisse der Rubrik „Interdependenzen zwischen Selbstwirksamkeit und Stress“
- 5.2.3 Ergebnisse der Rubrik „Effekte von Interventionsmaßnahmen auf Selbstwirksamkeit und Stress“
- 5.2.4 Zusammenfassung der „thesenrelevanten“ Ergebnisse
- 6 Diskussion
- 6.1 Interpretation der „thesenrelevanten“ Ergebnisse
- 6.1.1 Ergebnisinterpretation der Rubrik „Art der Stressmessung“
- 6.1.2 Ergebnisinterpretation der Rubrik „Interdependenzen zwischen Selbstwirksamkeit und Stress“
- 6.1.3 Ergebnisinterpretation der Rubrik „Effekte von Interventionsmaßnahmen auf Selbstwirksamkeit und Stress“
- 6.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisinterpretation und Beantwortung der Forschungsfrage
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Interdependenzen zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und Stress. Ziel ist es, die Rolle der Selbstwirksamkeit als Ressource im Umgang mit Stress zu belegen und die gegenseitige Beeinflussung beider Konzepte zu analysieren. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Literaturanalyse.
- Selbstwirksamkeit als personale Ressource
- Stress als psychosoziale Belastung
- Gegenseitige Beeinflussung von Selbstwirksamkeit und Stress
- Empirische Befunde zum Zusammenhang von Selbstwirksamkeit und Stress
- Methodische Herangehensweise an die Literaturanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der hohen Rate an Frühverrentungen aufgrund psychischer Erkrankungen in Deutschland und dem zunehmenden Stresserleben von Erwerbstätigen, insbesondere von Lehrkräften. Es wird die Bedeutung der Lehrergesundheit für die Qualität von Bildung hervorgehoben und der Zusammenhang zwischen Stress und unzureichenden Ressourcen zur Stressbewältigung erläutert. Die Arbeit fokussiert auf die Rolle der Selbstwirksamkeitserwartungen als potenzielle Ressource zur Stressbewältigung.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert und differenziert das Konzept der Selbstwirksamkeit, beleuchtet verschiedene Formen (allgemein, spezifisch, individuell, kollektiv), deren Entstehung und Beeinflussung sowie relevante Rahmenbedingungen. Anschließend werden verschiedene Stressdefinitionen und das transaktionale Stressmodell vorgestellt, inkl. gängiger Stressmessmethoden. Schließlich werden bestehende empirische Befunde zum Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Stress diskutiert, die einen negativen Zusammenhang nahelegen.
3 Forschungsfrage und Thesen: In diesem Kapitel wird die zentrale Forschungsfrage der Arbeit formuliert, die sich mit der Wirksamkeit von Selbstwirksamkeitserwartungen als Ressource gegen Stress befasst. Es werden darauf aufbauend Hypothesen aufgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit empirisch überprüft werden.
4 Untersuchungsmethode: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es erläutert die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und die Frequenzanalyse als gewählte Analyseverfahren. Der Abschnitt detailliert die Datenerhebung, die Operationalisierung der relevanten Variablen sowie die Auswahl der Abstracts für die Stichprobe.
5 Auswertungsergebnisse: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Literaturanalyse. Es gliedert sich in Ergebnisse aus dem allgemeinen Bereich (Publikationsinformationen, Forschungseinrichtungen, Stichprobe, methodischer Ansatz, Formen der Selbstwirksamkeit) und Ergebnisse aus dem thesenrelevanten Bereich (Art der Stressmessung, Interdependenzen zwischen Selbstwirksamkeit und Stress, Effekte von Interventionsmaßnahmen). Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und für die Beantwortung der Forschungsfrage vorbereitet.
Schlüsselwörter
Selbstwirksamkeitserwartungen, Stress, Stressbewältigung, Ressourcen, empirische Literaturanalyse, qualitative Inhaltsanalyse, psychische Gesundheit, Lehrergesundheit, Arbeitsbelastung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Interdependenzen zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und Stress
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und Stress, insbesondere die Rolle der Selbstwirksamkeit als Ressource im Umgang mit Stress. Der Fokus liegt auf der Analyse der gegenseitigen Beeinflussung beider Konzepte. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Literaturanalyse.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit der Wirksamkeit von Selbstwirksamkeitserwartungen als Ressource gegen Stress. Konkrete Hypothesen werden aufgestellt und im Verlauf der Arbeit empirisch überprüft.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und eine Frequenzanalyse zur Auswertung der Daten. Die Datenerhebung erfolgt durch die Auswahl und Analyse relevanter Abstracts. Die Operationalisierung der Variablen wird detailliert beschrieben.
Welche theoretischen Konzepte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konzepte der Selbstwirksamkeit (inkl. verschiedener Formen wie allgemein, spezifisch, individuell und kollektiv, Entstehung und Beeinflussung) und Stress (inkl. Definitionen, transaktionalem Stressmodell und Stressmessmethoden). Der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Stress wird anhand bestehender empirischer Befunde diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Problemstellung, Theoretischer Hintergrund, Forschungsfrage und Thesen, Untersuchungsmethode, Auswertungsergebnisse, Diskussion, Fazit und Ausblick. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im Dokument.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Auswertungsergebnisse werden in zwei Bereiche gegliedert: Ergebnisse aus dem allgemeinen Bereich (z.B. Publikationsinformationen, Forschungseinrichtungen, Stichprobe, methodischer Ansatz) und Ergebnisse aus dem thesenrelevanten Bereich (z.B. Art der Stressmessung, Interdependenzen zwischen Selbstwirksamkeit und Stress, Effekte von Interventionsmaßnahmen). Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und zur Beantwortung der Forschungsfrage verwendet.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert?
Die Interpretation der Ergebnisse konzentriert sich auf den thesenrelevanten Bereich. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Forschungsfrage analysiert und diskutiert. Eine Zusammenfassung der Ergebnisinterpretation und die Beantwortung der Forschungsfrage bilden den Abschluss der Diskussion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstwirksamkeitserwartungen, Stress, Stressbewältigung, Ressourcen, empirische Literaturanalyse, qualitative Inhaltsanalyse, psychische Gesundheit, Lehrergesundheit, Arbeitsbelastung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Rolle der Selbstwirksamkeit als Ressource im Umgang mit Stress zu belegen und die gegenseitige Beeinflussung von Selbstwirksamkeit und Stress zu analysieren. Die Bedeutung der Lehrergesundheit im Kontext von Stress und Frühverrentung wird ebenfalls thematisiert.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich der Psychologie und Arbeitswissenschaft.
- Quote paper
- Master of Science (M.Sc.) Andreas Vogl (Author), 2014, Interdependenzen zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und Stress, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/282399