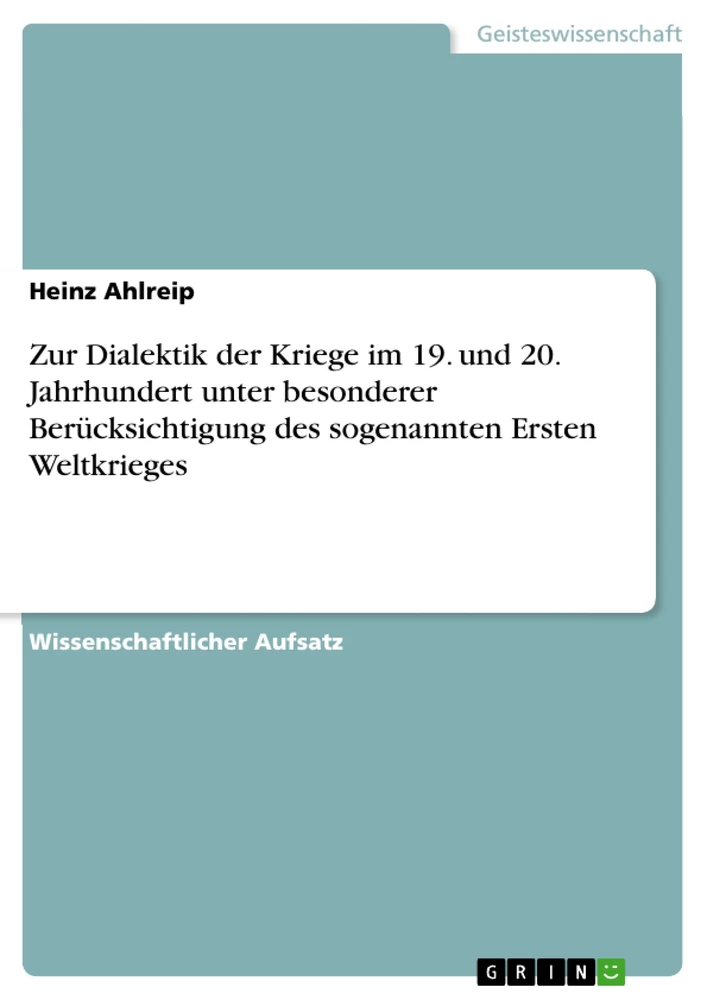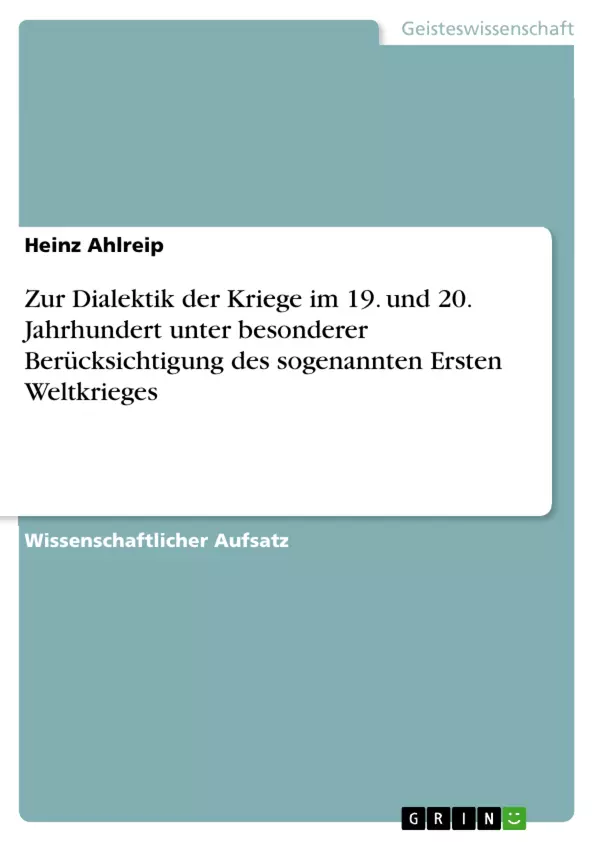Aus dem sogenannten Ersten Weltkrieg ergaben sich zwei Demokratiekonzepte, die insbesondere in Mitteleuropa, aber auch weltweit nicht nur rivalisierten, sondern die Weltpolitik nachhaltig prägten. Zwischen dem Leninschen, an der Pariser Kommune entwickelte Konzept einer Rätedemokratie, die für die marxistischen Revolutionäre nur eine Zwischenstufe zu ihrem "Einschlafen" (Friedrich Engels) im Kommunismus darstellte und zwischen dem an der bürgerlichen Aufklärung orientierten Konzept einer repräsentativen Demokratie, das der us-amerikanische Präsident Wilson vertrat, schob sich der Faschismus, der im Inneren die Ausrottung des Marxismus und nach außen die militante Vernichtung der Sowjetunion betrieb und beide Großmächte in eine bizarre Kriegskoalition zwang, die sofort nach der Beendigung des sogenannten Zweiten Weltkrieges aufbrach. Obwohl die Sowjetunion die harte Prüfung des Krieges unter extrem großen Opfern bestand, fehlte sie bei der Überwindung der Warenproduktion, die sich über die Perestroika die ihr genehme politische Form schuf. Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte eine historische Entwertung des Vietnamkrieges mit sich, dessen Ausgang die militärische und politische Führung der USA traumatisiert hatte. Aus der Tatsache, dass die Fahrradsoldaten des Generals Giap zwei Atommächte in die Knie zwangen, bleibt die Frage aufgeworfen, ob nicht das 20. Jahrhundert trotz der beiden Weltkriege primär oder wenigstens gleichwertig ein Jahrhundert der Guerilla war. In China avancierte der führende Guerillatheoretiker Mao tse tung zu einem roten Gott, dessen Worte in einem kleinen roten Büchlein weltweit verbreitet wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Eine Vorbemerkung zur Erklärung des Titels: Warum war der erste Weltkrieg nicht der erste?
- „Der Krieg führt die Menschen zusammen“
- Die Ohnmacht der Menschen gegenüber dem Krieg
- Der Charakter des Krieges wurzelt in der kapitalistischen Ökonomie
- Die Menschen wissen nicht, was sie tun
- Objektiver Gehalt des Krieges und Klasseninteressen
- „In Europa gehen die Lichter aus“
- Der Krieg als Zweikampf und Massenkonflikt
- Das Perverse und Ironische des Krieges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dialektik der Kriege im 19. und 20. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf den Ersten Weltkrieg. Sie hinterfragt die vermeintliche Einzigartigkeit des Ersten Weltkriegs im Kontext der kapitalistischen Entwicklung und analysiert die komplexen gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Faktoren, die zu seiner Entstehung und Ausweitung beigetragen haben.
- Die kapitalistische Ökonomie als Wurzel des Krieges
- Das Verhältnis von objektiven und subjektiven Faktoren im Kriegsgeschehen
- Die Dialektik von Krieg und Frieden
- Die Rolle von Klasseninteressen im Ausbruch und Verlauf von Kriegen
- Die Perversität und Ironie des Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Eine Vorbemerkung zur Erklärung des Titels: Warum war der erste Weltkrieg nicht der erste?: Der einleitende Abschnitt hinterfragt die Bezeichnung „Erster Weltkrieg“ im Kontext der bereits bestehenden globalen Handelskriege und der „ursprünglichen Akkumulation des Kapitals“, wie sie von Marx beschrieben wurde. Er betont die mangelnde Kenntnis vieler Historiker über Marx' Analyse und die damit verbundene verkürzte Geschichtsbetrachtung. Der Autor kündigt eine dialektische Analyse des Krieges an, die über rein objektivistische Betrachtungsweisen hinausgeht.
„Der Krieg führt die Menschen zusammen“: Dieses Kapitel beginnt mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen dem scheinbar banalen, grauen Alltag vor einem Krieg und dessen plötzlicher, alles entscheidender Bedeutung. Es wird die Schwierigkeit, den Beginn und das Ende eines Krieges exakt zu definieren, hervorgehoben, mit dem Beispiel des Ersten Weltkriegs im Osten, der nach 1918 weiterging. Der Krieg wird als eine objektive Kraft dargestellt, die subjektive Friedenswünsche ignoriert und die Ohnmacht des Menschen gegenüber dem von ihm selbst initiierten historischen Prozess zeigt.
Die Ohnmacht der Menschen gegenüber dem Krieg: Hier wird die Bedeutung des geographischen Milieus, des Volkscharakters und der politischen Gesinnung der Soldaten als sekundär im Vergleich zur kapitalistischen Ökonomie betrachtet. Der Autor argumentiert, dass die Menschen im kapitalistischen System nicht verstehen, was sie tun, wenn sie im Warenaustausch ihre Arbeit gleichsetzen, und dies erklärt die Millionen Toten der imperialistischen Kriege. Der Kriegsprozess wird als etwas dargestellt, das die Soldaten beherrscht, nicht umgekehrt, wie Beispiele aus Hitlers Gesprächen belegen.
Der Charakter des Krieges wurzelt in der kapitalistischen Ökonomie: Dieses Kapitel kritisiert objektivistische Geschichtsbetrachtungen und betont die Rolle spezifischer Klasseninteressen ausbeuterischen Charakters als treibende Kraft hinter Kriegen. Eine rein objektivistische Sichtweise wird als zur politischen Passivität führend bezeichnet, im Gegensatz zur politisch-militanten Praxisbezogenheit des Marxismus. Der Autor vergleicht die Rolle der deutschen Sozialdemokratie mit der eines „Afterdienstes“ für die Bankiers und stellt die Notwendigkeit einer revolutionären Praxis in den Vordergrund.
Die Menschen wissen nicht, was sie tun: Dieser Abschnitt illustriert die allgemeine Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs durch zeitgenössische Persönlichkeiten wie Edward Grey, Thomas Mann, Georg Simmel, Arthur Schnitzler und Lenin. Er erwähnt Gorkis Beschreibung des Krieges als ersten Akt einer Welttragödie und diskutiert Clausewitz' Auffassung des Krieges als Zweikampf im Lichte von Hegels Philosophie. Die Kritik an einer rein zweikampforientierten Sichtweise wird mit der Entwicklung von Massenheeren begründet.
Objektiver Gehalt des Krieges und Klasseninteressen: Das Kapitel befasst sich mit der Perversität des Krieges und der falschen Annahme, ihn durch bloße Ablehnung ("Krieg dem Kriege") lösen zu können. Der Pazifismus wird als verfehlter Ansatz kritisiert, der den revolutionären Umbruch im Krieg übersieht. Die Rolle der USA im Ersten Weltkrieg und Carl Schmitts These über die Notwendigkeit eines Feindes in Politik und Krieg werden erwähnt. Die Verdinglichung in der Industrie wird mit der des industriellen Maschinenkriegs in Verbindung gebracht.
„In Europa gehen die Lichter aus“: Dieses Kapitel thematisiert die Perversität und Ironie des Krieges und die Verherrlichung des Soldatenberufs als „normaler Beruf“. Der Autor kritisiert die Verewigung der gesellschaftlichen Spaltung durch den Krieg und stellt die hohe Opferzahl junger Soldaten in den Vordergrund. Die Pervertierung des Schillerschen „fraternité“ durch Wilhelm II. wird als Beispiel für den Tabubruch im Krieg und die damit verbundene „Umwertung der Werte“ dargestellt. Der Zerfall der internationalen Gelehrtenrepublik und die Reaktion von Hermann Hesse und August Macke auf den Krieg werden ebenfalls behandelt.
Der Krieg als Zweikampf und Massenkonflikt: Dieser Abschnitt analysiert den Wandel vom adligen Duell zum Massenkonflikt, die Verwerfung des Krieges als naive Vereinfachung und die Notwendigkeit einer gesellschaftswissenschaftlichen Analyse. Er hebt die Bedeutung der Massenkollektivität hervor, in der auch revolutionäre Umbrüche schlummern können.
Das Perverse und Ironische des Krieges: Der Schlussabschnitt betont die Perversität und Ironie des Krieges, indem er die Verherrlichung des Soldatenberufs durch Berufsoffiziere kritisiert. Der Autor vergleicht den Krieg mit der Menschwerdung des Affen und verdeutlicht die Spaltung der Gesellschaft in Unterdrücker und Unterdrückte. Die hohe Opferzahl junger Soldaten im Ersten Weltkrieg wird nochmals hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Dialektik des Krieges, Erster Weltkrieg, Kapitalismus, Klassenkampf, Massenheer, Pazifismus, Imperialismus, Objektivität, Subjektivität, Perversität, Ironie, Marxismus, Revolution.
Häufig gestellte Fragen zu: Dialektik der Kriege im 19. und 20. Jahrhundert
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Dialektik der Kriege im 19. und 20. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf den Ersten Weltkrieg. Sie hinterfragt die vermeintliche Einzigartigkeit des Ersten Weltkriegs im Kontext der kapitalistischen Entwicklung und analysiert die komplexen gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Faktoren, die zu seiner Entstehung und Ausweitung beigetragen haben.
Warum wird der Erste Weltkrieg nicht als "erster" Krieg betrachtet?
Die Vorbemerkung hinterfragt die Bezeichnung "Erster Weltkrieg" im Kontext bereits existierender globaler Handelskriege und der "ursprünglichen Akkumulation des Kapitals" (Marx). Es wird die mangelnde Kenntnis vieler Historiker über Marx' Analyse und die damit verbundene verkürzte Geschichtsbetrachtung kritisiert. Der Autor kündigt eine dialektische Analyse an, die über rein objektivistische Betrachtungsweisen hinausgeht.
Welche Rolle spielt die kapitalistische Ökonomie im Kontext des Krieges?
Die Arbeit argumentiert, dass die kapitalistische Ökonomie die Wurzel des Krieges ist. Objektivistische Geschichtsbetrachtungen werden kritisiert, da sie die Rolle spezifischer Klasseninteressen ausbeuterischen Charakters als treibende Kraft hinter Kriegen übersehen. Eine rein objektivistische Sichtweise wird als zur politischen Passivität führend bezeichnet.
Wie wird das Verhältnis von objektiven und subjektiven Faktoren im Kriegsgeschehen dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Dialektik von objektiven (kapitalistische Ökonomie, Klasseninteressen) und subjektiven Faktoren (individuelle Wahrnehmungen, politische Ideologien). Sie betont die Ohnmacht des Einzelnen gegenüber dem von ihm selbst initiierten historischen Prozess des Krieges und die Schwierigkeit, den Beginn und das Ende eines Krieges exakt zu definieren.
Welche Rolle spielen Klasseninteressen im Ausbruch und Verlauf von Kriegen?
Klasseninteressen ausbeuterischen Charakters werden als treibende Kraft hinter Kriegen gesehen. Die Arbeit kritisiert die Rolle der deutschen Sozialdemokratie und betont die Notwendigkeit einer revolutionären Praxis, im Gegensatz zu einer rein objektivistischen oder pazifistischen Betrachtungsweise.
Wie wird der Pazifismus in der Arbeit bewertet?
Der Pazifismus wird als verfehlter Ansatz kritisiert, der den revolutionären Umbruch im Krieg übersieht. Die bloße Ablehnung des Krieges ("Krieg dem Kriege") wird als unzureichend betrachtet.
Welche Aspekte des Krieges werden als besonders "pervers" und "ironisch" beschrieben?
Die Perversität und Ironie des Krieges werden in verschiedenen Kapiteln hervorgehoben. Dazu gehören die Verherrlichung des Soldatenberufs, die Verewigung der gesellschaftlichen Spaltung durch den Krieg, die hohe Opferzahl junger Soldaten und die Verkehrung von Werten (z.B. die Pervertierung des Schillerschen "fraternité").
Welche Persönlichkeiten und ihre Ansichten werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Ansichten zeitgenössischer Persönlichkeiten wie Edward Grey, Thomas Mann, Georg Simmel, Arthur Schnitzler, Lenin, Gorki und Clausewitz. Die Rolle von Carl Schmitt und seine These über die Notwendigkeit eines Feindes in Politik und Krieg werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird der Wandel vom Zweikampf zum Massenkonflikt dargestellt?
Die Arbeit analysiert den Wandel vom adligen Duell zum Massenkonflikt und die damit verbundene Notwendigkeit einer gesellschaftswissenschaftlichen Analyse, die über naive Vereinfachungen hinausgeht. Die Bedeutung der Massenkollektivität und des darin schlummernden revolutionären Potenzials wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dialektik des Krieges, Erster Weltkrieg, Kapitalismus, Klassenkampf, Massenheer, Pazifismus, Imperialismus, Objektivität, Subjektivität, Perversität, Ironie, Marxismus, Revolution.
- Quote paper
- Heinz Ahlreip (Author), 2014, Zur Dialektik der Kriege im 19. und 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des sogenannten Ersten Weltkrieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/279033