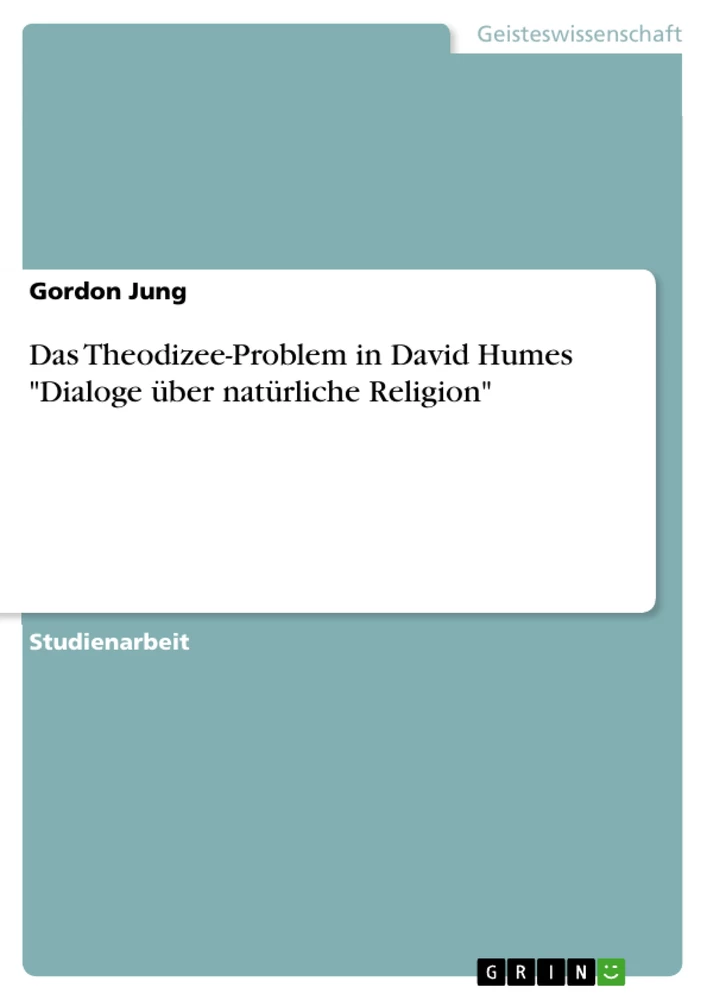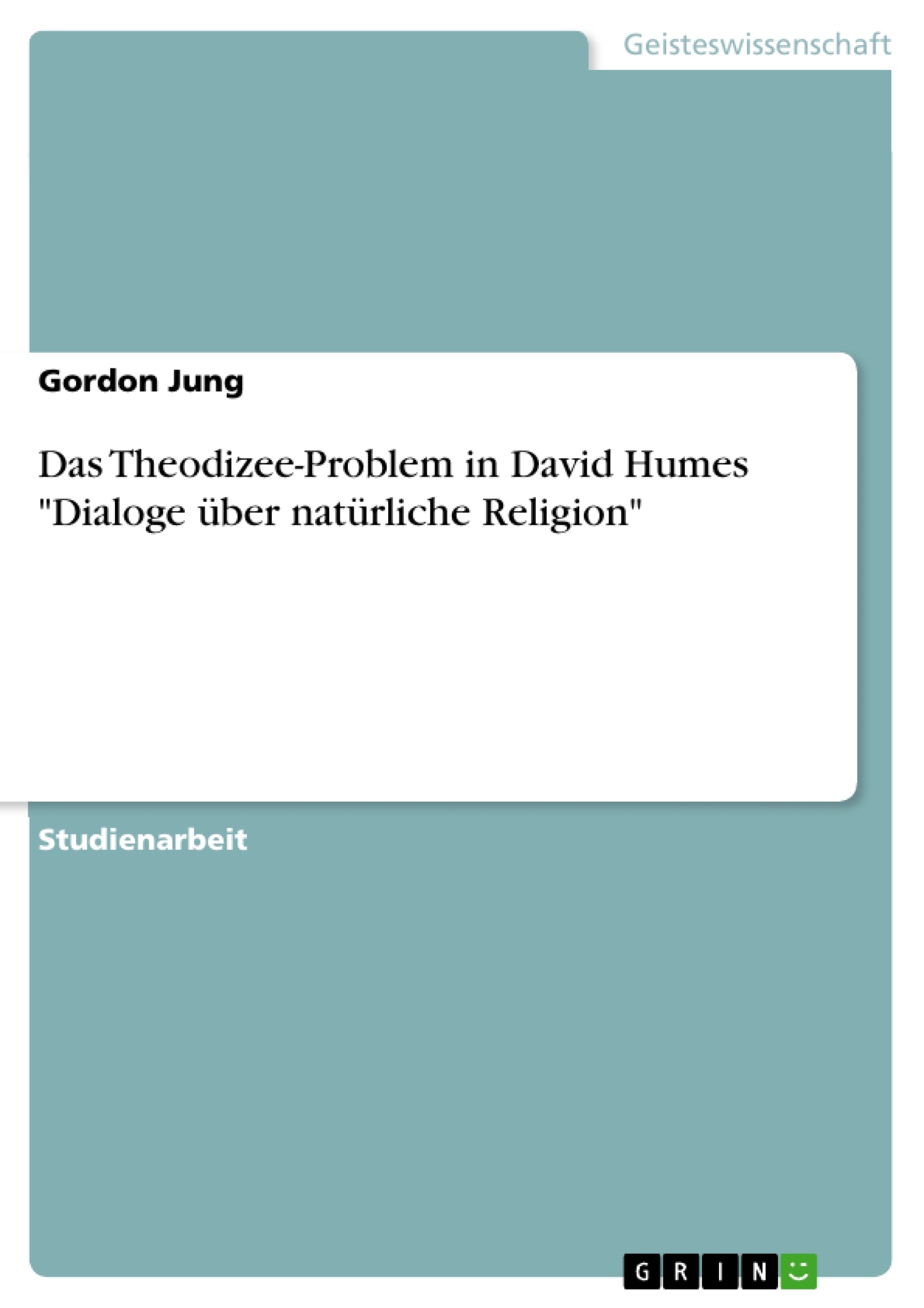„Si Deus est, unde malum?“ Eines der wohl gravierendsten Probleme, das sich dem traditionellen Theismus – verbunden mit der Vorstellung eines allmächtigen, allwissenden sowie allgütigen Gottes – auftut, ist die Frage: ,,Warum gibt es überhaupt irgend-welches Unglück in der Welt?“ Insbesondere im Kontext der Auseinandersetzung mit der theologia naturalis, worin der deistische Vernunftglaube – abseits jenes auf der Offenbarung gegründeten Glaubens – untersucht wird, stellt der schottische Philosoph David Hume (1711-1776) in seinem religionskritischen Hauptwerk Dialogues Concern-ing Natural Religion (1779 posthum) auch das Problem der Theodizee dar. Hierbei wird das aus De ira dei postulierte, epikureische Theodizee-Trilemma präsentiert: ,,Ist er willens, aber nicht fähig, Übel zu verhindern? Dann ist er ohnmächtig. Ist er fähig aber nicht willens? Dann ist er boshaft. Ist er sowohl fähig als auch willens? Woher kommt dann das Übel?“ Profane Erfahrungen von pointless evil in Form von Naturkatastrophen, Krankheiten, Verbrechen und ähnlichen Kontingenzen tragen zu immerwährenden Aktualität und Zur Unlösbarkeit des Theodizee-Problems bei, wodurch dieser Einwand gegen die Essenz oder gar Existenz eines supranaturalen, intelligent designers wohl legitimer Weise als eines der stärksten Gegenargumente gewertet werden kann. Erst jüngst neuzeitliche Ereignisse, wie der zur Zeit des Nationalsozialismus grassierte Holocaust, brachen sowohl im theologischen als auch im religionsphilosophischen Diskurs neue Debatten auf, wodurch der Theologe Armin Kreiner in Gott im Leid – Zur Stichhaltigkeit der Theodizee-Argumente berechtigt konstatiert: ,,Gläubigen wird sie [sc. die Herausforderung des Theodizee-Problems G.J.] nicht nur in Situationen unmittelba-rer Leiderfahrung schmerzlich bewusst. In mittelbarer Weise ist sie im Zeitalter globaler Kommunikation und Information geradezu allgegenwärtig. Die Medien überschütten jeden täglich mit Bildern und Berichten von unfaßbarem Leid.“ Hieraus resultierend erscheint jedoch eine weiterhin konstante Annahme und Proklamation eines gütigen und allmächtigen Welturhebers, angesichts der scheinbaren Unlösbarkeit des Theodizee-Problems, als eher kontraintuitiv und für Laien unbegreiflich. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Theodizee-Problematik allgemein
- Ein historisch-systematischer Überblick
- Das Übel – malum morale und malum physicum
- Lösungsversuche des Theodizee-Problems
- ,,Hume on evil" - Das Theodizee-Problem in den Teilen X und XI
- Der Argumentationsverlauf
- Das logische Problem der Theodizee
- Die Theodizee-Problematik allgemein
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Theodizee-Problem, einer zentralen Herausforderung für den traditionellen Theismus. Sie analysiert die Frage, wie sich die Existenz von Leid und Übel in der Welt mit der Vorstellung eines allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gottes vereinbaren lässt. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Argumentation des schottischen Philosophen David Hume in seinen Dialogues Concerning Natural Religion, insbesondere auf die Teile X und XI.
- Die historische Entwicklung des Theodizee-Problems
- Die verschiedenen Lösungsansätze zur Rechtfertigung Gottes
- Die Kritik Humes am Theodizee-Problem
- Das logische Problem der Theodizee
- Die Relevanz des Theodizee-Problems für die Religionsphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Theodizee-Problems ein und stellt die zentrale Frage nach der Existenz von Übel in einer Welt, die von einem allmächtigen und allgütigen Gott geschaffen wurde. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Theodizee-Problems und zeigt die Relevanz dieser Frage für die Religionsphilosophie auf.
Der erste Abschnitt des Hauptteils befasst sich mit der Theodizee-Problematik im Allgemeinen. Er bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Theodizee-Problems von der Antike bis zur Neuzeit und beleuchtet die verschiedenen Lösungsansätze, die im Laufe der Geschichte vorgeschlagen wurden. Der Abschnitt analysiert auch die verschiedenen Arten von Übel, die in der Welt existieren, und diskutiert die Schwierigkeiten, diese mit der Vorstellung eines allgütigen Gottes in Einklang zu bringen.
Der zweite Abschnitt des Hauptteils konzentriert sich auf die Argumentation von David Hume in seinen Dialogues Concerning Natural Religion. Er analysiert die Argumentationslinie der Teile X und XI, in denen Hume das Theodizee-Problem aus der Perspektive des Skeptikers Philo beleuchtet. Der Abschnitt untersucht insbesondere das logische Problem der Theodizee, das Hume als einen zentralen Einwand gegen die Existenz eines allmächtigen und allgütigen Gottes anführt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Theodizee-Problem, David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, das Übel, das logische Problem der Theodizee, die Rechtfertigung Gottes, die Religionsphilosophie, der Deismus, der Theismus, die Naturreligion, das Problem des Bösen, die Existenz Gottes.
- Quote paper
- Gordon Jung (Author), 2013, Das Theodizee-Problem in David Humes "Dialoge über natürliche Religion", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/277674