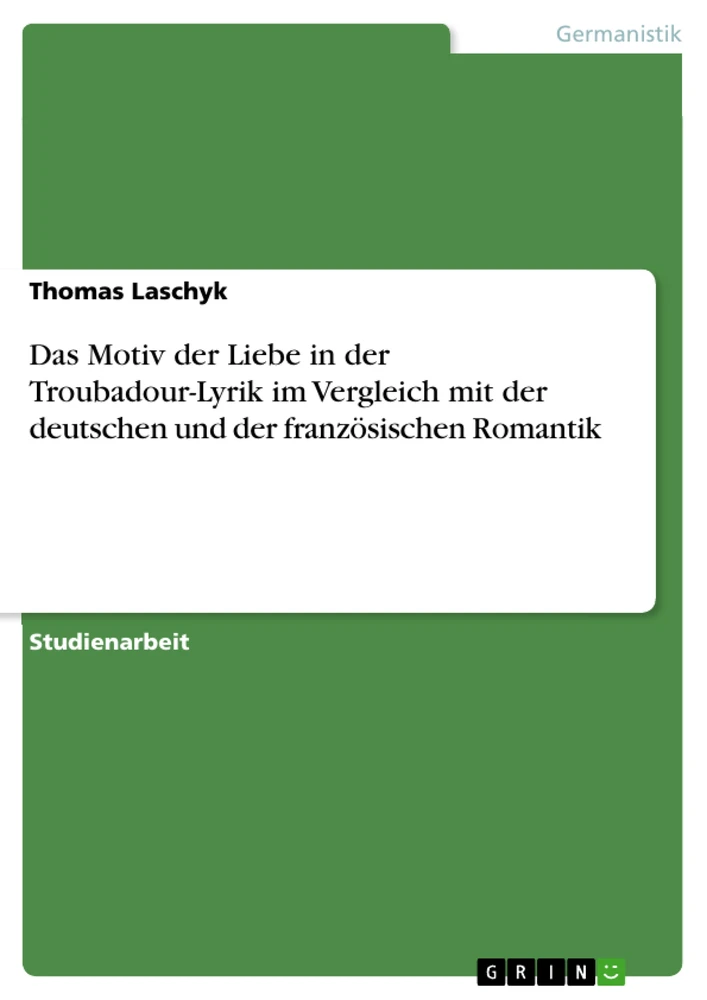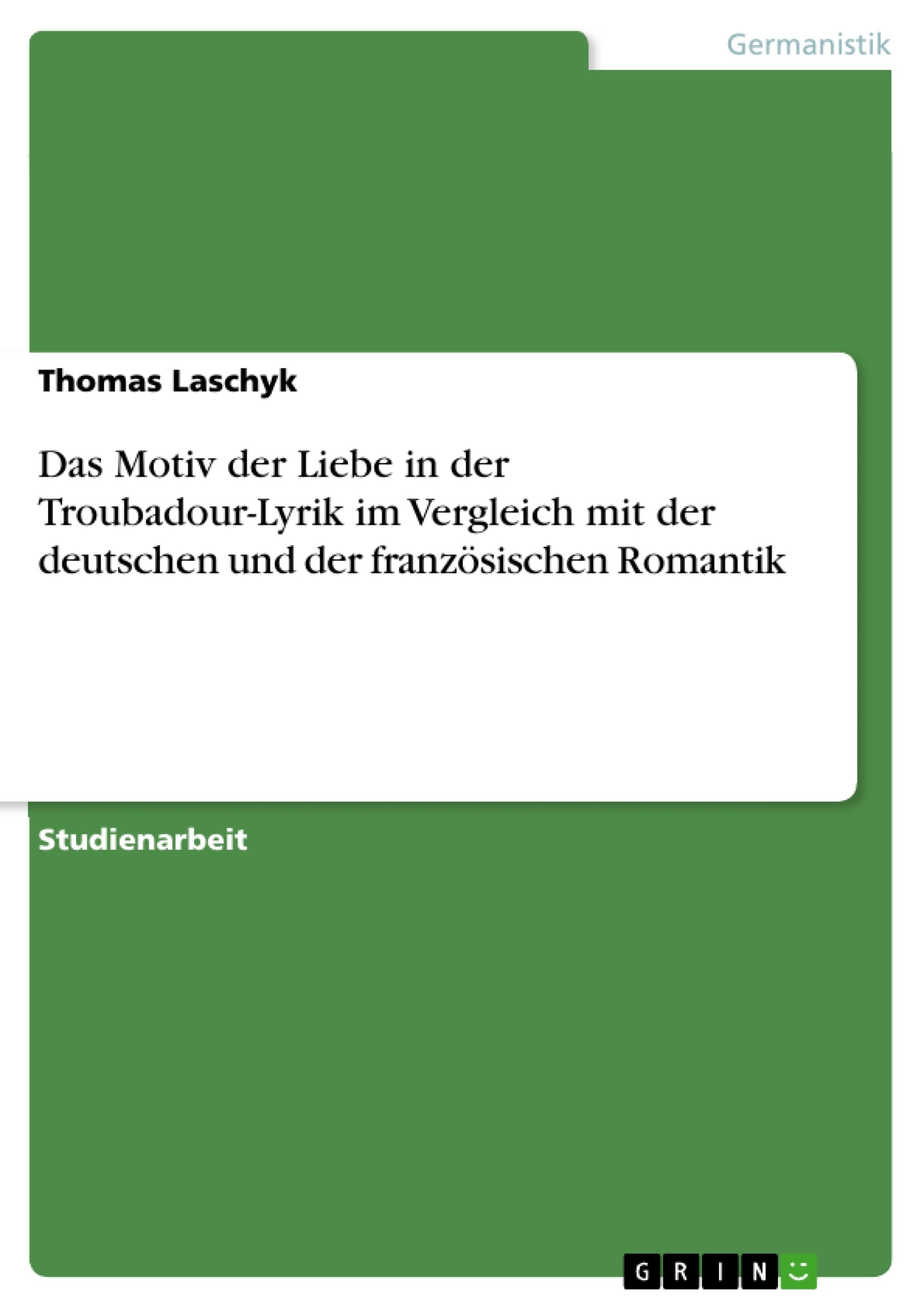Im heutigen alltäglichen Verständnis von Lyrik sind die wesentlichen Merkmale von Gedichten, dass sie sich reimen und eine Strophenform besitzen. Des Weiteren drehen sich Gedichte um Gefühle und Emotionsverarbeitung, oftmals Liebe. Und die verwendete Sprache differenziert von der Alltagssprache, da sie "verdichtet" ist. Diese in der Öffentlichkeit bekannten Auffassungen sind zwar weder falsch, noch vornehmlich Ausnahmen, jedoch ist die Gattung der Lyrik selbstverständlich nicht auf ihre bekanntesten und wohl häufigsten Ausprägungen zu reduzieren. Reimlose Prosagedichte oder erzählende Gedichtformen wie die Ballade sind untypische Formen er Lyrik, werden jedoch gemeinhin mit guten Gründen hinzugerechnet. Doch wenn sich diese Auffassungen von Dichtung in der Bevölkerung verankert haben, heißt das nur, wie großen Einfluss diese Formen der Literatur haben. Doch wie kam es dazu? Wie entstand diese Gattung und speziell diese so dominante Ausprägung?
Verfolgt man die Spuren der Lyrik zurück zu ihren Ursprüngen, findet man sich im antiken Griechenland wieder. Die Dithyrambendichtung war eine Textform mit musikalischer Begleitung, meist der der Lyra, von welcher der Name der Lyrik herrührt, oder der Kithara.1 Diese Textgattung war also eng an die Entwicklung des Liedes geknüpft und richtete sich nach diesem aus: In Länge, der Emotionalität des Inhaltes und der Versform, welche zu den rekurrierenden Melodieabläufen passt. Um den Anforderungen des Liedes zu genügen, musste nicht nur die Länge der Sätze und Worte passen, auch inhaltlich war es erforderlich, so kurz, prägnant und kreativ wie möglich das Gesagte auszudrücken. Daraus folgte die hohe Informationsdichte der Gattung und einer hohen Zahl an rhetorischer Figuren wie Metaphern, Symbolen, Analogien oder Chiffren. Lange Zeit noch war die Lyrik an das Lied geknüpft, so auch noch im Mittelalter. Für die Entwicklung und die Wahrnehmung der Lyrik von entscheidender Bedeutung war die Troubadourlyrik aus dem 12. Jahrhundert. Die Troubadoursänger und ihre Nachahmer aus anderen Sprachen festigten eine so einflussreiche Tradition und Techniken, dass ihre Errungenschaften bis heute Bedeutung tragen. Der Reim, die Strophe und das Sonett sind ohne sie heute nicht denkbar.2 Unmittelbar nach ihrer Blütezeit noch viel rezipiert, nahm das Interesse an der provenzalischen Dichtung ab, bis die Forschung und die öffentliche Wahrnehmung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, mit Einsetzen der Romantik, die Lieder wiederentdeckten und ihn
Inhaltsverzeichnis
- I. Der Ursprung der Lyrik
- II. Das Motiv der Liebe in der Troubadour-Lyrik im Vergleich mit der deutschen und der französischen Romantik
- 1. Troubadour-Lyrik
- 1.1. Sozio-historische und sprachliche Einordnung
- 1.2. Stilistische Merkmale anhand dreier Beispieltexte
- 1.3. Das Motiv der Liebe
- 2. Romantik
- 2.1. Sozio-historische Verortung der Romantik
- 2.1.1 Die Deutsche Romantik anhand von Hölderlins "Diotima"
- 2.1.2. Die Französische Romantik anhand von Lamartines "Le lac"
- 2.1.3. Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- 3. Die romantischen Rückbezüge auf das Mittelalter allgemein und die Troubadourlyrik im Besonderen
- 3.1. Rückbezüge der Romantik auf Stoffe und Personen der Troubadourlyrik anhand von Ludwig Uhlands "Bertran de Born"
- 3.2. Das provenzalische Liebesmotiv in der Romantik
- 2.1. Sozio-historische Verortung der Romantik
- 4. Die historische Bedeutung für den Nationalismus
- 1. Troubadour-Lyrik
- III. Der Einfluss der Troubadourlyrik und ihre Zeitlosigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Troubadour-Lyrik und ihren Einfluss auf die deutsche und französische Romantik, insbesondere im Hinblick auf das Liebesmotiv. Sie beleuchtet die wesentlichen Merkmale der Troubadour-Lyrik im Kontext ihres sozio-historischen Hintergrunds und analysiert ausgewählte Beispiele, um deren Auswirkungen auf die beiden Romantik-Epochen zu verdeutlichen.
- Die Troubadour-Lyrik und ihre sozio-historischen Wurzeln
- Stilistische Merkmale der Troubadour-Lyrik und ihre Rezeption in der deutschen und französischen Romantik
- Das Liebesmotiv in der Troubadour-Lyrik im Vergleich mit der deutschen und französischen Romantik
- Der Einfluss der Troubadour-Lyrik auf die Entwicklung der Lyrik in den beiden Romantik-Epochen
- Die historische Bedeutung der Troubadour-Lyrik für den Nationalismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Der Ursprung der Lyrik Dieses Kapitel befasst sich mit den Anfängen der Lyrik im antiken Griechenland und erläutert die Bedeutung der Dithyrambendichtung für die Entwicklung des Liedes. Es stellt den Einfluss der Troubadourlyrik aus dem 12. Jahrhundert auf die Entwicklung der Lyrik dar und zeigt die bleibende Bedeutung von Reim, Strophe und Sonett auf.
- Kapitel II: Das Motiv der Liebe in der Troubadour-Lyrik im Vergleich mit der deutschen und der französischen Romantik Dieses Kapitel analysiert das Liebesmotiv in der Troubadour-Lyrik und untersucht dessen Einfluss auf die deutsche und französische Romantik. Es betrachtet die sozio-historischen Hintergründe der Troubadour-Lyrik und analysiert anhand dreier Beispieltexte deren stilistische Merkmale. Anschließend werden die deutschen und französischen Romantik-Epochen in ihren jeweiligen historischen Kontexten und Merkmalen beleuchtet, mit einem besonderen Fokus auf die Gedichte "Diotima" von Hölderlin und "Le Lac" von Lamartine. Dabei werden stilistische und thematische Gemeinsamkeiten der Werke herausgestellt und ein Vergleich zwischen den verschiedenen Texten gezogen.
Schlüsselwörter
Troubadour-Lyrik, Romantik (deutsche und französische), Liebesmotiv, Sozio-historische Einordnung, Stilistische Merkmale, Gedichtanalyse, Hölderlin, Lamartine, Einfluss, Zeitlosigkeit
- Quote paper
- Thomas Laschyk (Author), 2013, Das Motiv der Liebe in der Troubadour-Lyrik im Vergleich mit der deutschen und der französischen Romantik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/277397