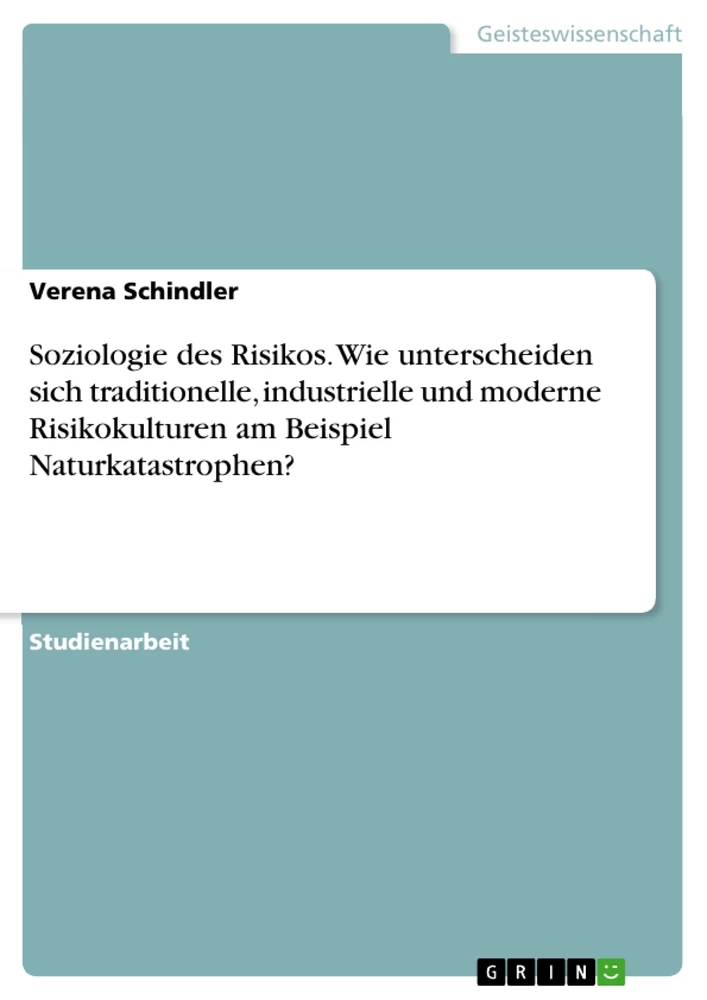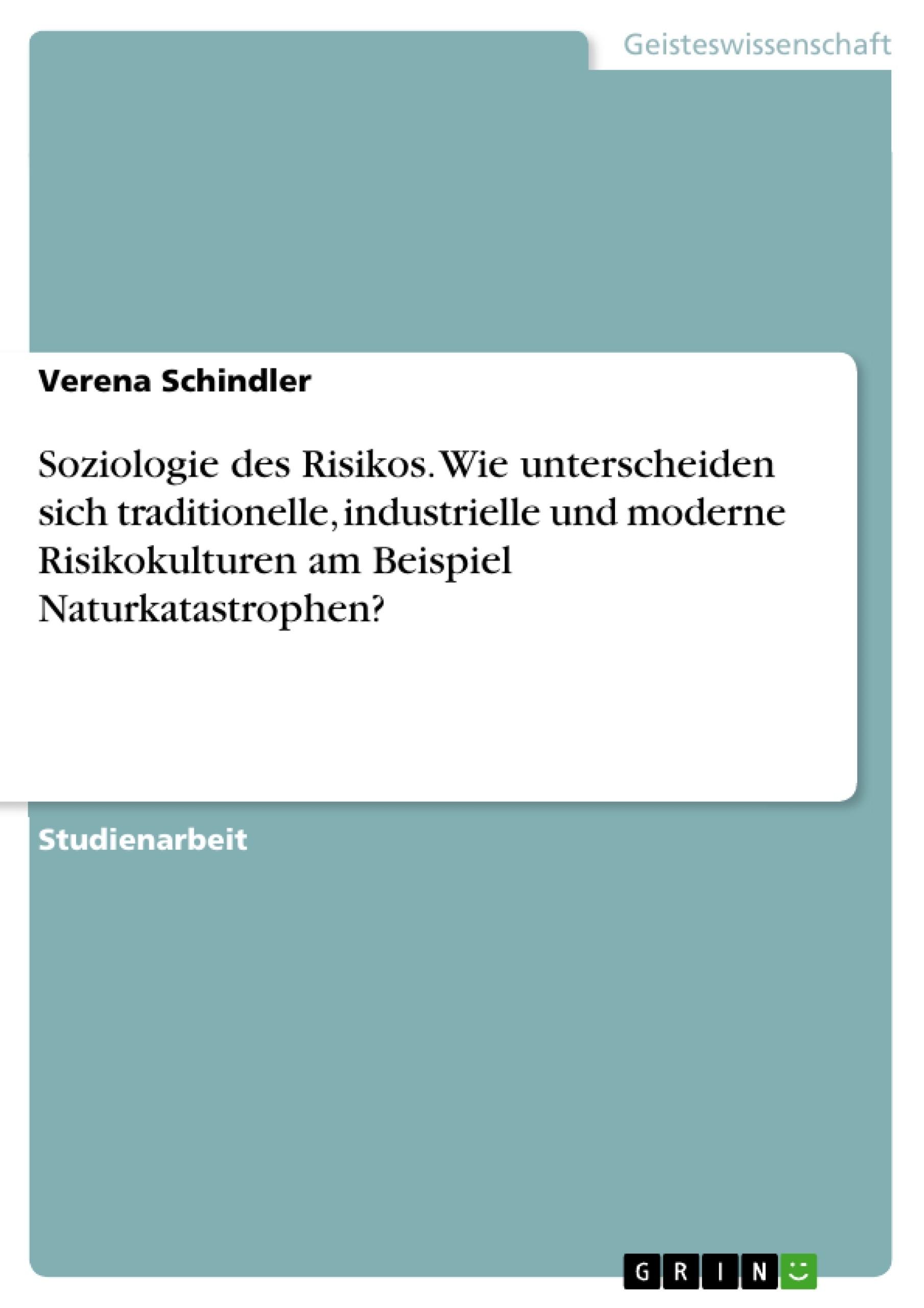Wir leben in einer "Risikogesellschaft" laut des Soziologen Ulrich Beck. Dem kann man durchaus zustimmen, wenn wir an die verschiedensten Risiken denken, mit denen wir täglich in den Medien konfrontiert werden. Zum Beispiel droht den Menschen das Risiko von Naturkatastrophen durch das sich verändernde Klima und durch den Straßenverkehr steigt das Risiko extremer Umweltverschmutzung und gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Auch Technologien wie Gen- und Nukleartechnik bergen unendlich viele Gefahren, die oftmals noch gar nicht bekannt sind. Außerdem beinhalten Kommunikationstechnologien neben ihren großen Chancen auch erhebliche Risiken, die sich in Datenschutzskandalen oder Cyberterrorismus widerspiegeln. Selbst die Techniken der Medizin sind nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen, die meist erst verzögert auftreten. Neben diesen technischen Risikothemen ist die Gesellschaft aber auch von sozialen Gefährdungen betroffen. Die immer wachsende soziale Ungleichheit, aber auch Arbeitslosigkeit oder der Zerfall von Gesellschaften müssen hier angemerkt werden. All diese Risiko- Bereiche haben etwas gemeinsam:
„Die Unsicherheit darüber, welche Folgen gegenwärtiges Handeln für unmittelbare oder auch weitreichende Zukünfte hat“ (Nassehi 1997: 252).
Dieses Handeln benötigt ein gewisses Maß an Kenntnissen und Vertrauen in mögliche Nachfolgen der Handlungen. In unserer aktuellen Gesellschaft herrscht aufgrund des öffentlichen Diskurses die Annahme, dass ein solches Vertrauen kaum vorliegt. Das wird vor allem daran deutlich, wenn schon bei den gewöhnlichsten Handlungen und Bestimmungen darüber diskutiert wird, welche denkbaren unabsichtlichen Folgen beziehungsweise Schäden resultieren könnten.
Jedoch war der Umgang mit Risiko und Unsicherheit nicht immer gleich. Die folgende Arbeit soll deshalb Aufschluss darüber geben, wie sich die unterschiedlichen Risikokulturen am Beispiel Naturkatastrophen von der traditionellen, über die industrielle bis hin zur heutigen modernen Gesellschaft verändert haben und wie sich diese Kulturformen untereinander unterscheiden.
Um den Kontext besser erfassen zu können, soll zu Beginn eine Definition des Risikobegriffs stehen. Danach wird die traditionelle, industrielle und moderne Risikokultur in den Gesellschaften dargestellt und erläutert. Anschließend werden die genauen Unterschiede dieser drei Modelle am Beispiel von Naturkatastrophen demonstriert und abschließend ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Risikobegriff
- Risikokulturen
- Traditionelle Gesellschaften
- Industrielle Gesellschaften
- Moderne Gesellschaften
- Unterschiede der Modelle am Beispiel von Naturkatastrophen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Soziologie des Risikos und untersucht, wie sich traditionelle, industrielle und moderne Risikokulturen am Beispiel von Naturkatastrophen unterscheiden. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Wahrnehmungen, Erfahrungen und Verarbeitungsprozesse von Risiken in den jeweiligen Gesellschaftsformen.
- Entwicklung des Risikobegriffs in verschiedenen Gesellschaften
- Charakteristika von Risikokulturen in traditionellen, industriellen und modernen Gesellschaften
- Vergleich der Risikokulturen anhand von Naturkatastrophen
- Analyse der Rolle von Wissen, Wahrnehmung und Bewältigungsstrategien in Bezug auf Risiken
- Bedeutung von Versicherung, Individualisierung und technologischem Fortschritt für die Risikokultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Risikogesellschaft ein und stellt die Relevanz der Untersuchung der Risikokulturen heraus. Der zweite Abschnitt definiert den Risikobegriff und erläutert die soziologische Perspektive auf Risiken. Der dritte Abschnitt analysiert die Risikokulturen in traditionellen, industriellen und modernen Gesellschaften. Dabei wird der Fokus auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen, Erfahrungen und Verarbeitungsprozesse von Risiken gelegt. Der vierte Abschnitt vergleicht die drei Modelle am Beispiel von Naturkatastrophen und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die jede Gesellschaftsform in Bezug auf Naturkatastrophen bewältigen muss.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Soziologie des Risikos, Risikokulturen, traditionelle, industrielle und moderne Gesellschaften, Naturkatastrophen, Wissen, Wahrnehmung, Bewältigungsstrategien, Versicherung, Individualisierung, technologischer Fortschritt, Klimawandel und Risikogesellschaft. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Risikobegriffs, die Charakteristika von Risikokulturen in verschiedenen Gesellschaftsformen und die spezifischen Herausforderungen, die jede Gesellschaftsform in Bezug auf Naturkatastrophen bewältigen muss.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet eine „Risikogesellschaft“ nach Ulrich Beck?
Eine Risikogesellschaft ist durch die Unsicherheit über die Folgen gegenwärtigen Handelns (z. B. Klimawandel, Nukleartechnik) geprägt.
Wie unterscheiden sich Risikokulturen bei Naturkatastrophen?
Traditionelle Gesellschaften sahen Katastrophen oft als Schicksal, industrielle Gesellschaften setzen auf Beherrschbarkeit und Versicherung, moderne Gesellschaften fokussieren auf komplexe Vorsorge.
Welche Rolle spielt Wissen bei der Risikowahrnehmung?
In der modernen Gesellschaft herrscht oft ein Vertrauensverlust vor, da über jede Handlung hinsichtlich denkbarer unabsichtlicher Schäden diskutiert wird.
Was sind technische vs. soziale Risiken?
Technische Risiken betreffen Gen- oder Kommunikationstechnologien, soziale Risiken umfassen Arbeitslosigkeit oder wachsende soziale Ungleichheit.
Wie wird der Risikobegriff soziologisch definiert?
Risiko ist die Unsicherheit darüber, welche Folgen das heutige Handeln für die Zukunft hat, was ein gewisses Maß an Vertrauen erfordert.
- Quote paper
- Verena Schindler (Author), 2014, Soziologie des Risikos. Wie unterscheiden sich traditionelle, industrielle und moderne Risikokulturen am Beispiel Naturkatastrophen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275238