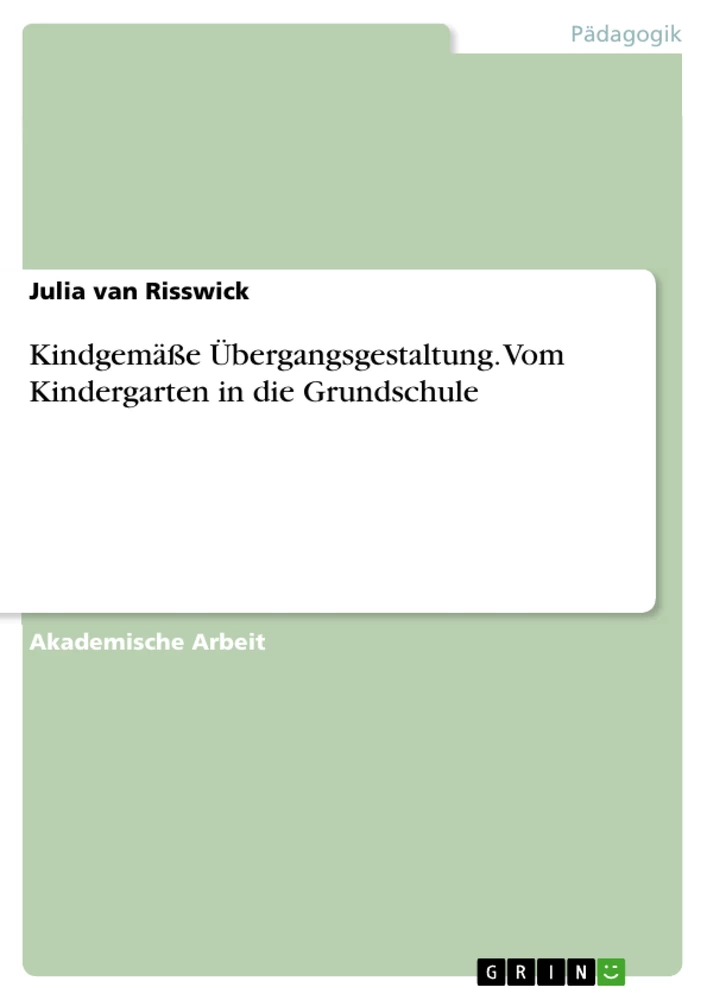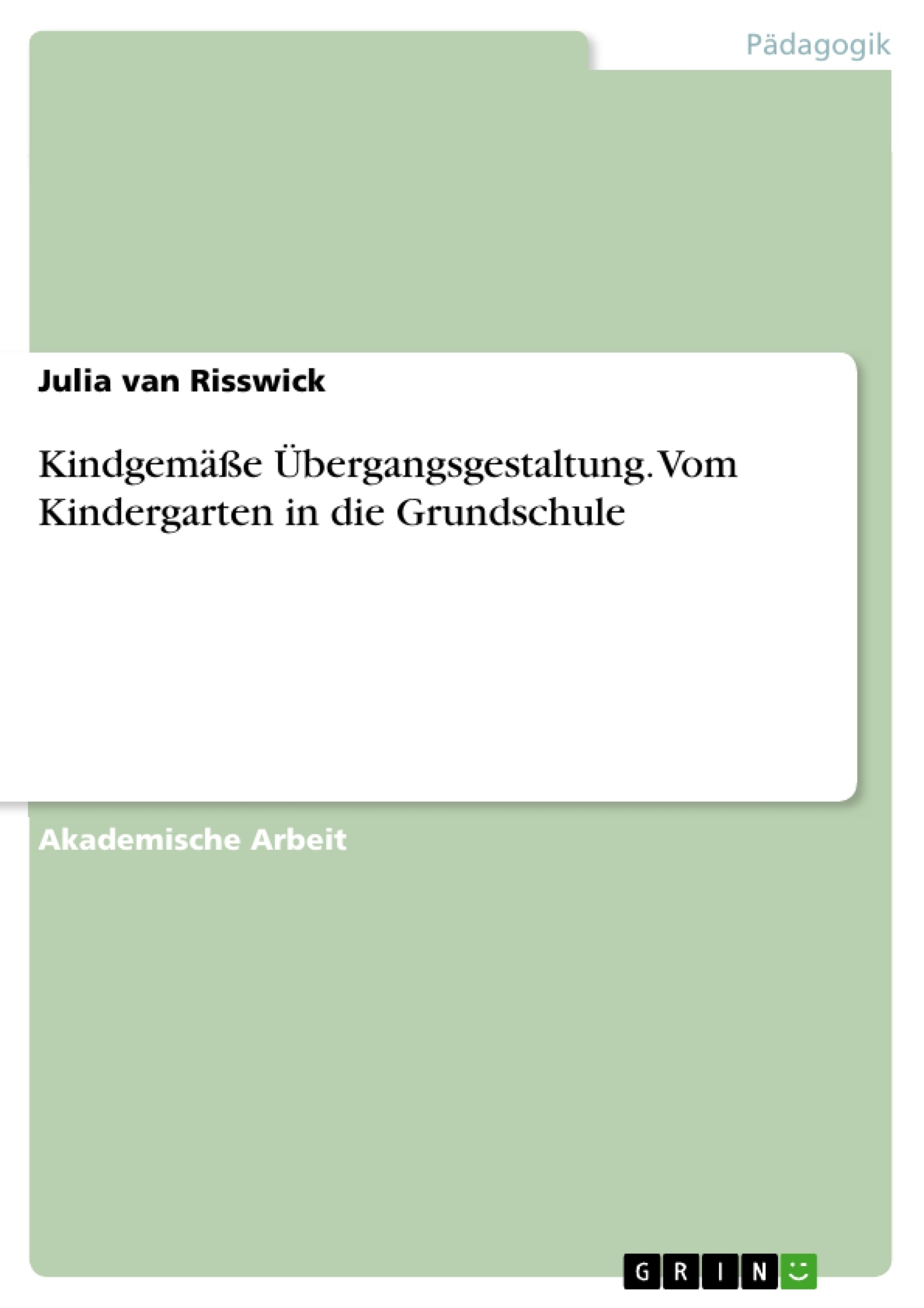In dieser Arbeit werde ich verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung des Übergangs Kindergarten - Grundschule vorstellen. Mit Hilfe der hier ausgewählten Gestaltungsmöglichkeiten soll die Umsetzung des Übergangs ‚gleitend’ und kindgerecht gelingen. Das positive oder negative Erleben des Kindes auf dem Weg in den neuen Lebensbereich ist größtenteils abhängig von den Handhabungen der Institutionen Kindergarten und Schule als auch von Personen wie Erziehern, Lehrern und Eltern.´
Ich werde mich bei den vorgestellten Gestaltungsvarianten im engeren Sinne auf die Ausgangslage der Schule konzentrieren und nicht auf den Elementarbereich. Ich möchte allerdings anmerken, dass die nun folgenden Maßnahmen nur ein denkbarer Weg für einen kindgerechten Übergang sind. Es gibt unterschiedliche Lösungen für das Problem des Übergangs, auch können mehrere Möglichkeiten gleichzeitig existieren, sich ergänzen und miteinander kombiniert werden.
Aus dem Inhalt:
- Kooperation Grundschule - Kindergarten;
- Die Schulanmeldung;
- Der erste Schultag
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kooperation Grundschule — Kindergarten
- Die Schulanmeldung
- Kontaktaufnahme
- Der erste Schultag
- Zusammenfassung
- Quellennachweis (inklusive weiterführender Literatur)
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit verschiedenen Möglichkeiten zur Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule. Ziel ist es, den Übergang „gleitend" und kindgerecht zu gestalten, um den Kindern ein positives Erlebnis auf dem Weg in den neuen Lebensbereich zu ermöglichen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Ausgangslage der Schule und beleuchtet insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule, die Schulanmeldung, die Kontaktaufnahme zwischen Schule und Kindern sowie die Gestaltung des ersten Schultages.
- Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule
- Kindgerechte Gestaltung der Schulanmeldung
- Wichtige Formen der Kontaktaufnahme vor Schulbeginn
- Gestaltung des ersten Schultages
- Bedeutung von Ritualen und Traditionen beim Übergang
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule vor und erläutert die Bedeutung einer kindgerechten Gestaltung. Die Autorin betont, dass das positive oder negative Erleben des Kindes vom Zusammenspiel von Institutionen, Erziehern, Lehrern und Eltern abhängt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Schule und bietet verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für einen erfolgreichen Übergang.
Kooperation Grundschule — Kindergarten
Dieses Kapitel befasst sich mit der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule als wesentliche Grundlage für einen reibungslosen Übergang. Die Autorin zeigt die historische Entwicklung der Zusammenarbeit auf und beleuchtet die aktuellen Herausforderungen und Barrieren. Sie betont die Wichtigkeit einer engen Kooperation auf verschiedenen Ebenen, um den Kindern den Wechsel in die Schule zu erleichtern. Die Autorin stellt verschiedene Formen der Zusammenarbeit vor, wie z.B. gemeinsame Aktivitäten, Elternabende und gegenseitige Hospitationen. Sie argumentiert, dass eine Verzahnung von Kindergarten und Grundschule, anstatt nur einer „Brücke", die Kinder optimal auf die Schule vorbereiten kann.
Die Schulanmeldung
Dieses Kapitel fokussiert auf die Schulanmeldung als einen wichtigen Schritt im Übergangsprozess. Die Autorin betont, dass dieser Tag für das Kind eine besondere Begegnung mit der Schule darstellt und daher kindgerecht gestaltet werden sollte. Sie plädiert für eine Atmosphäre des Willkommens und der Wertschätzung, anstatt einer bloßen Registrierung. Die Autorin gibt Tipps für die Organisation der Schulanmeldung, um einen positiven Eindruck bei den Kindern und ihren Eltern zu hinterlassen. Sie betont die Wichtigkeit, dass die Kinder sich nicht geprüft oder abgefertigt fühlen, sondern sich willkommen und gut aufgehoben fühlen.
Kontaktaufnahme
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Möglichkeiten, schon vor Schulbeginn eine Verbindung zum Kind und seinen Eltern herzustellen. Die Autorin betont die Wichtigkeit von Informationsabenden für Eltern, um ihnen die Arbeit und das Konzept der Grundschule vorzustellen. Sie erläutert die Bedeutung von Kennenlerntagen, die den Kindern die Möglichkeit bieten, ihre zukünftigen Lehrer und Mitschüler kennenzulernen. Die Autorin stellt die Schnupperstunde als eine weitere Möglichkeit vor, die Kinder an die Schule heranzuführen und den Übergang zu erleichtern.
Der erste Schultag
Dieses Kapitel widmet sich dem ersten Schultag und seiner Bedeutung für die Kinder. Die Autorin betont, dass dieser Tag sowohl für Kinder als auch für Eltern ein einschneidendes Erlebnis ist. Um den Kindern die Angst vor dem neuen Lebensabschnitt zu nehmen, sollten die Schuleintrittsfeier und die erste Unterrichtsstunde kindgerecht gestaltet werden. Die Autorin erläutert die Wichtigkeit von Ritualen, die den Kindern Sicherheit und Orientierung vermitteln. Sie betont die Bedeutung einer positiven und einladenden Atmosphäre, um den Kindern ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Willkommenseins zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, die kindgerechte Gestaltung des Übergangs, die Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule, die Schulanmeldung, die Kontaktaufnahme zwischen Schule und Kindern sowie die Gestaltung des ersten Schultages. Die Autorin beleuchtet die Bedeutung von Ritualen, Traditionen und einer einladenden Atmosphäre, um den Kindern den Wechsel in die Schule so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Text bezieht sich auf verschiedene pädagogische Konzepte und Theorien, um die Bedeutung einer erfolgreichen Übergangsgestaltung für die Entwicklung der Kinder zu verdeutlichen.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule kindgerecht gestaltet werden?
Durch eine enge Kooperation der Institutionen, kindgerechte Schulanmeldungen, Kennenlerntage und Rituale am ersten Schultag kann der Übergang "gleitend" erfolgen.
Welche Rolle spielt die Kooperation zwischen Erziehern und Lehrern?
Eine enge Zusammenarbeit (z. B. durch Hospitationen und gemeinsame Elternabende) ist die Basis, um die Kinder optimal auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten.
Was ist bei einer kindgerechten Schulanmeldung wichtig?
Die Anmeldung sollte eine Atmosphäre des Willkommens und der Wertschätzung vermitteln, statt nur ein bürokratischer Akt oder eine Prüfungssituation zu sein.
Was sind "Schnupperstunden"?
Das sind Termine vor Schulbeginn, an denen Kindergartenkinder die Schule besuchen, um ihre zukünftigen Lehrer und Mitschüler in einer echten Unterrichtssituation kennenzulernen.
Warum sind Rituale am ersten Schultag von Bedeutung?
Rituale vermitteln den Kindern Sicherheit und Orientierung in einer für sie völlig neuen und potenziell angstbesetzten Situation.
Wer trägt die Verantwortung für einen erfolgreichen Übergang?
Das Erleben des Kindes hängt maßgeblich vom Zusammenspiel der Institutionen (Kita, Schule) sowie der Erzieher, Lehrer und Eltern ab.
- Arbeit zitieren
- Julia van Risswick (Autor:in), 2005, Kindgemäße Übergangsgestaltung. Vom Kindergarten in die Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/275044