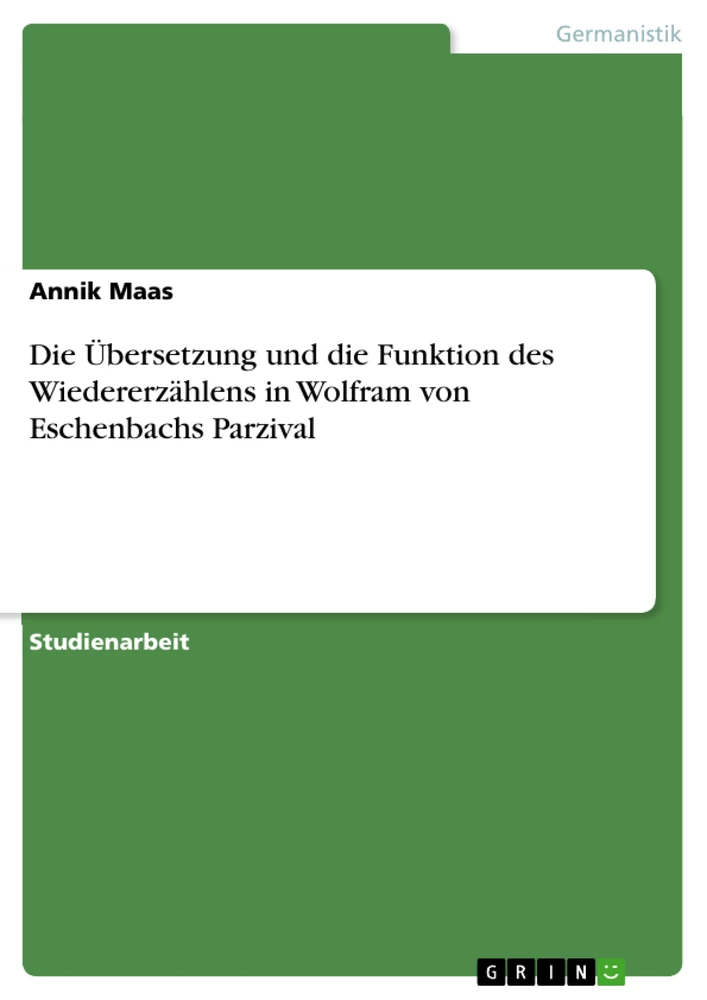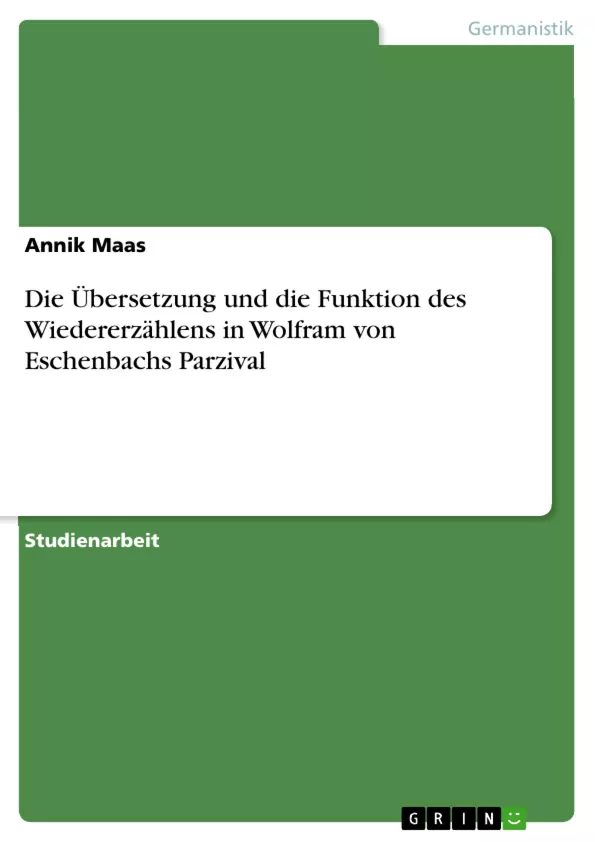Das Wiedererzählen ist eine Methode, die im Mittelalter sehr oft genutzt wurde. Da das Wiedererzählen häufig von einer Sprache in eine andere stattfand, betont Worstbrock ,,Wiedererzählen ist kein Übersetzen“. Die Dichter orientierten sich an dem Publikum und dieses erwartete die ,,Überliefertheit des Erzählten“ . Als gelungene Dichtung bezeichnete man keine neue oder fiktionale, sondern jene, die aus einem bereits vorhandenen Text, der bearbeitet wurde, entstand. Heutzutage steht man eher kritisch zum Wiedererzählen und verurteilt dieses als Plagiat.
Die vorliegende Arbeit beginnt mit der möglichst wörtlichen Übersetzung einer Textpassage aus Wolfram von Eschenbachs Parzival. Dabei wird die Grammatik berücksichtigt, die sich konkret mit der Bestimmung der Kadenzen, der Adjektive, der Verben und der besonderen Verben beschäftigt. Anschließend folgt das eigentliche Thema, nämlich das Vergleichen zweier Textpassagen aus Wolfram von Eschenbachs Parzival und Chrétien de Troyes unvollendetem Werk Le Roman de Perceval ou Le conte du Graal.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung von Wolfram von Eschenbach, 'Parzival' V. 129,5-130,16
- Grammatik
- Die Kadenzen der Verse 129,19 (gehöret) und 130,6 (nöt)
- Die Wortformen (Numerus, Tempus, Modus) und die Klassenzugehörigkeit folgender Verben (Numerus, Tempus, Modus):
- was (129,10), huob (129,16), slief (130,5)
- Die besonderen Verben: tohte (129,13) und hete (129,8)
- Bestimmung der Adjektive höh (129,22), guot (129,23), snéwizem (130,11).
- 'Wiedererzählen': Vergleich Wolfram von Eschenbach die Verse und Chrétien de Troyes 'Perceval' die Verse 69-833
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Übersetzung und die Funktion des Wiedererzählens in Wolfram von Eschenbachs 'Parzival' im Vergleich zu Chrétien de Troyes' 'Perceval'. Die Arbeit untersucht, wie Wolfram von Eschenbach die Vorlage von Chrétien de Troyes verwendet, welche Änderungen er vornimmt und welche neuen Elemente er hinzufügt.
- Die Rolle der Übersetzung im Mittelalter
- Der Vergleich von Textpassagen aus 'Parzival' und 'Perceval'
- Die spezifischen Charakteristika des Wiedererzählens in Wolframs Werk
- Die Analyse der Sprache und der Grammatik in Wolframs 'Parzival'
- Die Bedeutung der Figuren und ihrer Beziehungen in beiden Romanen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und erläutert die Bedeutung des Wiedererzählens im Mittelalter. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze zum Wiedererzählen, die sich von der wörtlichen Übersetzung bis hin zur freien Adaption erstrecken. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie Wolfram von Eschenbach Chrétiens 'Perceval' verarbeitet und in welcher Weise er die Vorlage in seinen eigenen Roman integriert.
Das zweite Kapitel widmet sich einer wörtlichen Übersetzung einer Textpassage aus 'Parzival', wobei die grammatikalischen Besonderheiten des Mittelhochdeutschen analysiert werden. Die Analyse der Kadenzen, der Wortformen und der besonderen Verben bietet Einblicke in die sprachliche Struktur von Wolframs Werk.
Das dritte Kapitel vergleicht zwei Textpassagen aus 'Parzival' und 'Perceval'. Die Analyse der beiden Werke zeigt, wie Wolfram von Eschenbach die Vorlage von Chrétien de Troyes nutzt und gleichzeitig eigene Elemente hinzufügt. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in der Handlung, den Figuren und den Themen, die in beiden Romanen behandelt werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Wiedererzählen, die Übersetzung, Wolfram von Eschenbach, Chrétien de Troyes, 'Parzival', 'Perceval', die höfische Literatur, die Grammatik des Mittelhochdeutschen, Figurenvergleich, Handlungsvergleich, Themenvergleich und die Bedeutung der Quellen für die Interpretation der Werke.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutete "Wiedererzählen" im Mittelalter?
Wiedererzählen war eine gängige literarische Methode. Eine gelungene Dichtung galt damals nicht als neu erfunden, sondern als kunstvolle Bearbeitung eines bereits vorhandenen, autorisierten Stoffes.
Wie unterscheidet sich Wolframs 'Parzival' von Chrétiens 'Perceval'?
Wolfram von Eschenbach nutzt Chrétien de Troyes als Vorlage, erweitert die Handlung jedoch um eigene Motive, vertieft die Charaktere und fügt humoristische sowie philosophische Elemente hinzu.
Ist Wiedererzählen dasselbe wie Übersetzen?
Nein, wie Worstbrock betont, ist Wiedererzählen kein bloßes Übersetzen. Es ist eine produktive Transformation, die sich an den Erwartungen des jeweiligen Publikums orientiert.
Welche grammatikalischen Aspekte des Mittelhochdeutschen werden analysiert?
Die Arbeit untersucht spezifische Kadenzen, Wortformen von Verben (wie Numerus, Tempus, Modus) sowie die Bestimmung von Adjektiven in ausgewählten Textpassagen.
Galt Wiedererzählen im Mittelalter als Plagiat?
Im Gegensatz zu heute wurde das Wiedererzählen nicht als Plagiat verurteilt, sondern als Beweis für die Gelehrsamkeit und das Können eines Dichters geschätzt.
Welche Rolle spielt die Gralssage in beiden Werken?
Beide Werke behandeln die Suche nach dem Gral, wobei Wolfram die unvollendete Vorlage von Chrétien zu einem monumentalen Epos mit komplexer Symbolik ausbaut.
- Quote paper
- Annik Maas (Author), 2013, Die Übersetzung und die Funktion des Wiedererzählens in Wolfram von Eschenbachs Parzival, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/273932