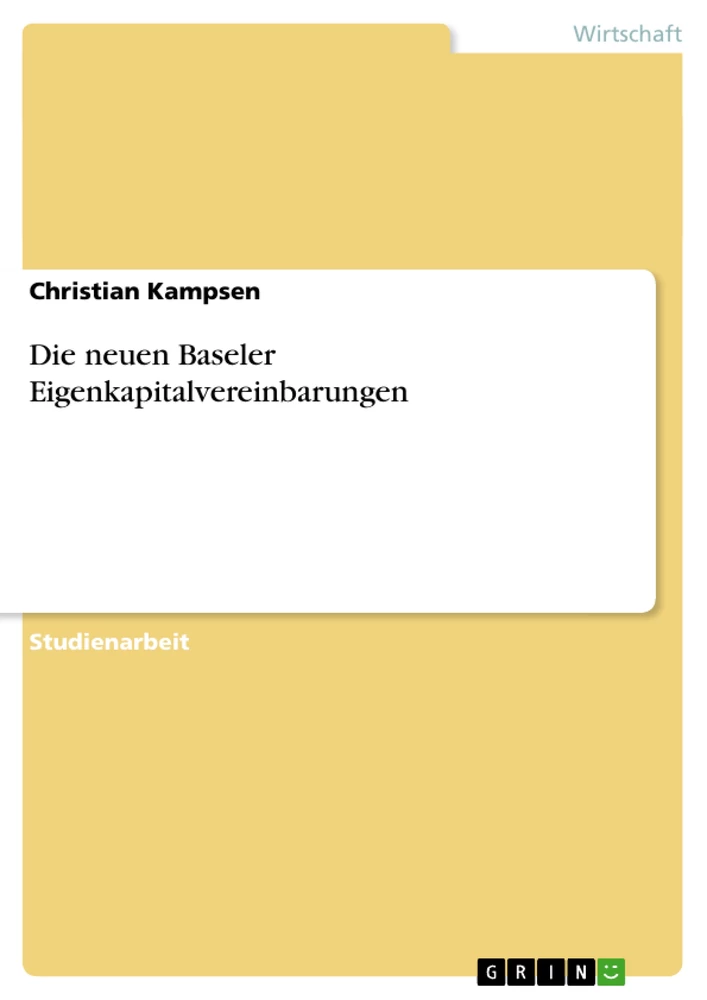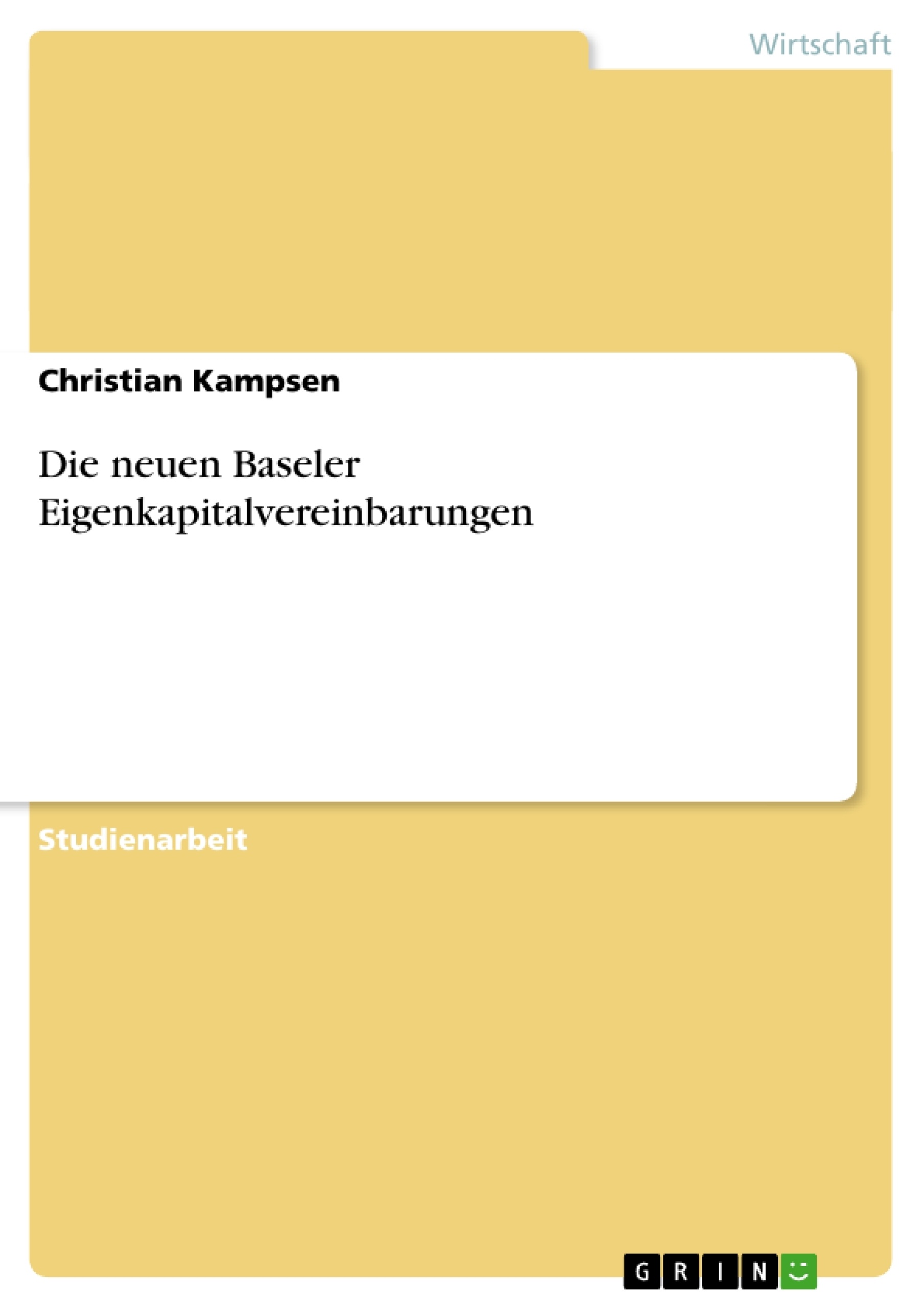Kreditinstitute haben in den modernen Volkswirtschaften einen sehr großen Stellenwert. Sie sind
vor allem ein elementarer Faktor für eine Vielzahl von Wirtschaftsprozessen. Deshalb ist es
wichtig, dass das Banksystem Sicherheit, Solidität und Effizienz auszeichnet. Allerdings könnten
Banken aufgrund von Konkurrenz und Verdrängungskampf geneigt sein, ihr Eigenkapital
abzusenken um Opportunitätskosten zu umgehen. Eigenkapital wird aber benötigt, um Verluste
zu kompensieren, die durch mit dem Bankgeschäft einhergehenden Risiken entstehen können.
Dies war Anstoss für die Veröffentlichung der Basler Eigenkapitalvereinbarung im Juli 1988
(Basel I), die Einleger schützen und Stabilität des Finanzsystems gewährleisten sollte. Basel I
trat 1992 in Kraft und ist seitdem die aktuell geltende Regelung für das Mindesteigenkapital, das
eine Bank zur Absicherung ihrer Risiken halten muss. Seither haben sich vor allem durch technischen Fortschritt das Bankgeschäft, das
Risikomanagement und die Finanzmärkte grundlegend verändert. So wurde im Januar 1999 das
erste Konsultationspapier zur Neufassung der Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) veröffentlicht,
um die Eigenkapitalvereinbarung von 1988 durch eine risikogerechtere Regelung zu ersetzen1.
Zu diesem Konsultationspapier gingen Stellungnahmen und Vorschläge aus dem gesamten
Bankgewerbe ein, die im Januar 2001 im zweiten Konsultationspapier zu Basel II konkretisiert
wurden. Auf diesem basiert auch diese Arbeit, die ein Einblick in die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung
sein soll. Leider konnten die Neuerungen des dritten Konsultationspapiers,
das kürzlich im Mai 2003 erschien, nicht mehr berücksichtigt werden. Die grundlegenden
Aspekte von Basel II, die diese Arbeit erläutert, blieben aber unverändert. Der weitere zeitliche
Ablauf sieht vor, dass die Veröffentlichung der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung im
Herbst 2003 stattfindet. Ende 2006 soll schließlich mit dem Inkrafttreten von Basel II die noch
gültige Regelung von 1988 ersetzt werden. Konkrete Änderungen im Vergleich zu Basel I sind, dass die Eigenkapitalunterlegung sehr viel individueller aufgrund von mehreren wählbaren Ansätzen ermittelt werden kann. Außerdem
fokussiert sich Basel II nicht nur auf eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Banken,
sondern es werden auch Anreize geschaffen, interne Risikosteuerungssysteme zu verbessern. [...]
1 Vgl. Sekretariat des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (2001), S. 1.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE ERSTE SÄULE - MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN
- BERECHNUNG DER MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN
- KREDITRISIKO
- Der Standardansatz
- Der IRB-Ansatz
- OPERATIONELLES RISIKO
- MARKTRISIKO
- DIE ZWEITE SÄULE - AUFSICHTLICHES ÜBERPRÜFUNGSVERFAHREN
- DIE DRITTE SÄULE - MARKTDISZIPLIN
- KRITISCHE ANMERKUNGEN ZU DEN BERÜCKSICHTIGTEN RISIKOFORMEN
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Basler Eigenkapitalvereinbarungen, die als Grundlage für die Regulierung der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten dienen. Das Ziel ist es, die wichtigsten Aspekte der neuen Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) zu erläutern und die Unterschiede zu den bestehenden Regelungen von Basel I aufzuzeigen.
- Die drei Säulen von Basel II: Mindestkapitalanforderungen, aufsichtliches Überprüfungsverfahren und Marktdisziplin
- Die verschiedenen Ansätze zur Berechnung der Mindestkapitalanforderungen
- Die Regulierung von Kreditrisiko, operationellem Risiko und Marktrisiko
- Die Auswirkungen der neuen Eigenkapitalvereinbarung auf das Bankgeschäft und die Finanzmärkte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Basler Eigenkapitalvereinbarungen ein und erläutert den Hintergrund der neuen Regelung. Anschließend werden die einzelnen Säulen von Basel II, die sich gegenseitig verstärken und zu erhöhter Sicherheit und Solidität im Finanzsystem beitragen sollen, detailliert vorgestellt.
Im ersten Kapitel wird die erste Säule - Mindestkapitalanforderungen - genauer erläutert. Dabei wird die Berechnung der Mindestkapitalanforderungen anhand der risikogewichteten Aktiva dargestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Messung des Kreditrisikos, das als das bedeutendste Risiko für Banken gilt. Die beiden Ansätze zur Berechnung des Kreditrisikos, der Standardansatz und der IRB-Ansatz, werden im Detail vorgestellt.
Die zweite Säule - Aufsichtliches Überprüfungsverfahren - befasst sich mit der Rolle der Bankaufsichtsinstanzen bei der Überprüfung der internen Risikosteuerungssysteme der Banken. Die dritte Säule - Marktdisziplin - behandelt den Einfluss der Marktkräfte auf die Eigenkapitalausstattung von Banken.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Basler Eigenkapitalvereinbarung, Basel II, Mindestkapitalanforderungen, Kreditrisiko, operationelles Risiko, Marktrisiko, Aufsichtliches Überprüfungsverfahren, Marktdisziplin, Risikogewichtung, Standardansatz, IRB-Ansatz, interne Ratings.
- Arbeit zitieren
- Christian Kampsen (Autor:in), 2003, Die neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/27390