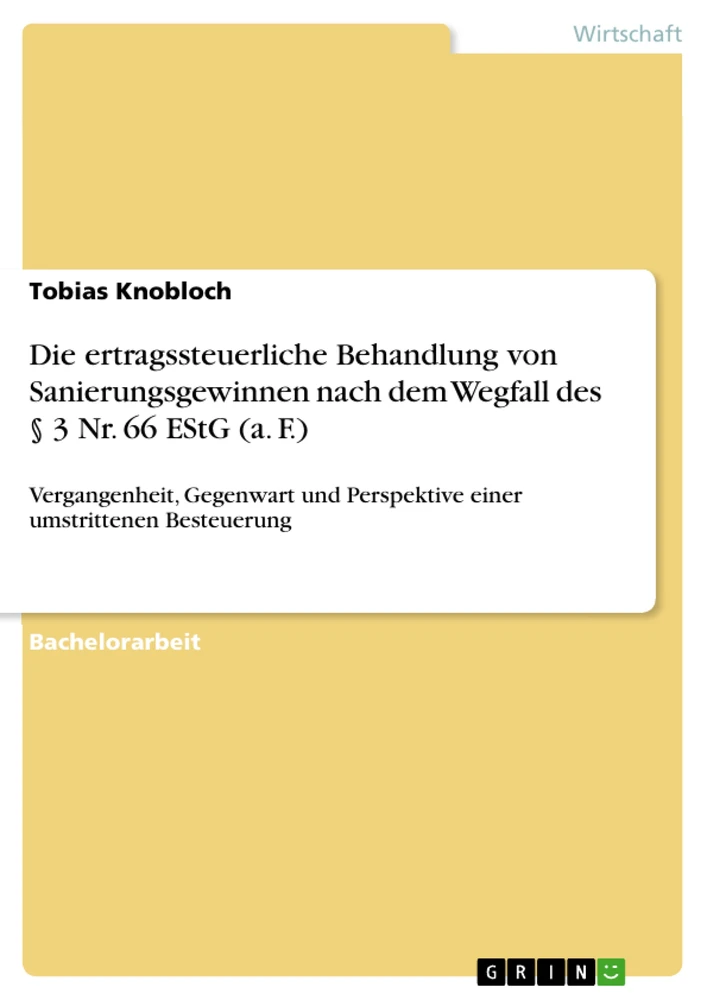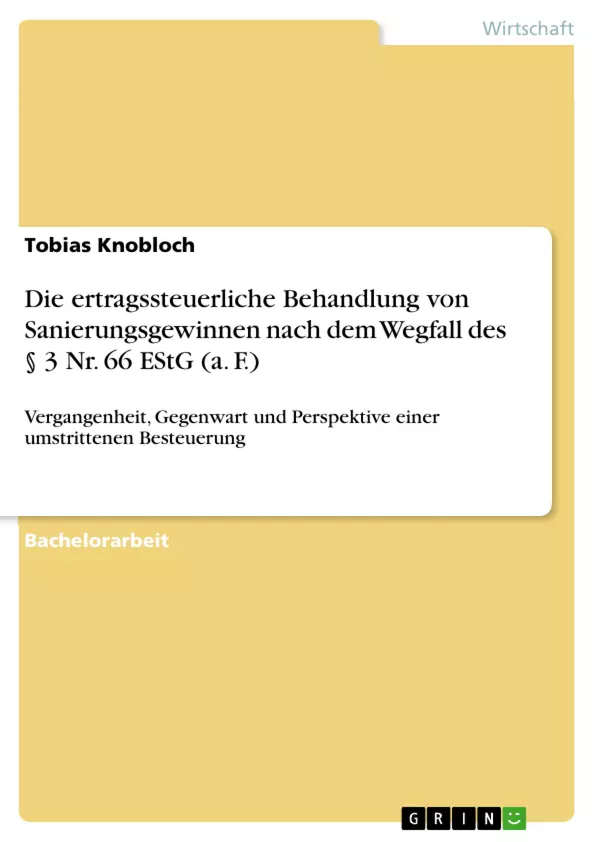Kaum ein Unternehmen wurde in seiner jahrzehntelangen Existenz nicht einmal mit einer Krise konfrontiert. Die Aufgabe von Unternehmensleitungen ist es, eine Solche rechtzeitig zu erkennen, um zu verhindern, dass die Existenz des Unternehmens vernichtet wird.
Die deutsche Volkswirtschaft erwies sich in der Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre vergleichsweise als robust und verzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der Unternehmensinsolvenzen um 2,1 Prozent. Dennoch wurden im Jahr 2012 bei deutschen Gerichten 29.500 betriebliche Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Ursachen für eine eintretende Krise sind vielfältig. Unternehmen sind zahlreichen externen Einflüssen wie etwa einem veränderten Finanzierungsverhalten von Banken, schnell wechselnden Marktbedingungen oder Zusatzbelastungen durch sich verändernde gesetzliche Rahmenbedingungen ausgesetzt. Dem gegenüber stehen zahlreiche interne Einflussfaktoren wie bspw. eine mangelnde Kompetenz der Geschäftsleitung, ein fehlender Innovationsgedanke sowie zu hohe Betriebsausgaben. Stehen in diesen Situationen keine Reserven zu Verfügung, entsteht sehr schnell ein hoher Verschuldungsgrad. Je zeitiger die Gefahren einer Krise erkannt werden, desto besser kann eine erfolgreiche Sanierung durchgeführt werden.
Das bis Ende 1998 angewandte Insolvenzrecht war gleichbedeutend mit einer Zerschlagung des Unternehmens. Da deren Konsequenzen ebenso tief in den privaten Bereich des Unternehmers reichten, galten Insolvenzanträge als unbedingt zu vermeiden. Diese negative Grundhaltung wurde durch die im Zuge des Gesetzes zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform neu eingeführte InsO grundlegend geändert. In Verbindung mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierungen von Unternehmen wurden viele Mängel beseitigt. Der Schwerpunkt des Gesetzes liegt vor allem auf einer größeren Einflussnahme der Gläubiger, sodass außergerichtliche Sanierungen gleichermaßen forciert werden können.
Besteht für das Unternehmen eine positive Fortführungsprognose, so können unter Erfüllung bestimmter Tatbestandsvoraussetzungen zwischen Gläubiger und Schuldner steuerlich begünstigte Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Neben leistungswirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Umstrukturierungen beinhalten diese oftmals finanzwirtschaftliche Maßnahmen, welche sich mindestens in Form eines teilweisen Forderungsverzichts der Gläubiger ausdrücken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Ziel
- 1.2 Historische Entwicklung der Sanierungsgewinnbesteuerung
- 2. Einordnung und Abgrenzung des Sanierungsgewinns
- 2.1 Begriff und Tatbestandsvoraussetzungen
- 2.1.1 Begriff der Sanierung
- 2.1.2 Sanierungsbedürftigkeit
- 2.1.3 Sanierungsfähigkeit
- 2.1.4 Sanierungsabsicht
- 2.1.5 Sanierungseignung
- 2.2 Entstehung und Bilanzierung von Sanierungsgewinnen
- 2.2.1 Sanierungsgewinn
- 2.2.2 Arten des Schulderlasses
- 2.2.2.1 Erlassvertrag
- 2.2.2.2 Negatives Schuldanerkenntnis
- 2.2.3 Bilanzierung
- 3. Ertragssteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen auf Basis des BMF-Schreibens vom 27. März 2003
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Verlustverrechnung und Ermittlung der Steuer
- 3.2.1 Natürliche Personen
- 3.2.2 Personengesellschaften
- 3.2.3 Kapitalgesellschaften
- 3.3 Freistellung von Sanierungsgewinnüberhängen durch Billigkeitsmaßnahmen
- 3.3.1 Inhalt und Anwendungsbereich
- 3.3.2 Unbilligkeit als zentrales Tatbestandsmerkmal
- 3.3.2.1 Sachliche Unbilligkeit
- 3.3.2.1.1 Theoretischer Ansatz
- 3.3.2.1.2 Übertragung auf die Besteuerung von Sanierungsgewinnen
- 3.3.2.2 Persönliche Unbilligkeit
- 3.3.2.2.1 Theoretischer Ansatz
- 3.3.2.2.2 Übertragung auf die Besteuerung von Sanierungsgewinnen
- 3.3.3 Stundung
- 3.3.4 Erlass
- 3.4 Sonderfall: Gewerbesteuer
- 4. Alternativvorschläge der steuerlichen Behandlung
- 4.1 Rückkehr zur Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns
- 4.2 Verteilung des Sanierungsgewinns auf mehrere Jahre
- 4.3 Besserungsscheine gegenüber dem Finanzamt
- 5. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der ertragssteuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen nach dem Wegfall des § 3 Nr. 66 EStG (a. F.). Sie untersucht die historische Entwicklung der Sanierungsgewinnbesteuerung, analysiert die rechtlichen Grundlagen und die verschiedenen Arten des Schulderlasses sowie die bilanzielle Behandlung von Sanierungsgewinnen. Darüber hinaus werden die steuerlichen Konsequenzen der Sanierungsgewinnbesteuerung für natürliche Personen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften beleuchtet.
- Historische Entwicklung der Sanierungsgewinnbesteuerung
- Begriff und Tatbestandsvoraussetzungen des Sanierungsgewinns
- Bilanzierung und steuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen
- Alternativvorschläge zur steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen
- Relevanz der Sanierungsgewinnbesteuerung für verschiedene Unternehmenstypen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und das Ziel der Arbeit dar. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Sanierungsgewinnbesteuerung und zeigt die Relevanz des Themas auf. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Einordnung und Abgrenzung des Sanierungsgewinns. Es definiert den Begriff der Sanierung und erklärt die Tatbestandsvoraussetzungen für die Entstehung eines Sanierungsgewinns. Kapitel 3 behandelt die ertragssteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen auf Basis des BMF-Schreibens vom 27. März 2003. Es beleuchtet die Verlustverrechnung und die Ermittlung der Steuer für verschiedene Unternehmenstypen. Kapitel 4 präsentiert verschiedene Alternativvorschläge zur steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen, wie die Rückkehr zur Steuerfreiheit oder die Verteilung des Gewinns auf mehrere Jahre.
Schlüsselwörter
Sanierungsgewinn, Steuerrecht, Ertragssteuer, § 3 Nr. 66 EStG, BMF-Schreiben, Verlustverrechnung, Schulderlass, Bilanzierung, Steuerliche Behandlung, Alternativvorschläge, Steuerfreiheit, Unternehmenstypen, natürliche Personen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften.
- Quote paper
- Tobias Knobloch (Author), 2013, Die ertragssteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen nach dem Wegfall des § 3 Nr. 66 EStG (a. F.), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/273897