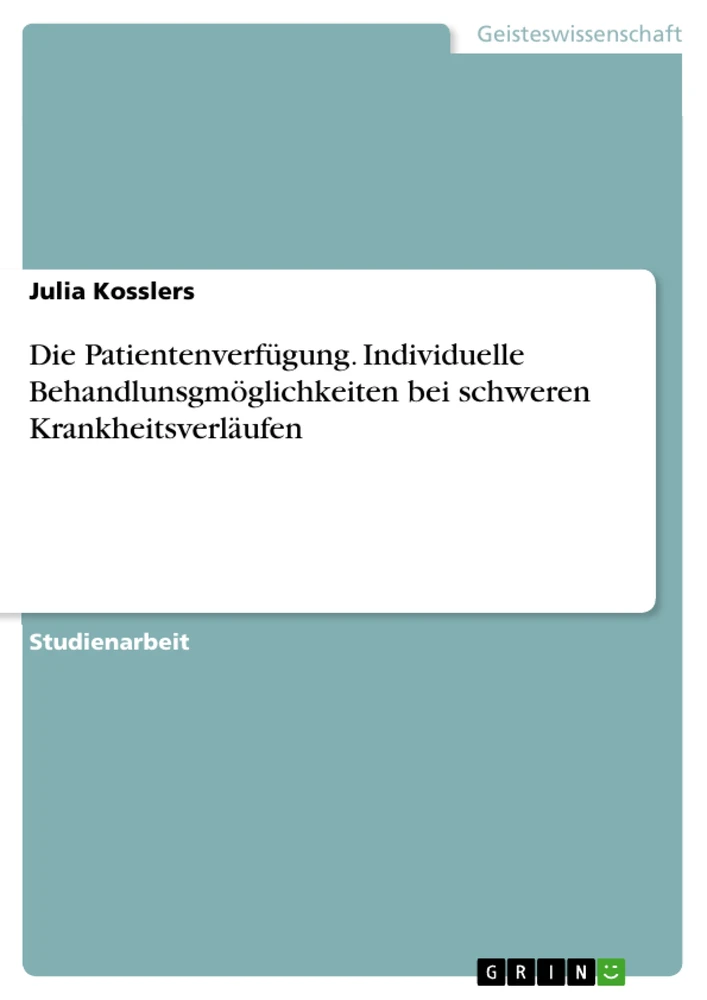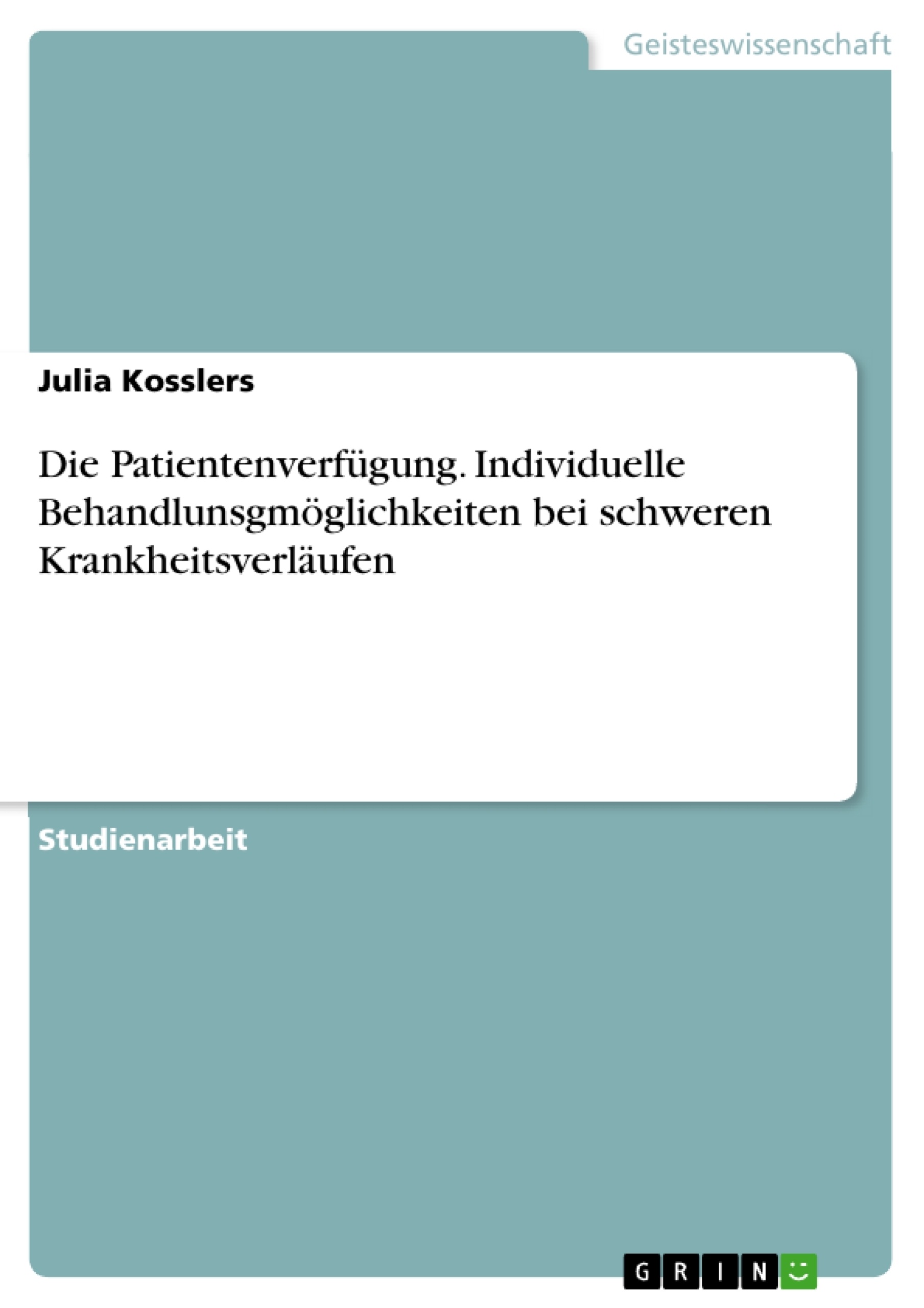Sowohl der Umgang mit Krankheiten, als auch ihre medizinische Behandlung sind sehr persönliche Themen, die mit individuellen Ängsten, Wünschen und Vorstellungen einhergehen. Auch die Haltung in Bezug auf Tod und damit verbunden der Prozess des Sterbens sind geprägt von unterschiedlichsten Ansichten über medizinische Eingriffe sowie ein würdevolles Lebensende. Entsprechend stimmen die Wünsche und Hoffnungen der Patienten/innen nicht immer mit denen der Angehörigen, der Ärzte/innen oder dem geltenden Recht und somit dem Norm- und Werteverständnis der Gesellschaft überein.
Mit den neuen Möglichkeiten der modernen Medizin des 20. Jahrhunderts haben sich sowohl neue Behandlungsmöglichkeiten, als auch neue Fragestellungen bezüglich Leben und Tod, Recht und Ethik ergeben. Zwar können heutzutage mit Hilfe der Intensivmedizin zuvor tödlich verlaufende Krankheiten vielfach geheilt oder zumindest gelindert werden, doch besteht auch die Gefahr, dass der Sterbeprozess durch lebenserhaltende Maßnahmen verlängert und so ein würdevoller Tod hinausgezögert wird.
Mit Hilfe der Patientenverfügung (im Folgenden PV abgekürzt) sollen die individuellen Wünsche der Patienten/innen über ihre medizinische Behandlung im Falle der krankheitsbedingten Äußerungs- und Entscheidungsunfähigkeit im Rahmen des geltenden Rechts berücksichtigt werden können. Des Weiteren soll den persönlichen Wünschen und Vorstellungen über das eigene würdevolle Sterben ein rechtlich verbindlicher Ausdruck und Rahmen verliehen werden.
Im Verlauf einer mehrjährigen, öffentlich und politisch geführten Auseinandersetzung sind unterschiedliche Positionen bezüglich Würde, Selbstbestimmung und Fürsorge in medizinischen Behandlungsfragen dargestellt worden. Es wurden verschiedene Arbeitsgruppen und Kommissionen gegründet, die zum Teil konträre Ansichten und Empfehlungen in die Diskussion eingebracht haben. Zudem wurde das Thema in den Medien auch von der breiten Öffentlichkeit diskutiert.
Im Folgenden wird zunächst die vorangegangene politische und ethische Debatte dargestellt. Um das Ausmaß dieser Arbeit nicht zu sprengen, werden die wichtigsten Meinungen nur kurz vorgestellt werden können. Anschließend wird auf die Gesetzesgrundlage, die drei Gesetzentwürfe sowie die seit dem 01.09.2009 geltenden Gesetzesänderungen eingegangen. Daraufhin werden Hoffnungen bzw. Ängste zur Sprache gebracht, die mit der Patientenverfügung einhergehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politische und ethische Debatte um die Patientenverfügung (PV)
- Arbeitsgruppe "Patientenautonomie am Lebensende"
- Bundesärztekammer (BÄK)
- Deutsche Hospizstiftung (DHS)
- Enquete-Kommission
- Nationaler Ethikrat (NER)
- Vertreter der Kirchen
- Diskussion in den Medien
- Rechtliche Grundlagen in Deutschland
- Gesetzentwürfe
- Patientenverfügungsgesetz/Patientenverfügung (PV)
- Vorsorgevollmacht
- Betreuungsvollmacht
- Hoffnungen und Ängste unmittelbar Beteiligter
- Patienten/Patientinnen
- Ärzte/Ärztinnen
- Angehörige
- Konfliktpotential
- Kritik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Patientenverfügung (PV) als Instrument der individuellen Selbstbestimmung am Lebensende. Sie beleuchtet die politische und ethische Debatte um die PV und untersucht die rechtlichen Grundlagen in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die PV tatsächlich die Wünsche und Vorstellungen der Patienten über ihre medizinische Behandlung im Falle der Entscheidungsunfähigkeit berücksichtigt und einen würdevollen Tod ermöglichen kann.
- Politische und ethische Dimensionen der Patientenverfügung
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Patientenverfügung in Deutschland
- Individuelle Perspektiven auf die Patientenverfügung
- Konfliktpotenzial und kritische Stimmen zur Patientenverfügung
- Bewertung der Wirksamkeit und Rechtssicherheit der Patientenverfügung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert die Thematik der Patientenverfügung im Kontext des Umgangs mit Krankheit, Tod und medizinischen Behandlungen im 20. Jahrhundert. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts von Patienten und die Notwendigkeit einer rechtlichen Grundlage für ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen über das Sterben.
- Kapitel 1 beleuchtet die politische und ethische Debatte um die Patientenverfügung. Es werden die Positionen verschiedener Arbeitsgruppen, Kommissionen und Vertreter der Kirchen dargestellt. Die Diskussion um die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen im Kontext des Selbstbestimmungsrechts, der paternalistischen Arzt-Patientenbeziehung und des Informed Consent wird beleuchtet.
- Kapitel 2 geht auf die rechtlichen Grundlagen der Patientenverfügung in Deutschland ein. Es werden die verschiedenen Gesetzentwürfe und Gesetzesänderungen im Kontext der Vorsorge- und Betreuungsvollmachten sowie die Diskussion um die Reichweite und Verbindlichkeit von Patientenverfügungen behandelt.
- Kapitel 3 erörtert die Hoffnungen und Ängste, die mit der Patientenverfügung verbunden sind. Es werden die Perspektiven von Patienten, Ärzten und Angehörigen beleuchtet. Zudem wird das Konfliktpotenzial zwischen den verschiedenen Interessen und die Kritik an der Gesetzeslage erläutert.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit konzentriert sich auf die Themen Patientenverfügung, Selbstbestimmung, Sterbebegleitung, medizinische Behandlung, Recht und Ethik, Patientenrechte, Lebensverlängerung, würdevolles Sterben, informed Consent, Betreuungsrecht und Konfliktpotenzial.
- Quote paper
- Julia Kosslers (Author), 2010, Die Patientenverfügung. Individuelle Behandlunsgmöglichkeiten bei schweren Krankheitsverläufen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/273093