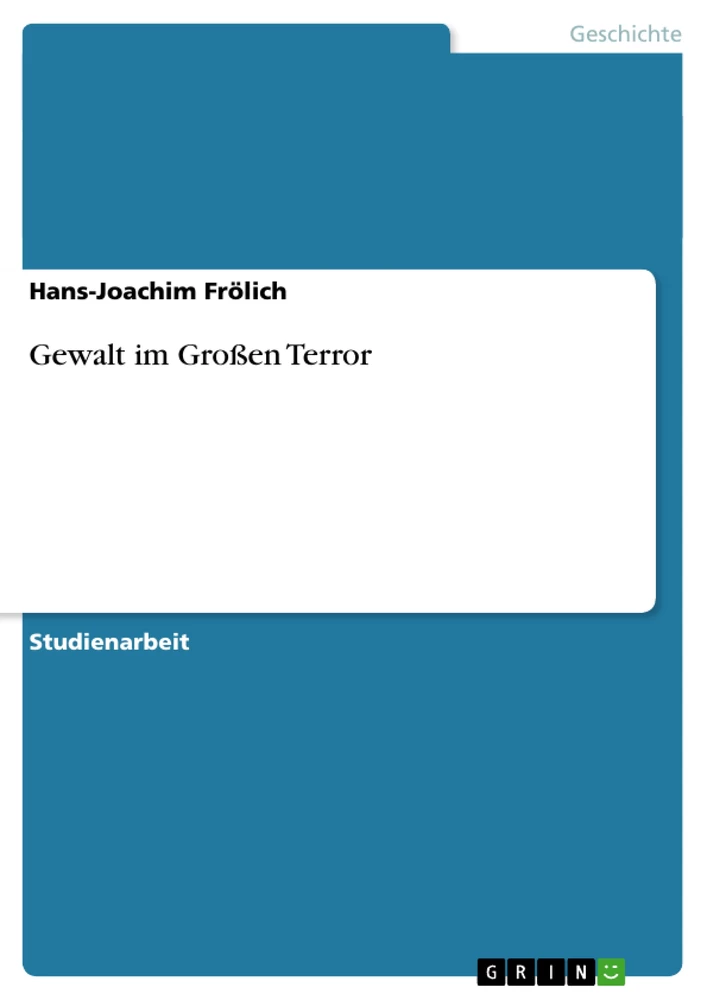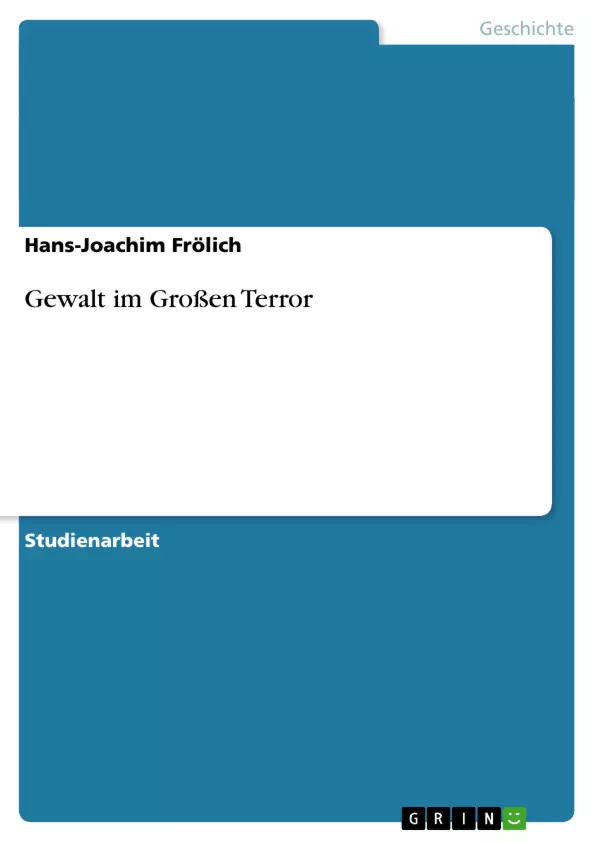Wer zum ersten Mal in die Literatur zum Großen Terror in der Sowjetunion 1937/38 hineinliest, mag sich wundern. Die großen Fragen nämlich, die zu erwarten wären, etwa: „Was habe ich mir unter dem Terror vorzustellen?” und dann: „Wie war der Terror möglich?” - diese Fragen geraten häufig aus dem Blickfeld. Stattdessen ist viel vom „Terror von oben” und solchem „von unten” die Rede, davon also, wie groß oder klein der Anteil Stalins am Terror war, ob dieser zentral geplant wurde oder die Menschen spontan übereinander herfielen.
Diese Fragen tragen sicherlich zum Verständnis des Terrors bei. Aber sie tragen eben nur dazu bei und können allein nicht den Schlüssel zum Verständnis liefern. Ohnehin ist klar, dass es diesen einen Schlüssel, diese eine Ursache des stalinistischen Terrors, nicht gegeben hat. Dennoch vereinfachende Erklärungen präsentieren zu wollen, bleibt eine verständliche Versuchung angesichts der Komplexität des Gegenstandes.
Die zentrale Frage aber bleibt, wie bereits erwähnt: „Wie war der Terror möglich?” Der Weg zu einer Antwort führt über die zweite Frage, die wir oben schon gestellt haben, nämlich: „Wie sah der Terror im Alltag aus?” Als Gegengewicht zu den abstrakteren Fragen politischer Entscheidungen ist diese Frage unerlässlich, bewahrt sie doch vor der Gefahr, angesichts der gewaltigen Dimensionen die Waffen des Historikers zu strecken - vielleicht gäbe es schon mehr Untersuchungen zum Alltag des Terrors, hätte er in kleinerem Maßstab stattgefunden.
Die Beschäftigung mit der Gewalt, die die Menschen im Terror auf lokaler Ebene einander antaten, bewahrt außerdem davor, sich die abstraktere Sicht der Moskauer Führung zu eigen zu machen, die die Opfer wenn nicht ausschließlich, so doch überwiegend in Form von Erschießungslisten und Volksfeind-Kontingenten der einzelnen Republiken wahrnahm. Die Frage nach der konkreten Gewalt macht dann auch, so hat Stefan Plaggenborg betont, den eingangs erwähnten Streit um Terror „von oben” oder „von unten” müßig. Ohne Anstachelung oder zumindest Legitimierung von oben kann die Gewalt unten nicht solche Ausmaße annehmen. Und ohne die grundsätzliche Bereitschaft unten, Gewalt auszuüben, können die Impulse von oben keine Wirkung zeigen. Stalin radikalisierte die Auseinandersetzung. Aber der Ursprung der Gewalt war er nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Gewalt im Großen Terror
- Wie war der Terror möglich?
- Wie sah der Terror im Alltag aus?
- Die Opfergruppen im Stalinismus
- Die Täter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay zielt darauf ab, die alltägliche Dimension des Großen Terrors in der Sowjetunion zu beleuchten und so zu einem tieferen Verständnis der Frage beizutragen, wie dieser Terror überhaupt möglich war.
- Die Frage nach der konkreten Gewalt im Alltag
- Die Rolle von „oben” und „unten” bei der Ausübung von Gewalt
- Die Verrohungsthese und die Gewöhnung an Gewalt
- Die Opfergruppen des Terrors
- Die Rolle der Täter und die Ursachen ihrer Handlungsweise
Zusammenfassung der Kapitel
- Gewalt im Großen Terror: Dieser Abschnitt beleuchtet die Schwierigkeit, die Frage nach der Möglichkeit des Terrors zu beantworten. Die Fokussierung auf Stalins Rolle wird als unzureichend betrachtet, da der Terror ein komplexes Phänomen ist, das nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen ist.
- Wie war der Terror möglich?: Die Bedeutung des Alltags im Terror wird hervorgehoben. Die Beschäftigung mit dem konkreten Vorgehen auf lokaler Ebene soll helfen, den Terror nicht nur abstrakt zu betrachten.
- Wie sah der Terror im Alltag aus?: Der Text stellt die Frage nach der Wahrnehmung des Terrors in der Bevölkerung in den Mittelpunkt und zeigt auf, dass der Terror nicht nur die Eliten, sondern auch die breiten Volksschichten betraf.
- Die Opfergruppen im Stalinismus: Der Essay analysiert die Opfergruppen des Terrors und zeigt, dass gewöhnliche Menschen zwar weniger häufig Opfer des „Großen Terrors” wurden, aber der Terror für viele keine völlig neue Erfahrung war. Der Terror wurde als Fortsetzung der kontinuierlichen Gewaltanwendung seit 1917 angesehen.
Schlüsselwörter
Der Essay befasst sich mit den zentralen Themen des Großen Terrors in der Sowjetunion, darunter die Gewalterfahrung im Alltag, die Rolle von „oben” und „unten” in der Gewalt, die Verrohungsthese, die Opfergruppen, die Täter des Terrors und die Ursachen ihrer Handlungsweise. Weitere wichtige Begriffe sind „sozial schädliche Elemente”, Kulaken, „Feinde des Volkes” und die bolschewistische Tradition der Herrschaft durch Gewalt.
- Arbeit zitieren
- Hans-Joachim Frölich (Autor:in), 2003, Gewalt im Großen Terror, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/27286