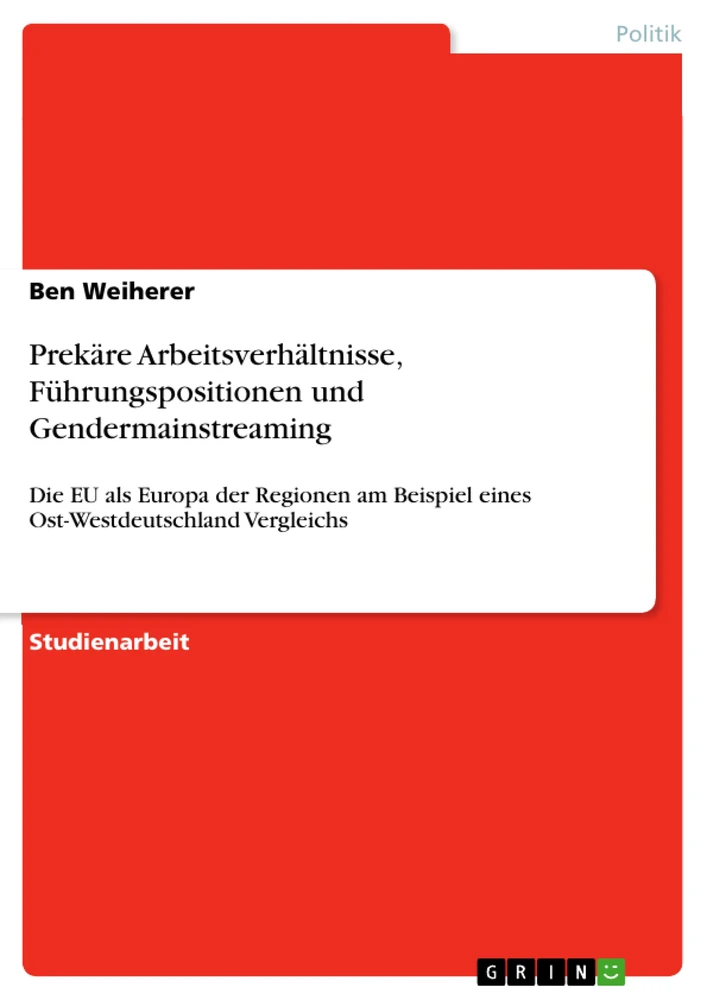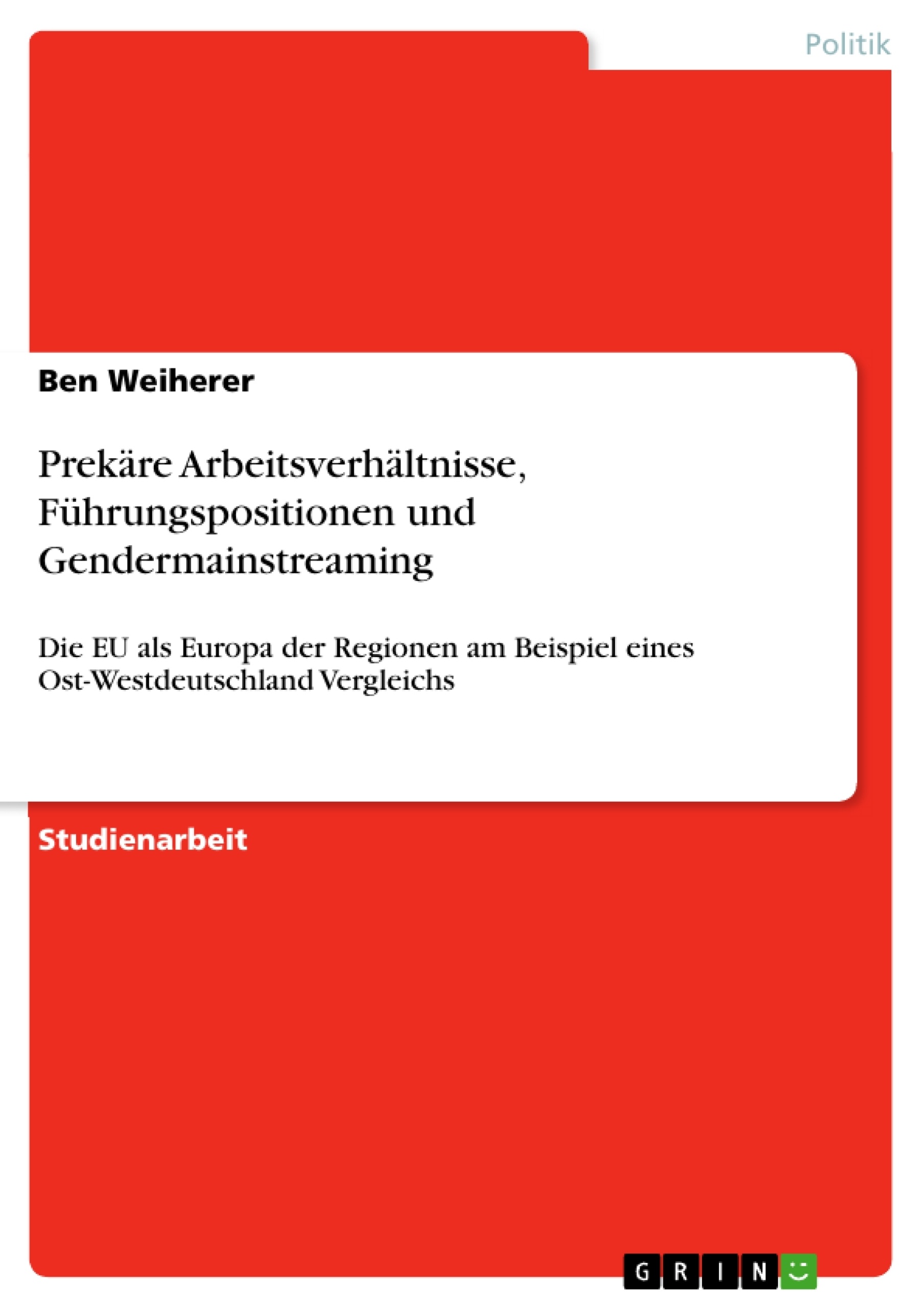Einleitung
„Wir sind im Augenblick, was Frauen in den Führungspositionen angeht, auf Höhe mit Indien, hinter Russland, hinter Brasilien, hinter China.“ Dieses Zitat der Bundesminis-terin für Arbeit und Soziales Ursula von der Leyen soll verdeutlichen, dass unterande-rem Deutschland ein weitreichendes Problem hat, bei der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Bezug auf Arbeit und in diesem speziellen Fall bei der Besetzung von Frauen in Führungspositionen.
Das Schlagwort, welches im Zuge der Debatte häufig schnell und als „Allzweckwaffe“ benutzt wird, ist die sogenannte Frauenquote. Um die vorherrschende Ungerechtigkeit bei der Entlohnung, sozialer und finanzieller Sicherheit zwischen Männern und Frauen, sowie die geschlechterdifferente berufliche Segregation zu beheben, reicht die einfache Forderung der Frauenquote nicht aus. Um diese Diskriminierung aufzuheben, ist es existentiell, sich nicht mit den Symptomen der Ungerechtigkeit zu beschäftigen, sondern ein besonderes Augenmerk auf die gesellschaftlichen Bedingungen (also die tatsächlichen Auslöser) zu legen.
Im Verlauf dieser Arbeit, werden nun einige Aspekte genannt, wie diese Ungerechtig-keiten zu Stande kommen. In erster Linie sollen hier die möglichen Auslöser innerhalb einer Gesellschaft herausgearbeitet werden, welche zu einem Ungleichgewicht in Bezug auf die Chancen für Frauen in Führungspositionen führen. Außerdem wird auf die vor-herrschenden Unterschiede hinsichtlich finanzieller und sozialer Sicherheiten zwischen Frauen und Männer eingegangen.
Zwei Aspekte, die einen gravierenden Einfluss auf den Weg hin zu einer beruflichen Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern beitragen, werden im folgenden Abschnitt 2 „Prekäre Arbeitsbedingungen und Qualifikation“ detaillierter beschrieben. Die prekären Arbeitsverhältnisse sollen im Zuge der Arbeit ein weiteres Ungleichge-wicht zwischen Frauen und Männern aufdecken. Dabei wird insbesondere aufgezeigt, wie dieses Ungleichgewicht zu Stande kommt und welche Folgen dies für Frauen haben kann. Darauf aufbauend wird ein Vergleich zwischen ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern dargestellt, und aufgezeigt wo deren Unterschiede in Bezug auf Frauen in Führungspositionen liegen. Vorangestellt wird dem, ein theoretischer Vergleich der gängigen Familien- und Rollenverteilungen in der BRD und der ehemaligen DDR, die möglicherweise als Indikator für einen Ost-West Unterschied dienen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Prekäre Arbeitsverhältnisse
- Familienmodell - Vergleich BRD und ehem. DDR
- Das Drei-Phasen-Modell in Bezug auf Berufliche Qualifizierung
- Die EU als Mehrebenensystem
- Gendermainstreaming
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Problem der Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in Bezug auf Arbeit, insbesondere hinsichtlich Führungspositionen. Sie analysiert die Ursachen dieser Ungleichheit, wobei der Fokus auf gesellschaftliche Bedingungen und prekären Arbeitsverhältnissen liegt. Die Arbeit betrachtet den Einfluss der Familienmodelle in der BRD und der ehemaligen DDR auf die berufliche Gleichstellung, untersucht die Herausforderungen der Europäischen Union in diesem Kontext und analysiert das Prinzip des Gendermainstreaming als möglicher Lösungsansatz.
- Prekäre Arbeitsverhältnisse als Faktor für die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern
- Der Einfluss von Familienmodellen auf die berufliche Gleichstellung
- Die Herausforderungen der Europäischen Union in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Männern
- Das Prinzip des Gendermainstreaming als möglicher Lösungsansatz
- Die Bedeutung von Führungspositionen für die Gleichstellung von Frauen und Männern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der geringen Anzahl von Frauen in Führungspositionen dar und erläutert die Notwendigkeit, die Ursachen der Ungleichheit zwischen Frauen und Männern im Arbeitsleben zu analysieren.
- Prekäre Arbeitsverhältnisse: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung von prekären Arbeitsverhältnissen für die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern. Es werden die Folgen dieser Arbeitsverhältnisse für Frauen beleuchtet und die Ursachen für die Konzentration von Frauen in solchen Arbeitsverhältnissen analysiert.
- Familienmodell - Vergleich BRD und ehem. DDR: Dieses Kapitel untersucht die Unterschiede in den Familienmodellen der BRD und der ehemaligen DDR und analysiert deren Einfluss auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern.
- Das Drei-Phasen-Modell in Bezug auf Berufliche Qualifizierung: Dieses Kapitel beschreibt das Drei-Phasen-Modell der weiblichen und männlichen Lebensführung in der BRD und analysiert dessen Auswirkungen auf die berufliche Qualifizierung von Frauen und Männern.
- Die EU als Mehrebenensystem: Dieses Kapitel betrachtet die Europäische Union als Mehrebenensystem und analysiert die Herausforderungen für die Gleichstellung von Frauen und Männern in diesem Kontext.
- Gendermainstreaming: Dieses Kapitel stellt das Prinzip des Gendermainstreaming vor und diskutiert dessen Potenzial zur Reduzierung von Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen im Berufsleben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen prekäre Arbeitsverhältnisse, Gendermainstreaming, Familienmodelle, Führungspositionen, berufliche Gleichstellung, EU als Mehrebenensystem und den Vergleich zwischen BRD und ehem. DDR. Sie untersucht den Einfluss dieser Themen auf die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern im Arbeitsleben und analysiert die Möglichkeiten der Gleichstellung von Frauen und Männern in Führungspositionen.
- Arbeit zitieren
- B.A. Ben Weiherer (Autor:in), 2013, Prekäre Arbeitsverhältnisse, Führungspositionen und Gendermainstreaming, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/271861