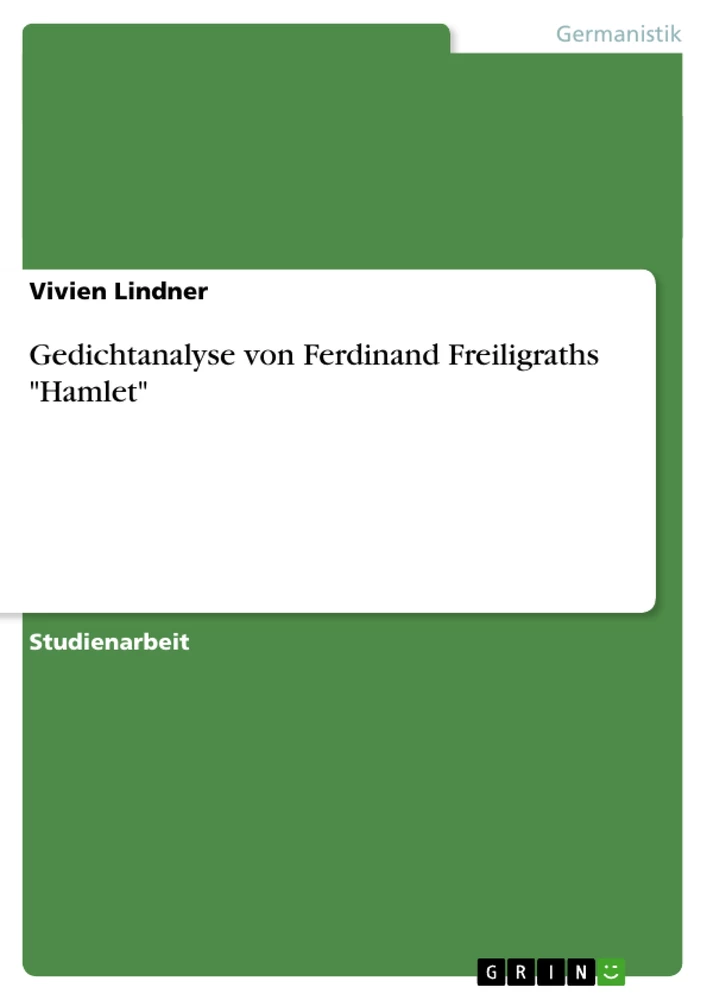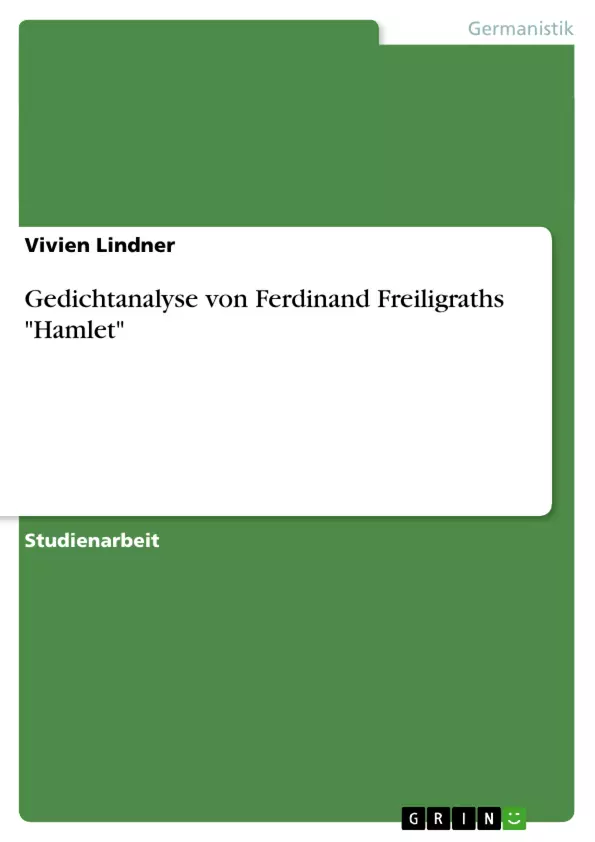Ferdinand Freiligrath überträgt in seinem Gedicht „Hamlet“ aus dem Jahr 1844 die politische
Situation des zerrütteten Deutschlands auf Shakespeares Held Hamlet, dessen Schicksal beispielhaft
für das Geschehen in Deutschland vorgeführt wird. Hamlets Charakter wird von dem
lyrischen Ich mit einem gesamten Land und seinem Volk gleichgesetzt, um anhand der mannigfaltigen
Parallelen auch eine Schlussfolgerung auf das drohende Schicksal zu ziehen, und
als einzig mögliche Konsequenz zur Revolution aufzurufen. Ferdinand Freiligrath als Vertreter
der Vormärz-Dichtung politisiert und instrumentalisiert die Lyrik: Dichtung besitzt für ihn
und seine Zeitgenossen Sinn und Ziel, welche mit größtmöglicher Wirkung hervorgebracht
werden sollen, was zahlreiche Stilmittel und die teils pathetisch, teils provokative Wortwahl
verdeutlichen. [...]
Ferdinand Freiligrath überträgt in seinem Gedicht „Hamlet“ aus dem Jahr 1844 die politische Situation des zerrütteten Deutschlands auf Shakespeares Held Hamlet, dessen Schicksal beispielhaft für das Geschehen in Deutschland vorgeführt wird. Hamlets Charakter wird von dem lyrischen Ich mit einem gesamten Land und seinem Volk gleichgesetzt, um anhand der mannigfaltigen Parallelen auch eine Schlussfolgerung auf das drohende Schicksal zu ziehen, und als einzig mögliche Konsequenz zur Revolution aufzurufen. Ferdinand Freiligrath als Vertreter der Vormärz-Dichtung politisiert und instrumentalisiert die Lyrik: Dichtung besitzt für ihn und seine Zeitgenossen Sinn und Ziel, welche mit größtmöglicher Wirkung hervorgebracht werden sollen, was zahlreiche Stilmittel und die teils pathetisch, teils provokative Wortwahl verdeutlichen.
Das neunstrophige Gedicht steht in einem vierhebigen Jambus, welcher den drängenden, fortschreitenden Charakter der Vormärzliteratur zur Geltung bringt. Die acht Verse jeder Strophe ordnen sich in zwei Kreuzreime, auch hier herrscht bei den Kadenzen eine strikte Regelmäßigkeit. So besteht der erste Reim stets aus männlichen Kadenzen, im zweiten Reim folgen die Versenden dem Reimschema: m-w-m-w.
Das zentrale handelnde Subjekt ist Hamlet, die Personifikation Deutschlands, genauer gesagt des deutschen Volkes. Hamlet verkörpert mit seinen Eigenschaften und fiktiven Taten den Prototyp des Deutschen zur Zeit des Vormärz, sein Schicksal wird mit dem Deutschlands gleichgesetzt. Das stilisierte Bild des Deutschen als Dichter und Denker wird in seinem Werden und Sein parallel der Geschichte Hamlets erläutert, jedes Geschehen in Shakespeares Drama findet ein entsprechendes Beispiel in der deutschen Wirklichkeit. So spricht das lyrische Ich, welches sich später zu erkennen gibt, schon in der einleitenden Apostrophe des ersten Verses aus, was mit jeder weiteren Strophe weiter erläutert wird: „Deutschland ist Hamlet!“ (V. 1).
Hamlet als Personifikation selbst, folgend meist mit „er“ benannt, ist ebenso ein Sinnbild des deutschen Studenten, was an der örtlichen Zuordnung klar erkennbar ist: „Er stak zu lang in Wittenberg, Im Hörsaal oder in den Schenken“ (V. 23/24). Seine herausragenden Eigenschaften sind vor allem Unentschlossenheit („Er sinnt und träumt und weiß nicht Rat“ V. 13), durch einen Parallelismus hervorgehobene Feigheit („Zu einer frischen, mutgen Tat fehlt ihm die frische, mutge Seele!“ V. 16) und Reflektion ohne Konsequenzen: „Sein bestes Tun ist eben Denken“(V. 22). Aus Hamlets persönlichem Zwiespalt zwischen Wort und Tat, Vision und Realität wird ein nationales Problem, welches Philosophie und Durchsetzung der Revolution einander gegenüberstellt, und sich dabei aufpeitschender Bilder bedient. Kennzeichnend ist hierbei die in jeder Strophe mehrmals vorkommende Apostrophe: Ausrufe als provokative Feststellung („Und streckt ihn selbst zu Boden nur!“ V. 44) oder Aufforderung: „Sei mir ein Rächer, zieh dein Schwert!“ (V. 7). Die drängende, bewegte Sprache wird unterstrichen durch zahlreiche Alliterationen, welche die vermittelte Botschaft auch akustisch verstärken: „blank bewehrt“ (V. 5), „lag und las“ (V. 18), „Zaudrer, der noch zweifelt […] zieh dein Schwert!“ (V. 6/7). Zahlreiche Wortwiederholungen zählen die negativen Eigenschaften des Studenten auf: „Zu kurz von Atem und zu fett. Er spann zu viel...“ (V. 20-21). Eng aufeinander folgende Anaphern („Er lag […] Er wurde […] Er spann […] Er stak […]“ V. 18-23) und der Binnenreim („stellt sich toll, hält Monologe […] seinen Groll“ V. 26-28 ) nennen spöttisch die vielen kleinen, vom lyrischen Ich jedoch als unsinnig dargestellten Tätigkeiten, da sie keinerlei Ergebnis mit sich bringen: „Doch eine Tat? Behüte Gott!“ (V. 39).
[...]
- Arbeit zitieren
- Vivien Lindner (Autor:in), 2010, Gedichtanalyse von Ferdinand Freiligraths "Hamlet", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/269244