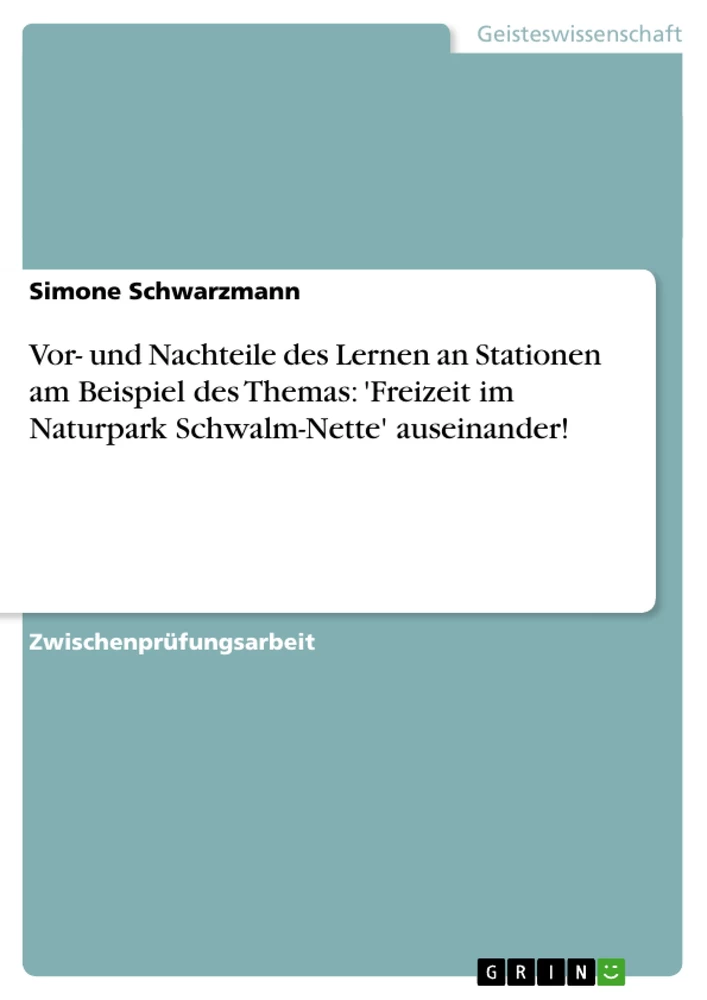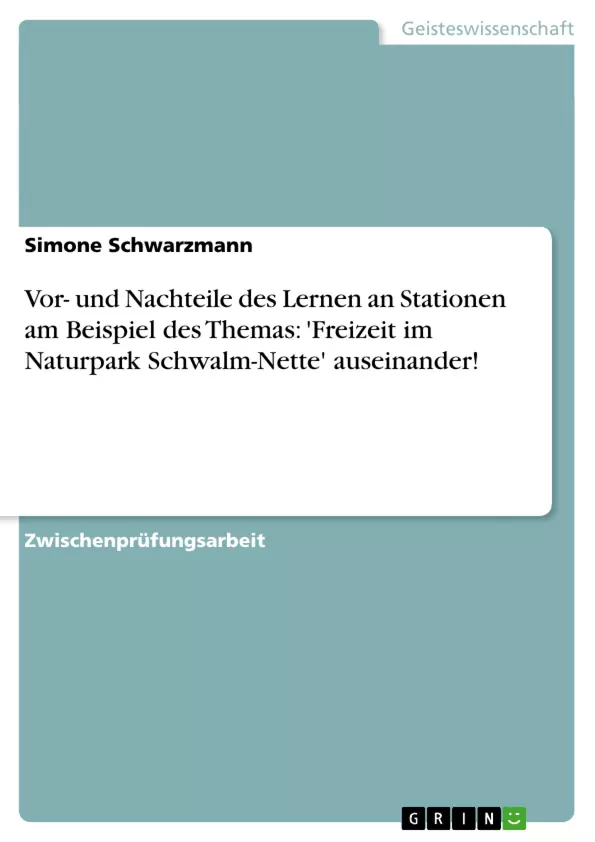Mittlerweile kann man überall beobachten, dass in vielen Berufen, aber auch in der Wirtschaft und der Verwaltung, die Verantwortung deutlich nach unten verlagert wird. 1 Jeder ist dann verantwortlich für sein Tun und es gibt keine direkte Weisung mehr von „oben“ zu jedem Arbeitsschritt. Im schulischen Bereich ermöglicht dies das Lernen an Stationen. Die Lehrer tragen weiterhin die Verantwortung für die zu lernenden Inhalte, wählen zu diesen auch die passenden Lernangebote aus und arbeiten sie auf, damit sie von den Schülern bearbeitet werden können. Die Lernenden und „Arbeiter“, in diesem Fall die Kinder, sind jedoch mehr verantwortlich für die Art und Weise der Aneignung dieser Inhalte und Lernangebote und auch der Vertiefung dieser, als im traditionellen Unterricht. Die Schüler erreichen so eine für die Zukunft wichtige und notwendige Befähigung, sie müssen selbst das Lernen lernen. Lernen wird somit als ein Teil des Arbeitsprozesses verstanden. Der alltägliche Unterricht, in der uns geläufigen lehrerorientierten Form, ist leider durch Konflikte und Probleme geprägt, die sowohl Schüler und Lehrer, als auch die Eltern belasten. Durch Leistungsdruck und ständige Zeitnot wird der traditionelle Unterricht von vielen Lehrern überwiegend frontal ausgelegt, so dass den Schülern viel und schnell etwas beigebracht wird. Dabei entstehen jedoch von Seiten der Kinder vielfältig Widerstände und Misserfolge.
Man kann allerdings Unterricht auch derart gestalten, dass sich die Schüler mit dem zu lernenden Thema aktiv und selbständig auseinandersetzen und ihn dadurch lernen. (vgl. Bauer, S. 24) Der Lehrer wird in diesem Bereich hauptsächlich zum Begleiter des Lern- und Arbeitsvorgangs, aber auch zum Arrangeur und Regisseur. Diese Vorgehensweise des Lernens bietet der Entwurf des „Lernen an Stationen“. Während sonst das Privileg des Handelns auf der Seite des Lehrers liegt und die Schüler die Rolle des Zuhörens und Reagierens hatten, kann die Unterrichtsform „Lernen an Stationen“ dieses Verhältnis zumindest stark verändern, wenn nicht sogar umkehren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Pädagogischer Hintergrund des Stationenlernens und der Unterrichtsform des Stationenlernens
- 2.1 Zur Klärung der Ausgangslage
- 2.2 Entwicklung und Entstehung des „Lernen an Stationen“
- 2.3 Beschreibung der didaktischen Struktur
- 2.4 Die Organisation des Stationenlernens
- 2.5 Die veränderte Lehrerrolle
- 2.6 Die Benotung
- 2.7 Vor- und Nachteile der Unterrichtsform
- 2.8 Der Ablauf der Unterrichtsphasen
- 3. Informationen über den Naturpark Schwalm-Nette
- 3.1 Was ist ein Naturpark?
- 3.2 Der Naturpark Maas-Schwalm-Nette
- 3.2.1 Die Landschaft
- 3.2.2 Die Lage und Größe des Parks
- 3.2.3 Die Entstehung und Geschichte
- 3.2.4 Die Seen, Wälder, Pflanzen und Tiere
- 3.3 Freizeitmöglichkeiten und was sonst noch zum Naturpark Maas-Schwalm-Nette gehört
- 4. Ein möglicher Stationenaufbau zu diesem Thema
- 5. Fazit und Schlussformel (-gedanke)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Unterrichtsform des Stationenlernens und dessen Einsatz im Kontext des Themas "Freizeit im Naturpark Schwalm-Nette". Ziel ist es, die Vor- und Nachteile dieser Unterrichtsform im Vergleich zum traditionellen Unterricht aufzuzeigen und eine mögliche Stationenstruktur für einen konkreten Unterrichtseinsatz zu entwickeln.
- Pädagogischer Hintergrund des Stationenlernens
- Struktur und Organisation des Stationenlernens
- Freizeitmöglichkeiten im Naturpark Schwalm-Nette
- Entwicklung eines konkreten Stationenaufbaus
- Reflexion der Vor- und Nachteile des Stationenlernens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Entwicklung und Verbreitung des Stationenlernens als eine Antwort auf die veränderte Lernsituation in der heutigen Zeit. Dabei werden die Vorteile des Stationenlernens für Schüler und Lehrer hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel wird der pädagogische Hintergrund des Stationenlernens ausführlich betrachtet. Hier werden die Entstehung, die Organisation und die didaktische Struktur dieser Unterrichtsform erläutert.
Im dritten Kapitel werden Informationen über den Naturpark Schwalm-Nette gegeben. Die Landschaft, Lage, Entstehung und die Freizeitmöglichkeiten des Parks werden näher beschrieben.
Das vierte Kapitel stellt einen möglichen Stationenaufbau zum Thema „Freizeit im Naturpark Schwalm-Nette" vor, der in der dritten oder vierten Klasse durchgeführt werden könnte. Dieser Abschnitt zeigt konkret, wie das Stationenlernen in der Praxis umgesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Stationenlernen, offene Unterrichtsform, Naturpark Schwalm-Nette, Freizeitmöglichkeiten, didaktische Struktur, Organisation, Lernphasen, Vor- und Nachteile, Schülermotivation, Selbstständigkeit, Lernen lernen.
- Quote paper
- Simone Schwarzmann (Author), 2004, Vor- und Nachteile des Lernen an Stationen am Beispiel des Themas: 'Freizeit im Naturpark Schwalm-Nette' auseinander!, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/26873