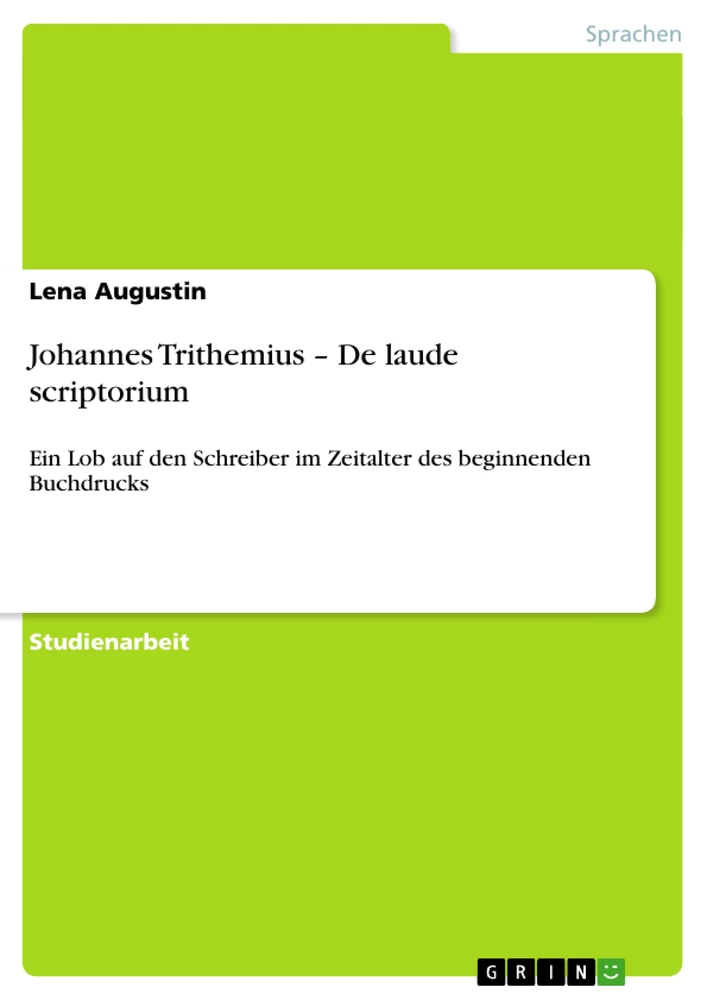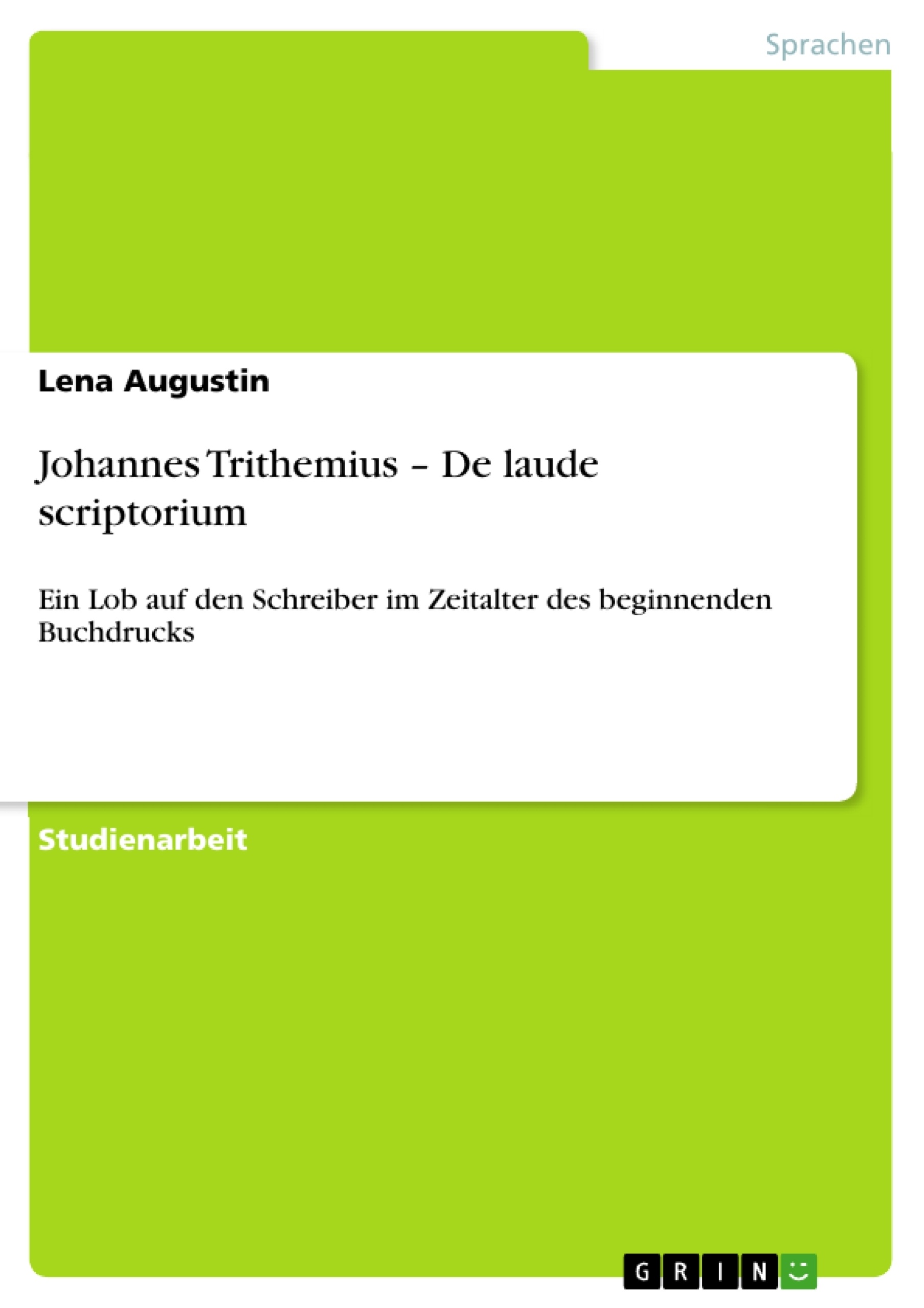Ein Namensvetter Gutenbergs, Johannes Trithemius, hinterließ uns sein Buch „De laude scriptorium“, zu Deutsch „Zum Lobe der Schreiber“. Warum entstand „Zum Lobe der Schreiber“ gerade in der Zeit des fortschreitenden Buchdrucks? Seit der Erfindung des Handgießgerätes für bewegliche Lettern durch Gutenberg um 1450, verbreitete sich der Buchdruck mit großer Geschwindigkeit und die Buchproduktion stieg explosionsartig an. Trotzdem ließ Trithemius nicht von der Handschrift ab und verfasste sogar dieses Werk, um die Mönche seines Ordens erneut zum Schreiben zu motivieren. Doch warum, wo doch der Druck die Buchproduktion schneller, günstiger und effizienter machte? Stand ihm der Abt tatsächlich ablehnend gegenüber und wenn ja, aus welchen Gründen? Hielt er vielleicht nur aus Sentimentalität oder Fortschrittsangst am Bewährten fest? Oder
hatte er anders als seine Zeitgenossen einen großen Nachteil des Buchdrucks erkannt?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Leben und Werk des Johannes Trithemius
2.1.1 Trithemius und die Religion
2.1.2 Trithemius und die Bildung
2.1.3 Trithemius und die Bücher
2.1.4 Fazit zu Trithemius’ Leben und Werk
2.2 Trithemius’ Argumente für das Schreiben
2.2.1 Längere Haltbarkeit von Pergament im Vergleich zu Papier
2.2.2 Größere Sorgfalt
2.2.3 Nutzen für den Schreiber
2.2.4 Angemessene Beschäftigung für einen Mönch
2.2.5 Vorbild der Alten
2.2.6 Fazit zu Trithemius’ Argumenten für das Schreiben
2.3 Über das Werk „De laude Scriptorium“
2.3.1 Die Situation des Buchdrucks um 1492
2.3.2 Auftrag
2.3.3 Druck
2.3.4 Überlieferte Fassungen
2.3.5 Andere Aussagen des Trithemius zum Buchdruck
3. Schluss
3.1 Zusammenfassende Bewertung
3.2 Gültigkeit außerhalb des Klosters
3.3 Gesamtfazit
1. Einleitung
Der Buchdruck ist das letzte und zugleich größte Geschenk. Durch den Buchdruck nämlich sollte nach Gottes Willen der ganzen Erde die Sache der wahren Religion im Vergehen der Welt bekannt und in alle Sprachen ausgegossen werden. Es ist gewiß die letzte, unauslöschliche Flamme der Welt.1
Diese Ansicht Martin Luthers von 1532 wurde nicht zu allen Zeiten von jedem geteilt. Vor allem die Zeitgenossen Johannes Gutenbergs waren sich in der Be- wertung seiner Erfindung noch nicht einig. Ein Namensvetter Gutenbergs, Jo- hannes Trithemius, hinterließ uns mit seinem Buch „De laude scriptorium“, zu Deutsch „Zum Lobe der Schreiber“, eine weitaus kritischere Meinung.
Über den Abt Johannes Trithemius finden sich zahlreiche Ausführungen, die sich mit den verschiedenen Aspekten seines Lebens beschäftigen. Diese behan- deln beispielsweise neben Anklagen der Geschichtsfälschung und seinem angebli- chen Interesse für schwarze Magie, die uns hier nicht interessieren sollen, auch das oben genannte seiner verschiedenen Werke. Im speziellen die Frage: Warum entstand „Zum Lobe der Schreiber“ gerade in der Zeit des fortschreitenden Buchdrucks?
Diese Frage wurde in der älteren Forschung in einer eher simplifizierenden Art und Weise beantwortet, nämlich damit, dass der Autor den Buchdruck generell ablehnte. Diese Meinung vertraten unter anderem Hans Lülfing, Ferdinand Geld- ner und Michael Giesecke. Differenzierter beurteilt haben Hans Widmann, Paul Lehmann und Klaus Arnold, indem sie die direkte Kausalität zwischen Schreiber- lob und Ablehnung des Buchdrucks relativierten und Trithemius Aussagen er- schöpfender betrachteten. Das Werk von Noel L. Brann von 1981 hält sie für überwiegend an den benediktinischen Kreis gerichtet und spricht ihm eine allge- meine Gültigkeit ab.2
Seit der Erfindung des Handgießgerätes für bewegliche Lettern durch Guten- berg um 1450, verbreitete sich der Buchdruck mit großer Geschwindigkeit und die Buchproduktion stieg explosionsartig an. Trotzdem ließ Trithemius nicht von der Handschrift ab und verfasste sogar dieses Werk, um die Mönche seines Or- dens erneut zum Schreiben zu motivieren. Doch warum, wo doch der Druck die Buchproduktion schneller, günstiger und effizienter machte? Stand ihm der Abt tatsächlich ablehnend gegenüber und wenn ja, aus welchen Gründen? Hielt er vielleicht nur aus Sentimentalität oder Fortschrittsangst am Bewährten fest? Oder hatte er anders als seine Zeitgenossen einen großen Nachteil des Buchdrucks er- kannt?
2. Hauptteil
Um die Bedeutung des Werkes „De laude scriptorium“ umfassend bewerten zu können, sind über die Betrachtung des reinen Inhalts (2.2) hinaus zwei weitere Aspekte von Bedeutung. Zum einen müssen das Leben und Werk des Autors sowie seine Beweggründe (2.1) mit einbezogen werden. Zum anderen sind Details zum Werk als solches (2.3) von entscheidender Bedeutung.
2.1 Leben und Werk des Johannes Trithemius1
Sein Leben begann am 1. Februar 1462 in Trittenheim an der Mosel. Nach diesem Ort „hat er sich [seit spätestens 1486]2 in latinisierter Form zeitlebens benannt“.3 Er starb am 13. Dezember 1516, am Vorabend der Reformation, in Würzburg am Main.
Zeit seines Lebens wurde er durch die Auseinandersetzung mit den drei großen Themengebieten Religion, Bildung und Bücher beeinflusst. Darin erreichte er außerordentliche Erfolge und genoss großes gesellschaftliches Ansehen.
Für eine genauere Anlalyse seines Werkes „De laude scriptorium“ ist es daher von entscheidender Bedeutung diese drei Themengebiete Religion, Bildung und Bücher näher zu betrachten.
2.1.1 Trithemius und die Religion
Um die später dargestellten, in weiten Teilen religiös motivierten, Argumente des Trithemius nachvollziehen zu können, ist es notwendig Trithemius eigene Beziehung zur Religion zu verstehen.
Trithemius wurde schon in jungen Jahren Mönch. Noch vor seinem zwanzig- sten Geburtstag kam er, Schutz vor einem Unwetter suchend, in das Hunsrück- Kloster Sponheim, nahe Bad Kreuznach und fand „im Leben nach der Regel des heiligen Benedikt das Ideal seines irdischen Daseins“.4 Schon achtzehn Monate später, am 7. Juli 14835, wurde er zum Abt des Klosters gewählt. Daran lässt sich erkennen, dass er sehr strebsam und ehrgeizig gewesen sein muss. Seine Fröm- migkeit bringt er auch schriftlich zum Ausdruck: „In allem erkenne ich als wahr nur dasjenige, was die katholische Kirche genehmigt; alles übrige verachte ich als eitel Erdichtung und Aberglauben.“6
Er befolgte die Regeln des heiligen Benedikt und legte als Abt auch gegenüber seinen Untergebenen Strenge an den Tag. Die Mönche seines Klosters sahen sich nicht selten seiner Kritik ausgesetzt. Er verfasste ein Werk über „die Versuchun- gen, denen die Mönche ausgesetzt sind“7 und machte sich Sorgen über den, sei- ner Meinung nach stattfindenden Verfall des benediktinischen Ordenslebens. Diese Angst findet sich auch im vorliegenden Werk, das mit der Intention ver- fasst wurde, die Mönche vor Müßiggang zu warnen, indem man ihnen das Schreiben als heiliges Handwerk wieder näher brachte. Für seine Entwicklung ebenfalls sehr wichtig war die Reformkongregation von Bursfelde, der Sponheim seit 1470 angehörte. Auch hier zeigte Trithemius sehr viel Einsatz.1 Das Ideal der Reform war die reine und genaue Beachtung der Be- nediktinerregel und man sah das Veranstalten von Gottesdiensten als Hauptauf- gabe an. Ein Ziel war beispielsweise, jeden Mönch zur täglichen Meditation zu verpflichten.2
Neben seiner Frömmigkeit kann vor allem aus seiner Beziehung zur Religion eine gewisse Strenge und Konsequenz, Ordnungsliebe und Kritikfreude gegenüber den anderen Mönchen abgeleitet werden. In seiner Position als Abt prägte er den Orden auch in politischen Fragen.
2.1.2 Trithemius und die Bildung
Neben seiner starken Frömmigkeit und Strenge in Ordensfragen widmete sich Trithemius mit besonderer Vorliebe seinen Studien. „Stets habe ich alles, was in dieser Welt erfahrbar ist, zu wissen begehrt“.3 Die Grundlagen seiner Bildung erwarb er an der Universität Heidelberg. Einen Abschluss machte er jedoch nicht. Dennoch: „Er hat an den bedeutenden kulturellen Bewegungen und Erneuerun- gen seiner Zeit lebhaft teilgenommen. Er interessierte sich für alle Wissenschaf- ten.“4
In den ersten Jahren als Abt in Sponheim widmete er sich mit Vorliebe der Bibliothek und versuchte dort, den Mönchen jede Studienmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Bei diesem Vorhaben war er erfolgreich, denn dank seiner wurde das Kloster „zu einer »Akademie«, die Mönchen, bildungswilligen Laien der Umgebung und humanistischen Gelehrten […] eine Heimat bot.“5
Er selbst war von „staunenswerter Belesenheit und vollkommener Latinität“.6 Darüber hinaus verfolgte er das Ziel der Dreisprachigkeit. So lernte er neben dem Lateinischen auch das Griechische und das Hebräische. Auch hier zeigt sich er- neut seine bereits im Zusammenhang mit religiösen Fragen aufgegriffene Konse- quenz.
In Latein sind alle seine schriftlichen Äußerungen gehalten; dies wird so konsequent eingehalten, daß ein Brief an seine Mutter, der sich in der Briefsammlung des Sponheimers findet, nur in der Gelehrtensprache überliefert ist, die die Eltern sicher nicht beherrschten.7
Seine außerordentliche Liebe zur Bildung wird auch in „De laude scriptorium“ mehr als einmal deutlich. Etwa in Kapitel X „Welche Texte die Mönche schreiben sollen“. Er wollte den Mönchen nicht nur geistliche Bildung zukommen lassen. So ermutigt er den Leser nicht nur zum Studium der Heiligen Schrift, sondern auch zu weltlicher Lektüre und zum Anlegen von Heften, sogenannte Florilegien, in dem wichtige Notizen festgehalten werden sollen.1 Sein Ziel bestand also darin den Mönchen seine ausgeprägte Liebe zum Wissen näher zu bringen. Trotz der aus dieser Liebe heraus erzielten Erfolge hat diese ihn Zeit seines Lebens getrieben immer weiter zu lernen, zu reisen und selbst zu schreiben.
2.1.3 Trithemius und die Bücher
Einen hohen Stellenwert hatte für Trithemius immer das Medium, durch das er Bildung erlangen und an andere weitergeben konnte. „Das Schriftstudium ist dem Benediktiner, wie er immer wieder betont hat, Ziel jeglicher Bildung.“2 Dem widmete er sich, indem er viel Geld, Zeit und Mühe in den Aufbau der Sponhei- mer Klosterbibliothek investierte. Trithemius war ein außerordentlicher Bücher- liebhaber.
Auf seinen Reisen war es ihm deshalb immer ein großes Anliegen neue Hand- schriften und auch Drucke, auch zum Zwecke der Weiterbildung, zu erwerben und sie mit nach Hause zu bringen. Er folgte damit einer Reihe Humanisten, die durch „Abschreiben, Kaufen, Tauschen, selbst durch Entwenden“3 ihre Samm- lungen aufzuwerten versuchten. Er besaß ein sehr gutes Gedächtnis, und konnte Codices, die er einmal sah, auch nach Jahren noch genau beschreiben. Er erhöhte die Zahl der im Sponheimer Kloster enthaltenen Werke in seiner Amtszeit von 48 auf 2000. „Seine Bibliothek in Sponheim mit zweitausend Bänden war damals eine der größten und berühmtesten Sammlungen auf deutschem Gebiet.“4 „Wann immer er auf seinen Visitationsreisen eine Handschrift oder einen seltenen Druck sah oder von deren Existenz erfuhr, suchte er diese zu erwerben oder einzutau- schen.“5 Unter seiner Leitung wurden im Sponheimer Scriptorium auch zahlrei- che entliehene Werke von den Mönchen selbst abgeschrieben.
Nachdem er auf Grund von Auseinandersetzungen mit seinen Mönchen das Kloster in Sponheim verlassen musste, führte er in seinen letzten Lebensjahren in der Bibliothek des Schottenklosters St. Jakob in Würzburg das Sammeln von Bü- chern weiter. Diese kam jedoch in Größe und Bedeutung nie an die von Spon- heim heran.6
Trithemius beschränkte sich jedoch nicht nur auf das Kopieren und Sammeln von Vorhandenem, sondern er war auch selber eifriger Schriftsteller. Anfangs hauptsächlich als Mentor für seine Mönche tätig, hielt er bald darauf schon zahl- reiche Vorträge vor den versammelten deutschen Äbten, stand in Briefkontakt mit bedeutenden Persönlichkeiten, verfasste ein Schriftstellerverzeichnis, „eine große Zahl von Predigten, Regelkommentaren, monastischen Ermahnungen, Briefen, liturgischen Anleitungen, Heiligenbiographien und exegetischen Schriften“1 und zahlreiche andere, zum Beispiel auch historische Werke. „De laude scriptorium“ ist also nicht nur ein beiläufiger Text, sondern behan- delt ein Thema, das den Abt sein ganzes Leben lang begleitet und beschäftigt hat.
2.1.4 Fazit zu Trithemius’ Leben und Werk
Trithemius’ Liebe zu Religion, Bildung und Büchern, finden alle ihren Ausdruck in „De laude scriptorium“. Im Hinblick auf seine Beweisführung für die Vorteile des Schreibens ist es nötig, sich das ins Gedächtnis zu rufen, um zu entscheiden für wie allgemeingültig wir seine Äußerungen halten dürfen.
2.2 Trithemius’ Argumente für das Schreiben
Mit dieser Darstellung von Leben und Werk des Trithemius im Hinterkopf wer- den nachfolgend nun seine Argumente für das Schreiben vorgestellt. Direkt nach den einleitenden Worten in Form des Widmungsbriefes zu „De laude scriptorium“ findet sich ein Inhaltsverzeichnis mit allen Kapitelüberschrif-ten, das bereits einen guten Überblick über das Werk gibt. Es soll zu diesem Zweck auch hier aufgeführt werden. Da kein Autograph erhalten ist, finden sich im Folgenden Kopien aus dem mir vorliegenden der Mainfränkischen Hefte in der lateinischen Originalfassung (Abbildung 2.1) und der Übersetzung von Klaus Arnold (Abbildung 2.2).
An dieses Inhaltsverzeichnis anschließend folgen in 16 Kapiteln Trithemius' Argumente für das Schreiben, die nachfolgend zusammengefasst dargestellt wer- den.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.1 Lateinisches Inhaltsverzeichnis zu „De laude scriptorium“ aus Arnold 1973, S. 32.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.2 Deutsche Übersetzung des Inhaltsverzeichnisses von „De laude scriptorium“ aus Arnold 1973, S. 33.
2.2.1 Längere Haltbarkeit von Pergament im Vergleich zu Papier
Gleich im ersten Kapitel findet sich ein Verweis auf den Buchdruck und seine Nachteile: „Der Buchdruck nämlich hängt vom Papier ab und dieses wird in kurzer Zeit völlig zerstört. Der Schreiber jedoch, der seine Buchstaben dem Pergament anvertraut, sichert sich und dem, was er schreibt, langdauerndes Gedächtnis.“1 Auch in Kapitel sieben, das sich am ausführlichsten mit der Druckkunst auseinandersetzt, geht Trithemius darauf ein:
Wer wüßte nicht, welcher Unterschied zwischen Handschrift und Druck besteht? Die Schrift, wenn sie auf Pergament geschrieben wird, vermag tausend Jahre zu überdauern; wie lang wird aber der Druck, der ja vom Papier abhängt, Bestand haben? Wenn ein Papiercodex zweihundert Jahre überdauert, ist es viel; gleichwohl glauben viele, ihre Texte dem Druck anvertrauen zu müssen. Hierüber wird die Nachwelt befinden.2
Trithemius geht davon aus, dass nur auf Papier gedruckt wird, was in den meisten Fällen aber nicht ausschließlich der Fall war. Nur das Schreiben per Hand aber fände auf Pergament statt. Das Argument ist allerdings nicht völlig stichhaltig, „da man doch zu des Trithemius’ Zeit bereits überwiegend auf Papier, nicht auf Pergament abschrieb, und andererseits nicht bloß auf Papier, sondern - minde- stens in besonderen Fällen - auch auf Pergament gedruckt wurde.“3
Bereits im 14. Jahrhundert stieg die Nachfrage nach einem preiswerten Be- schreibstoff. Papier stand seit Mitte des 15. Jahrhunderts, also bereits bei Beginn des Buchdrucks, in Deutschland zum Drucken zur Verfügung.4 Gegenüber Per- gament hat es den Vorteil, dass es kein Kuppelprodukt mit Fleisch ist und schnel- ler mit weniger Aufwand in größeren Mengen produziert werden kann.
Wie aber steht es um seine Aussagen über die Haltbarkeit der beiden Be- schreibstoffe? „Das Papier des Mittelalters besteht bis zum Beginn des 19. Jh. aus Lumpen und Hadern“.5 Dieses Hadernpapier ist durchaus sehr alterungsbestän- dig. Erst ab 1850 stellte man reines Holzschliffpapier her, das heute durch Zerfall bedroht ist und mit Entsäuerungstechniken behandelt werden muss, um es vor der vollständigen Zerstörung zu bewahren. Pergament hat trotzdem den Vorteil der längeren Lebenszeit. Es war jedoch auch sehr teuer in der Herstellung und wurde aus diesem Grund häufig in Form von Palimpsesten wiederverwendet.
Es geht Trithemius also in erster Linie darum, dem Geschriebenen Dauer zu verleihen. Denn das für die Bildung so wichtige Wissen darf nicht verloren gehen. Deswegen ist es nötig, die vorhandenen Schriften immer wieder zu kopieren. Er geht sogar so weit zu sagen, es wäre für den Schreiber nötig „auch den gedruckten und nützlichen Büchern Dauer [zu] verleihen, indem er sie abschreibt, da sie ansonsten nicht lange Bestand hätten.“6
Nach Trithemius besteht eine Interdependenz zwischen Druck und Papier auf der einen, sowie zwischen Handschrift und Pergament auf der anderen Seite. Er argumentiert für letzteres Verfahren auf Grund der größeren Beständigkeit des zugehörigen Beschreibstoffes. Die unbedingte Gültigkeit dieser Interdependenz ist allerdings fraglich und für eine stichhaltige Argumentation nicht verwendbar. Denn Trithemius war ein weltkundiger Mann, es ist daher unwahrscheinlich, dass er die Möglichkeiten des Pergamentdrucks oder der Papierhandschrift nicht kann- te. Man könnte also daraus folgern, dass er sie absichtlich außer Acht gelassen hat, um die Mönche, denen ähnliche Erfahrungen fehlten, zu überzeugen, oder ein mögliches Gegenargument von Kritikern zu verhindern.
2.2.2 Größere Sorgfalt
Ausgehend davon, dass das für die Bildung wichtige Wissen erhalten bleiben müsse, ist jedoch nicht nur die Beschaffenheit des Beschreibstoffes von Bedeutung. Nach „De laude scriptorium“ trägt auch die Tatsache, dass auf die Herstellung handgeschriebenen Codices mehr Sorgfalt verwendet wurde, als auf Drucke, zur ihrer Überlegenheit bei. Dieser Sorgfalt widmet der Autor ebenfalls ein ganzes Kapitel (siehe Kapitel 8 Inhaltsverzeichnis), in dem er zur Rechtschreibung, der Art des Schreibens und dem Buchschmuck Anweisungen gibt, die beachtet werden müssen, um ein Buch wertvoll zu machen.
Er kritisiert damit den Buchdrucker und unterstellt ihm, dass er dem einzelnen Buch keine große Aufmerksamkeit mehr schenkt. „Auf eine Handschrift wird einfach mehr Fleiß verwandt.“1 Vielleicht macht sich der Autor Sorgen um die „Seele“ der Bücher und dass sie in Zukunft unpersönlich und industriell in Masse produziert würden. Diesem Argument ist wenig entgegenzusetzen. Natürlich ist ein handgeschriebener Codex durch die aufgewendete Arbeitszeit wertvoller als ein gedrucktes Buch, das in großer Auflage produziert und schließlich in allen häuslichen Regalen zu finden ist. Aber auch im Buchdruck kann man viel Sorgfalt auf die Gestaltung eines Buches verwenden. Das war zu Beginn des Buchdrucks, als zum Beispiel noch von Hand mit Farbe nachgearbeitet wurde, nicht anders als heute, da auf Grund der technischen Entwicklungen die typografischen Möglich- keiten keine Grenzen zu haben scheinen.2
Aus seiner eigenen regligiösen Motivation kann erklärt werden, dass er sich da- für aussprach besondere Sorgfalt auf die Heilige Schrift zu legen, da sonst das Wort Gottes und sein Wille verfälscht würden. Durch Gleichgültigkeit beim Ab- schreiben entstehen Fehler, die zu Schwierigkeiten im Textverständnis führen. Der Inhalt muss also durch gewissenhaftes Kopieren geschützt werden.3
Dem Thema widmet er sich noch ein weiteres Mal in Kapitel 15. Hier geht es jedoch um den Umgang mit den Büchern und nicht um die Herstellung. Durch unvorsichtiges Behandeln der Codices enthülle man sein Geringschätzen des In- halts.4
Für den ordnungsliebenden und strengen Bücherliebhaber Trithemius, war die Liebe und Sorgfalt, die auf ein Buch verwendet wurde ausschlaggebend. Diese Gründe sind also besonders relevant für den Bibliophilen, dem das Buch als Ge- genstand wichtig ist. Trithemius geht aber weiter und sorgt sich um den Inhalt der Bücher, der sorgsam kopiert werden muss, um nicht das Textverständnis zu gefährden. Der Autor stellt hier nicht nur Vergleiche zwischen Druck und Hand- schrift an, sondern gibt auch genaue Anweisungen für die Schreiber.
2.2.3 Nutzen für den Schreiber
Trithemius versucht den Leser nicht nur zu überzeugen, indem er die Vorteile des Schreibens gegenüber dem Buchdruck aufzeigt, sondern widmet sich in weiten Teilen von „De laude scriptorium“ dem Nutzen, der sich für den Schreiber ergibt. Es handelt sich damit um indirekte Gründe gegen den Buchdruck, da einem Buchdrucker dieser Nutzen verwehrt bliebe.
Lohn des ewigen Lebens
Die Vorteile des Schreibens gelten nicht nur für einen Autoren neuer Werke. Sondern auch und vor allem für den, der Altes abschreibt und ihm damit Dauer verleiht - das Wissen also für die Nachwelt konserviert. Durch das Schreiben und Kopieren von Werken lebt der Schreiber auch selber in ihnen weiter und gerät nach seinem Tod nicht in Vergessenheit, erlangt also gewissermaßen das ewige Leben.1 Trithemius wiederholt diesen Punkt an mehreren Stellen und schließt sein Werk sogar mit einer Art Gebet oder Fürbitte für den Schreiber. Er will deutlich machen, dass es auch nach dem Lebensende für den frommen Schreiber einen Lohn gibt.
Die Schriftstücke, die er anfertigt sind für den Mönch, der in seinem Leben keinen weltlichen Besitz anhäuft, eine Art von Erbe, das er der Nachwelt hinter- lassen kann.2 Der Mönch, der sich vor allem auf die Heilige Schrift und ihre Aus- legungen durch die Kirchenväter konzentrieren soll, vervielfältigt also wichtige religiöse Schriften. Er verkündet dadurch das Wort Gottes und tut damit etwas für sein Seelenheil.3 Darüber hinaus teilt Trithemius die im Mittelalter übliche Meinung, dass das Schreiben sowohl die seelische als auch die körperliche Ge- sundheit fördert. Er erwähnt diese Tatsache allerdings nur ein Mal und geht da- nach nicht weiter darauf ein.4
Zusammengefasst hat das Schreiben einen vierfachen Nutzen:
1) die Zeit wird sinnvoll genutzt, indem Werke für die Nachwelt geschaffen werden
2) der Geist wird durch das Studium der Heiligen Schrift erleuchtet
3) es wird ein Gefühl zu völliger Ergebung und Gehorsam entflammt
4) der Schreiber empfängt als Lohn nach dem Tod das ewige Leben5
Hilfe beim Studium
Trithemius beschränkt sich mit seiner Empfehlung jedoch nicht nur auf religiöse Werke, wie weiter vorne schon erläutert wurde, sondern hält auch weltliche Wis- senschaften für wichtig, die beim Verständnis der Bibel Hilfe geben können. Als besonders wichtige Beispiele nennt er Theologie, Musik, Jura und Zeitrechnungs- lehre.1 Er selber hielt es, wie bereits erwähnt, für elementar seine Studien in allen Bereichen voranzutreiben und legte dies auch den Lesern von „De laude scripto- rium“ ans Herz. Außer den Lehren der Häretiker sollte kein Fachgebiet aus der Bibliothek verbannt werden.2
Er spart nicht am Lob auf die Heilige Schrift, die direkt von Gott kommt und dadurch große Kraft besitzt. So soll sie dem Mönch zum Beispiel den inneren Frieden bringen, ist sogar notwendig, um wahres Seelenheil zu erlangen.3 Trithe- mius spielt hier auf eine Art der Erleuchtung an, die durch die Schriften der Bibel erreicht werden soll. Diese religiöse Argumentation ist völlig verständlich, wenn man bedenkt, dass sowohl Autor als auch Adressaten des Werkes im Dienst der katholischen Kirche standen.
Auf den zweiten Blick kann meiner Meinung nach gefolgert werden, dass diese religiös motivierten Argumente durchaus auch im weltlichen Bereich Anwendung finden können. Nach Trithemius ist das Abschreiben eine Hilfe oder eine Metho- de zum Studium der Heiligen Schrift. Der Schreiber beschäftigt sich intensiver mit seiner Vorlage, als dies für den Buchdrucker nötig ist. Wer ein Werk ab- schreibt, liest es erst und kopiert es dann. Es ist also eine Hilfe beim Memorieren und damit eine gute Methode des Studiums. „Denn was wir niederschreiben, prä- gen wir dem Geist stärker ein, weil wir uns zum Lesen und Schreiben Zeit neh- men müssen.“4 Obwohl Trithemius sich hauptsächlich auf die Mönche und ihre religiösen Schriften beschränkt, kann man diese Begründung auch auf weltliche Studien übertragen und damit formulieren, dass das handschriftliche Kopieren mit einer intensiven Beschäftigung mit dem Werk einhergeht.
2.2.4 Angemessene Beschäftigung für einen Mönch
Trithemius wiederholt immer wieder, dass das Schreiben für die Mönche eine angemessene Beschäftigung ist und führt dies mit Bezug auf verschiedene Aspek- te aus.
Schutz gegen Müßiggang
Das Schreiben ist eine „Zierde des mönchischen Lebens“ und ein „Heilmittel für schwache Seelen“.5 Trithemius meint damit, dass diese Art von Beschäftigung den Mönch vom Müßiggang abhält und ihn damit auf den „rechten Weg“ zu Frömmigkeit und Regeltreue zurückweist. „Denn Müßiggang ist der Feind der
Seele und der Faule stirbt über seinen Wünschen.“1 „Müßiggang ist aller Laster Anfang und das Ende aller Tugenden.“2 Er überfällt den unbeschäftigten Geist und befleckt ihn mit unreinen Gedanken. Um zum ewigen Leben zu gelangen gilt es ihm zu entfliehen.
Der Benediktinermönch ist zur Arbeit anzuhalten, was sich in folgendem Zitat von Benedikt zeigt: „Dies sind wahre Mönche, die von ihrer Hände Arbeit leben.“3 Wer nach den Regeln der katholischen Kirche ein rechtes Leben führen möchte, muss also arbeiten. Und hier empfiehlt Trithemius die Schreibtätigkeit als Handwerk, dass sich gut mit dem klösterlichen Leben vereinbaren lässt, da sie in den Zellen der Mönche durchführbar ist und zwischen den Gottesdiensten ohne viel Aufwand wieder aufgenommen werden kann.4
Ein großer Teil des Tages soll von den Benediktinermönchen zum Gebet und der mystischen Versenkung genutzt werden, was den Meisten sehr schwer fällt. Statt sich vergeblich anspruchsvolleren Tätigkeiten zu widmen, sollen sie sich also dem Schreiben zuwenden, da es als eine Art Meditation betrachtet wird.
Da die meisten Mönche, laut Trithemius, nicht in der Lage sind, sich dauerhaft im Gebet und der mystischen Versenkung zu halten, stellt das Schreiben damit eine Notwendigkeit für alle dar und muss deshalb auch von allen erlernt werden.5 Auch diesem Thema widmet Trithemius ein ganzes Kapitel (siehe Kapitel 9 In- haltsverzeichnis).
Und obwohl an Feiertagen den Mönchen Handarbeiten verboten sind, bildet auch hier das Schreiben eine Ausnahme. Es nimmt also einen wirklich hohen Stellenwert ein, wenn es sogar die Ordensregeln umgehen kann. Es ist eine Tätigkeit, die zu Gott führt und von diesem unterstützt wird.
Wichtigkeit der Schrift für die Kirche
Schon im ersten Kapitel führt Trithemius auf, wie wichtig Schrift im Allgemeinen ist. Alle Kenntnisse, die die Menschen erlangen, würden ohne die Schrift und den Schreiber vergehen. Sie ist notwendig für den Glauben, der ohne sie zu schwan- ken beginnen würde, und die Kirche. Diese braucht die Bücher als wichtigste Waffe gegen Irrgläubige.6
Sein Einsatz in der Ordenspolitik lässt es nicht überraschen, dass er auch die Wichtigkeit der Schrift und der Bücher für die Benediktiner erwähnt. Denn der Orden steigt und fällt mit dem Schreiben.7
2.2.5 Vorbild der Alten
Trithemius nennt dem Leser immer wieder Vorbilder, um ihm, wie er sagt, den Einstieg ins Schreiben zu erleichtern. In Kapitel 3 widmet er sich diesem Aspekt, indem er einen kurzen geschichtlichen Überblick gibt. Dabei beginnt er mit antiken Vorbildern, wie Plato und Aristoteles, geht aber bald zu christlichen Bücherliebhabern oder fleißigen Schreibern des eigenen Ordens über.
Er lobt den Eifer, mit dem jene Bücher verschiedener Völker sammelten und Übersetzungen anfertigen ließen.Schon seit langer Zeit investieren gebildete und christliche Vorbilder viel Mühe und Geld in Bücher. Der Autor versucht beim Leser durch die Nennung dieser Beispiele die Liebe zu den Büchern ebenfalls zu wecken.1
Auch im vierten Kapitel geht es erneut um Vorbilder, und genauer um die Sorgfalt, mit der sie Bücher abschrieben. Und auch an dieser Stelle nennt er viele Namen. An späterer Stelle rühmt er die einstigen Bibliotheken des Benediktinerordens2 und noch später einige gelehrte Mönche3.
Dem Fleiß dieser Vorbilder war es zu verdanken, dass zu seiner Zeit viele der Werke überhaupt erhalten waren. Diese wichtige Aufgabe sollte von der neuen Generation wieder aufgenommen und ebenso sorgfältig weitergeführt werden, um den folgenden Jahrgang keinem Nachteil zu unterwerfen. Er weist auch darauf hin, dass bestehende Werke bereits dem Altersverfall unterliegen und eine Gegenmaßnahme daher dringend erforderlich ist.4
Vorbilder an fleißigen Druckern gab es zu Trithemius Zeit noch nicht allzu viele, vor allem keine Mönche. „Bei aller Mahnung zu Reform und Umkehr blieb der Abt jedoch Anhänger des Alten, des benediktinischen Mönchtums, der römi- schen Kirche und der kaiserlichen Majestät. Eine Stellungnahme zum sich durch- setzenden Neuen hat sein Tod am Vorabend der Reformation ihm erspart.“5 Es ist daher nicht verwunderlich, dass er das Vorhandensein von Vorbildern als wichtigen Aspekt wertet.
2.2.6 Fazit zu Trithemius’ Argumenten für das Schreiben
Betrachtet man das Werk „Zum Lobe der Schreiber“ im Ganzen und die Argu- mente für das Schreiben im Speziellen, fällt auf, dass der Autor nur an wenigen Stellen direkte Vergleiche zwischen Druck und Handschrift zieht. Der größte Teil der Arbeit gibt dem Leser Anweisungen wie zu schreiben ist, was zu schreiben ist und Antworten auf mögliche Fragen oder Entkräftigungsargumente für mögliche Kritiker. Dabei bezieht er sich stets auf die Bewohner des Klosters und nicht et- wa auf gewöhnliche Bürger.
Hierbei hebt er besonders den Nutzen für den Schreiber hervor und prokla- miert das Schreiben als angemessene Beschäftigung für einen Mönch. Daraus lässt sich schließen, dass es, entgegen der simplifiziernden Bewertung durch die ältere Forschung, nicht seine Absicht war, den Buchdruck an sich zu diffamieren, sondern den Mönchen mit gezielten Vorschriften den Einstieg ins Schreiben zu erleichtern.
2.3 Über das Werk „De laude Scriptorium“
Johannes Trithemius gehörte zu den Menschen, die auch nach Verbreitung des Buchdrucks das Schreiben von Hand nicht als sinnlos ansahen und aufgaben.
Er hat diese Schreibtätigkeit, die Notwendigkeit, noch im Zeitalter des von Gutenberg erfun- denen Buchdrucks Bücher mit der Hand zu kopieren, und die dahinter stehende Geisteshaltung in einer eigenen kleinen Schrift De laude scriptorium (Zum Lobe der Schreiber) verteidigt - und das Büchlein noch im Jahr 1494 zum Druck gegeben mit dem Ziel, ihm so eine größere Verbreitung zu sichern.1
2.3.1 Die Situation des Buchdrucks um 1492
1492, eine Zeit, in der „die mittelalterliche Schreibkunst durch die Erfindung des Buchdrucks überflüssig geworden schien“,2 war das Entstehungsjahr von „De laude scriptorium“. Der gedruckte Text galt damals manchem sogar wertvoller als die Handschrift. So wurden viele vernichtet und zu Einbänden verarbeitet.3 „So lassen sich noch aus dem fünfzehnten Jahrhundert seitenweise Lobeshymnen auf diese neue Kunst aufreihen.“4 Mit seinem Lob an den Schreiber distanziert sich Trithemius von solchen Taten und Wertungen.
Wie weit also war der Buchdruck zu besagter Zeit schon vorgedrungen? Die Technik des Druckens wurde um 1450 durch Gutenberg erfunden. Verschiedene Verbesserungen, wie zum Beispiel eine geeignete Legierung für die Lettern, tru- gen dazu bei, dass der Buchdruck produktiver wurde und sich auszubreiten be- gann.5 Dies alles geschah in einer Zeit, in der Städte und Bürgertum stärker wur- den und nach Bildung verlangten. Die Kirche war jahrelang Monopolist in Sachen Schriftlichkeit gewesen. Doch nun begann eine Veränderung im Bereich Bildung. „Das Aufblühen des städtischen Schulwesens und der Universitäten markierte einen Aufschwung der Bildung im 15. und 16. Jahrhundert“.6 Es ist daher kein Zufall, dass sich unter den Inkunabeln viele Schulbücher befinden.7
Es gab also gute Voraussetzungen für die Drucker. „In Deutschland druckten bis zum Jahrhundertende etwa 300 Offizinen in 62 Städten.“8 „Drucke zusam- menzubringen war am Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts schon nicht mehr sehr schwer, wenn man die nötigen Geldmittel aufbringen konnte und über gute Beziehungen zu wichtigen Offizinen und Gelehrten verfügte.“9
Dies war bei Trithemius definitiv der Fall. Und trotzdem hielt er auch weiterhin an den Skriptorien fest. „Zu Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts war jedoch die Anfertigung von Manuskripten keineswegs exzeptionell; sie stand vielmehr gerade in den Konventen der Reformgemeinschaften von Windsheim und von Bursfelde in einer späten Blüte.“1 Trotz des Buchdrucks pflegten die Klöster weiterhin die Handschriften.
Hieraus lässt sich deutlich eine Spaltung zwischen der geistlichen und weltlichen Aufassung zum Buchdruck erkennen
2.3.2 Auftrag
Wie kam es nun zu dem besagten Werk? Die Union von Bursfelde, die Bewegung zur Erneuerung des benediktinischen Ordens, brachte im September 1492 die Äbte Johannes Trithemius und „Gerlach von Breitenbach, Abt des Benediktiner- klosters St. Heribert in Deutz“2 zusammen. „Abt Gerlach ergriff die Gelegenheit, den berühmten Amtsbruder um die Abfassung einer Schrift zu bitten, die die ihm anvertrauten Mönche für die Schreibarbeit begeistern könnte.“3 So entstand die Idee zu „De laude scriptorium“. Das Anliegen Gerlachs war Trithemius auch selbst nicht fremd. Wie bereits erwähnt, war er als Abt streng mit seinen Mön- chen und darauf bedacht sie vor Müßiggang zu warnen und statt dessen Bildung und Studium als höheres Ziel zu vermitteln. „Trithemius, zu dieser Zeit gerade damit beschäftigt, Material für seinen Schriftstellerkatalog „De viris illustribus ordinis sancti Benedicti“ zu sammeln, kam der Bitte Gerlachs bereitwillig nach.“4 Bald darauf schickte er das fertige Werk nach Deutz zu seinem „Auftraggeber“. Der Widmungsbrief trägt das Datum vom 8. Oktober 1492. 5
2.3.3 Druck
Die Erstfassung wurde vom Autor später noch einmal überarbeitet, und zwar bevor er sie zum Druck gab. Die Änderungen sind jedoch minimal und haben stilistische Gründe. Es stellt sich nun die Frage, ob es nicht widersprüchlich war „Zum Lobe der Schreiber“ zu drucken. Doch trotz seiner Vorliebe für Hand- schriften, war Trithemius durchaus bewusst, dass er die neue technische Errun- genschaft für sich nutzen konnte. Er wusste, dass sich sein Werk durch den Druck wesentlich leichter verbreiten ließe. Es wäre daher sinnlos abzustreiten, dass er gewisse Vorteile der Gutenbergischen Erfindung offen anerkannte.
Gedruckt wurde in der Mainzer Offizin des Peter von Friedberg. Es war auch nicht sein einziges Werk, das hier über die Druckplatten gehen sollte. Insgesamt dreizehn Werke des Abtes wurden zwischen 1494 und 1498 hier vervielfältigt.
„Man möchte sogar annehmen, daß der Sponheimer Abt an der Vorbereitung und Durchführung von Friedbergs Drucken maßgeblich beteiligt war“6, schreibt Arnold. Er war nicht als Einziger dieser Meinung. „Hierauf deutet vor allem das konservativ wirkende, an eine Handschrift erinnernde »Layout« des Druckes hin“.1 Ob dieses Argument alleine ausreicht, ist meiner Meinung nach zweifelhaft. Schließlich waren in der Inkunabelzeit für gewöhnlich alle Drucke am Äußeren einer Handschrift orientiert: „Die ersten gedruckten Bücher lehnten sich überaus stark an das Vorbild der Handschriften an, was die Gestaltung der Seite, deren spätere Illuminierung und vor allem die gewählte Druckschrift betrifft.“2 Um dies zu entscheiden, wäre ein Vergleich mit anderen Drucken der Friedberg Offizin nötig. Die Beantwortung dieser Frage kann an dieser Stelle daher nicht erfolgen.
2.3.4 Überlieferte Fassungen
„Von »De laude scriptorium« hat sich nicht, wie von einigen anderen Werken des Johannes Trithemius, ein Autograph in der kalligraphischen Handschrift des Au- tors erhalten.“3 Bei der Erstellung eines kritischen Textes, können wir daher nur auf vier fremde Handschriften und zwei Drucke zurückgreifen, die überliefert wurden.
Die zwei Handschriften, die die Erstfassung wiedergeben, befinden sich in der Universitätsbibliothek Kiel und der Staatsbibliothek der Stiftung Preußischer Kul- turbesitz in Berlin. Die anderen zwei, sind Abschriften des Druckes von 1492 und befinden sich in der Universitätsbibliothek Würzburg und im Stadtarchiv Mainz.
Besagter Druck aus der Offizin von Peter Friedberg gibt, wie bereits erwähnt, eine überarbeitete Fassung wieder. Der zweite Druck von 1605 ist, sich nur durch einige Druckfehler davon unterscheidend, abhängig von jenem aus der Friedberg Offizin.4
2.3.5 Andere Aussagen des Trithemius zum Buchdruck
1515 schließt Trithemius ein weiteres Werk, seine Chronik des Klosters Hiraus ab. Und dort findet sich schließlich eine völlig andere Einschätzung des Buchdrucks, als sie auf den ersten Blick in „De laude scriptorium“ zu erkennen ist. Er bezeichnet sie als „die wunderbare und früher nicht bekannte Kunst des Bücherdruckens“.5 Auch in einem Brief an seinen Bruder Jakob im Jahre 1506 schlägt er andere Töne an und lobt die neue Entwicklung, die es ermöglicht, dass durch den niedrigeren Bücherpreis nun jeder Zugang zu Bildung hat.6
Diese wechselnde Beurteilung macht hellhörig. Es könnte bedeuten, dass der Autor seine Meinung geändert hat. Man kann es aber auch als einen Hinweis darauf sehen, dass Trithemius in seinem Schreiberlob absichtlich eine negativere Haltung zum Buchdruck einnimmt, als er eigentlich vertritt, um die Mönche zu überzeugen. Eine Bewertung von „De laude scriptorium“ durch die Wissenschaft muss also in jedem Fall differenziert erfolgen.
3. Schluss
3.1 Zusammenfassende Bewertung
Für die Bewertung von „De laude scriptorium“ und den darin enthaltenen Aussa- gen Trithemius über den Buchdruck ist es wichtig, sein Leben und Werk insbe- sondere aber auch seinen Einsatz für die Reformbewegung mit einzubeziehen. Weiterhin wurde das Schreiberlob aus einem bestimmten Grund und mit einem exakt definierten Ziel, nämlich die Mönche wieder zum Schreiben zu motivieren, verfasst.
Er wollte den Benediktinerorden zu einer Rückbesinnung auf seine Ursprünge veranlassen und dabei spielte das Schreiben als Handarbeit für die Mönche eine große Rolle, um sie vor Müßiggang zu bewahren. Er wollte ihnen die Vorteile des Schreibens zugänglich machen, die durch den Buchdruck nicht mehr erreicht werden konnten. Darüber hinaus sind wir über Trithemius eigene Bücherliebe gut unterrichtet und wissen, dass ihm das Thema eine Herzensangelegenheit war.
Es stellt sich nun die Frage, warum dieser gebildete Mann, „mit seiner das ganze Leben durchziehenden Bibliophilie“1 den zu seiner Zeit um sich greifenden Buchdruck abzulehnen schien. Vor allem im Hinblick auf seine späteren Aussagen und die Drucklegung seiner eigenen Werke, ist es wahrscheinlich, dass dies gar nicht der Fall war, sondern er „die Vorzüge und Vorteile des gerade sich durchsetzenden Buchdrucks offen“2 anerkannte.
3.2 Gültigkeit außerhalb des Klosters
Warum also seine tendenziell ablehnenden Aussagen über den Buchdruck in „De laude scriptorium“? Für Trithemius und seine Ziele war das Schreiben als Hand- arbeit ein wichtiger Bestandteil des mönchischen Lebens. Mit seinem Schreiber- lob wollte er weniger den Buchdruck angreifen und als unnötig oder gar unvor- teilhaft charakterisieren, als vielmehr den Schreiber loben, wie es der Titel auch suggeriert. Er erkannte die Gefahr, dass die Mönche das Schreiben auf Grund der neuen Erfindung einstellen würden. Sein Ziel bestand darin, diese mögliche Ent- wicklung aufzuhalten und das Schreiben auch neben dem Druck als sinnvolle Beschäftigung aufrecht zu erhalten. Die Gültigkeit seiner Aussagen beschränkt sich also auf das Kloster und seine Bewohner. Eine Verallgemeinerung wäre nicht zulässig.
3.3 Gesamtfazit
Meine zu Anfang gestellten Fragen sind damit beantwortet. Trithemius war dem Druck positiv gesinnt und lehnte ihn ganz und gar nicht ab. Sein Festhalten am Bewährten hatte ordensmotivierte Gründe und nichts mit Fortschrittsangst zu tun. Den einzigen echten Nachteil, den der Buchdruck auch außerhalb der klö- sterlichen Welt mit sich bringt, ist die angeblich kürzere Haltbarkeit von Papier.
Doch weiter oben haben wir diesem Argument bereits die Grundlage genommen. Es ist anzunehmen, dass Trithemius sich auch selbst der unzureichenden Beweis- führung in diesem Punkt bewusst war. Sein eigentlicher Schwerpunkt lag auf den Vorteilen des Schreibens. Es sollte nicht durch den Druck überflüssig werden.
Meine Ausführungen haben gezeigt, dass man „De laude scriptorium“ nicht als allgemeingültige Ablehnung des Buchdruckes verstehen darf, sondern wie Noel L. Brann, die Aussagen als auf den benediktinischen Kreis beschränkt, bewerten muss. Johannes Trithemius war also kein Verachter dieser neuen Kunst. Doch gibt sein Charakter der Forschung noch andere Rätsel auf, wie die eingangs erwähnten, die es noch zu lösen gilt.
Literaturverzeichnis
Primärquellen:
Arnold, Klaus: Johannes Trithemius. De laude scriptorium. Zum Lobe der Schreiber (Mainfränkische Hefte, Nr. 60). Würzburg 1973.
Sekundärliteratur:
Auernheimer, Richard/Baron, Frank (Hrsg.): Johannes Trithemius. Humanismus im vorreformatorischen Deutschland (Bad Kreuznacher Symposien I). Rieden 1991.
Embach, Michael: Skriptographie versus Typographie: Johannes Trithemius’ Schrift »De laude scriptorium«. In: Gutenberg Jahrbuch. Nr. 75/2000, S.123- 144.
Engelbert, Pius: Bursfelder Kongregation. In: Bautier, Robert-Henri (Hrsg.): Lexikon des Mittelalters. München 1983, S.1108-1110.
Gemeinde Trittenheim a.d. Mosel: 500-Jahrfeier Johannes Trithemius. Trittenheim/Mosel 1962.
Goerke, Jochen: Drucken. In: Rautenberg, Ursula (Hrsg.):Reclams Sachlexikon des Buches. 2., verbesserte Aufl. Stuttgart 2003, S. 166-168. Gummlich-Wagner, Johanna: Buchillustration. In: Rautenberg, Ursula (Hrsg.): Reclams Sachlexikon des Buches. 2., verbesserte Aufl. Stuttgart 2003, S. 107- 110.
Lehmann, Paul: Merkwürdigkeiten des Abtes Johannes Trithemius. In: Sitzungsberichte (1961) H.2 vom 7. November 1958.
Mertens, Dieter: Arnold, Klaus: Johannes Trithemius (1462-1516).In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Nr.102/1973, S.170-177. Rautenberg, Ursula: Papier. In: Rautenberg, Ursula (Hrsg.): Reclams Sachlexikon des Buches. 2., verbesserte Aufl. Stuttgart 2003, S. 386-388.
Silbernagl, Isidor: Johannes Trithemius. Eine Monographie. Regensburg 1885. Venzke, Andreas: Johannes Gutenberg. Der Erfinder des Buchdrucks. Zürich 1993.
Widmann, Hans: Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks - aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders. Mainz 1973.
Zender, Joachim Elias: Papier. In: Zender, Joachim Elias: Lexikon Buch Druck Papier. Basel 2008, S.200-201.
Zotter, Hans: Die Geschichte des europäischen Buchdrucks. Wien 1981.
[...]
1 Widmann 1973, S.23.
2 Vgl. Embach 2000, S.137/138.
1 Vgl. Arnold 1973, S. 1-10.
2 Vgl. Mertens 1973, S.170.
3 Arnold 1973, S.1.
4 Arnold 1973, S.1/2.
5 Vgl. Embach 2000, S.133.
6 Gemeinde Trittenheim 1962, S.13.
7 Arnold 1973, S.3.
1 Vgl. Auernheimer 1991, S.6.
2 Vgl. Engelbert 1983, S. 1110.
3 Auernheimer 1991, S.4.
4 Auernheimer 1991, S.40.
5 Arnold 1973, S.3.
6 Arnold 1973, S.2.
7 Arnold 1973, S.5.
1 Vgl. Arnold 1973, S.73-75.
2 Arnold 1973, S.3.
3 Lehmann 1961, S.5.
4 Auernheimer 1991, S.40.
5 Arnold 1973, S.4.
6 Vgl. Lehmann 1961, S.8.
1 Auernheimer 1991, S.7.
1 Arnold 1973, S.35.
2 Arnold 1973, S.63.
3 Widmann 1973, S.29.
4 Vgl. Rautenberg 2003, S.386-388.
5 Zender 2008, S.200.
6 Arnold 1973, S.65.
1 Arnold 1973, S. 65.
2 Vgl. Gummlich-Wagner 2003, S.108.
3 Vgl. Arnold 1973, S.67.
4 Vgl. Arnold 1973, S.93-97.
1 Vgl. Arnold 1973, S.97.
2 Vgl. Arnold 1973, S.99.
3 Vgl. Arnold 1973, S.63.
4 Vgl. Arnold 1973, S.49.
5 Vgl. Arnold 1973, S.61.
1 Vgl. Arnold 1973, S.73.
2 Vgl. Arnold 1973, S.95.
3 Vgl. Arnold 1973, S.39.
4 Arnold 1973, S.61.
5 Arnold 1973, S.47.
1 Arnold 1973, S.83.
2 Arnold 1973, S.85.
3 Arnold 1973, S.53.
4 Vgl. Arnold 1973, S.55.
5 Vgl. Arnold 1973, S.69.
6 Vgl. Arnold 1973, S.93.
7 Vgl. Arnold 1973, S.71.
1 Vgl. Arnold 1973, S.45-49.
2 Vgl. Arnold 1973, S.91.
3 Vgl. Arnold 1973, S.105.
4 Vgl. Arnold 1973, S. 35.
5 Auernheimer 1991, S.3.
1 Auernheimer 1991, S.8.
2 Arnold 1973, S. 11.
3 Vgl. Arnold 1973, S.11.
4 Venzke 1993, S.308.
5 Vgl. Goerke 2003, S.167.
6 Auernheimer 1991, S.2.
7 Vgl. Zotter 1981, S.4.
8 Zotter 1981, S.15.
9 Lehmann 1961, S.18.
1 Arnold 1973, S.12.
2 Embach 2000, S.133.
3 Arnold 1973, S.12.
4 Emach 2000, S. 134.
5 Vgl. Arnold 1973, S.12-14.
6 Arnold 1973, S.14.
1 Embach 2000, S.134.
2 Venzke 1993, S. 306.
3 Arnold 1973, S.20.
4 Vgl. Arnold 1973, S.20-23.
5 Widmann 1973, S.27.
6 Vgl. Widmann 1973, S.29.
1 Lehmann 1961, S.4.
Häufig gestellte Fragen zum "De laude Scriptorium"
Was ist "De laude Scriptorium"?
"De laude Scriptorium" (Zum Lobe der Schreiber) ist ein Werk von Johannes Trithemius, in dem er Argumente für das Schreiben von Hand im Zeitalter des Buchdrucks darlegt. Er verteidigt die Notwendigkeit, Bücher weiterhin manuell zu kopieren und die damit verbundene Geisteshaltung.
Wer war Johannes Trithemius?
Johannes Trithemius (1462-1516) war ein deutscher Abt, Gelehrter und Schriftsteller. Er war bekannt für seine Frömmigkeit, Bildung und seine Liebe zu Büchern. Er investierte viel Zeit und Mühe in den Aufbau der Sponheimer Klosterbibliothek.
Wann entstand "De laude Scriptorium"?
"De laude Scriptorium" entstand im Jahr 1492, einer Zeit, in der der Buchdruck durch Johannes Gutenberg bereits verbreitet war.
Warum verfasste Trithemius "De laude Scriptorium"?
Trithemius verfasste das Werk, um die Mönche seines Ordens zum Schreiben zu motivieren. Er sah im Schreiben eine Möglichkeit, sie vor Müßiggang zu bewahren und ihnen eine sinnvolle Beschäftigung zu bieten.
Welche Argumente führt Trithemius für das Schreiben an?
Trithemius führt verschiedene Argumente für das Schreiben an, darunter die längere Haltbarkeit von Pergament im Vergleich zu Papier, die größere Sorgfalt bei der Herstellung handgeschriebener Codices und den Nutzen für den Schreiber (Lohn des ewigen Lebens, Hilfe beim Studium, Schutz gegen Müßiggang, angemessene Beschäftigung für einen Mönch, Vorbild der Alten).
Lehnte Trithemius den Buchdruck ab?
Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Trithemius den Buchdruck nicht generell ablehnte. Vielmehr wollte er die Mönche motivieren, das Schreiben weiterhin als sinnvolle Beschäftigung auszuüben. Er erkannte durchaus die Vorteile des Buchdrucks an.
Welche Bedeutung hat Religion für "De laude Scriptorium"?
Die Religion nimmt einen grossen Teil in der Argumentation von Trithemius ein, da er das Schreiben der Heiligen Schrift als eine Form der Andacht sah. Es sollten vor allem die christlichen Werte beschützt werden und nur das gedruckt werden, was der katholischen Kirche entsprach.
Was ist das Fazit zu Trithemius' Argumenten für das Schreiben?
Trithemius zog nur an wenigen Stellen direkte Vergleiche zwischen Druck und Handschrift. Er gab Anweisungen, wie zu schreiben ist und was geschrieben werden soll und beantwortete Fragen für mögliche Kritiker. Er argumentierte, dass das Schreiben den Mönchen geholfen hat, nicht dem Müßiggang zu verfallen.
Was ist die allgemeine Gültigkeit von "De laude Scriptorium"?
Die Gültigkeit seiner Aussagen beschränkt sich also auf das Kloster und seine Bewohner. Eine Verallgemeinerung wäre nicht zulässig.
Wo wurde "De laude Scriptorium" gedruckt?
Gedruckt wurde es in der Mainzer Offizin des Peter von Friedberg.
- Quote paper
- Lena Augustin (Author), 2009, Johannes Trithemius – De laude scriptorium, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/268044