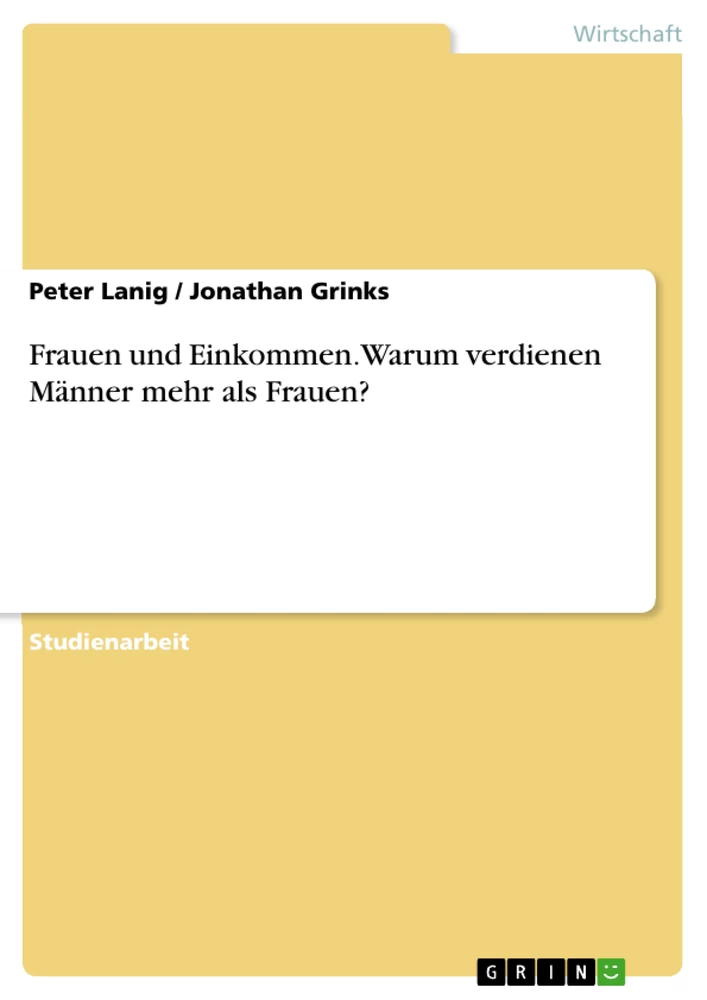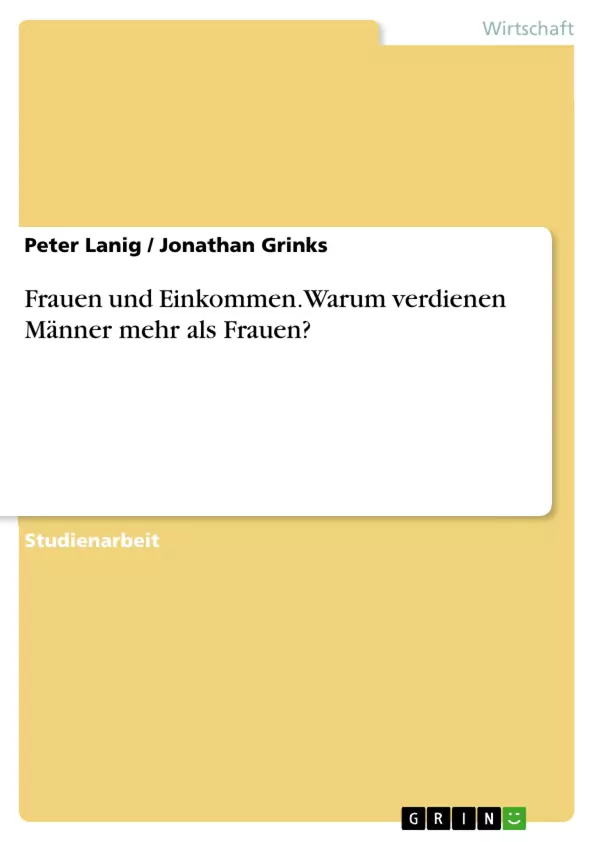Die vorliegende Arbeit möchte der Frage nachgehen, warum Männer mehr verdienen als Frauen. Dazu soll zunächst ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu der Thematik gegeben werden, um anschließend die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen zur Verhinderung von Lohndiskriminierung aufzuzeigen. Außerdem soll mit dem sogenannten Gender Pay Gap (GPG) der Index zur Feststellung von Verdienstunterschieden zwischen Männern und Frauen vorgestellt werden, um schließlich die vielfältigen und objektiv erklärbaren Ursachen für das Zustandekommen von Lohunterschieden zwischen Männern und Frauen zu erörtern. Die Arbeit schließt mit einem ausblickenden Fazit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Einführung
- Forschungs- und Wissensstand
- Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen
- Der Gender Pay Gap
- Ursachen für Lohnunterschiede
- Qualifikationsstand
- Berufswahl
- Unternehmensgröße
- Erwerbsbeteiligung
- Traditionelle Rollenbilder
- Fehlanreize im Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Lohndiskriminierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die bestehenden Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen in Deutschland. Ziel ist es, die vielschichtigen Ursachen dieses Gender Pay Gaps (GPG) umfassend zu beleuchten und nicht nur auf Lohndiskriminierung zu reduzieren. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Faktoren, die zu den Lohnunterschieden beitragen.
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und deren Wirksamkeit
- Einfluss von Qualifikationsunterschieden und Berufswahl
- Rolle der Unternehmensgröße und Erwerbsbeteiligung
- Auswirkungen traditioneller Rollenbilder
- Das Problem der Lohndiskriminierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen ein und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen dieses Unterschieds. Sie verweist auf die anhaltende Diskrepanz trotz gesetzlicher Bemühungen und kündigt den Ansatz an, verschiedene Faktoren umfassend zu betrachten, anstatt den Fokus allein auf Lohndiskriminierung zu legen. Der bereinigte Gender Pay Gap (GPG) wird als wichtiges Analysewerkzeug vorgestellt.
Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen auf nationaler und europäischer Ebene, die Lohndiskriminierung verbieten. Es wird deutlich gemacht, dass gleiche Arbeit und vergleichbare Qualifikation gleiche Bezahlung rechtlich garantieren. Der Fokus liegt auf der Frage, warum trotz dieser gesetzlichen Bestimmungen Lohnunterschiede bestehen bleiben.
Der Gender Pay Gap: Dieses Kapitel beschreibt den Gender Pay Gap (GPG) und dessen Bedeutung als Indikator für Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern. Es dient als Brücke zu den folgenden Kapiteln, die die Ursachen des GPG detailliert untersuchen. Der GPG wird als Ausgangspunkt für die Analyse der vielschichtigen Faktoren verwendet.
Ursachen für Lohnunterschiede: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Faktoren, die zum Gender Pay Gap beitragen. Es analysiert den Qualifikationsstand, die Berufswahl, die Unternehmensgröße und die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Es werden detaillierte Erklärungen und Beispiele für jeden Faktor gegeben, um den komplexen Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und der Lohnungleichheit zu verdeutlichen. Die Rolle traditioneller Rollenbilder und Fehlanreize im Steuer- und Sozialversicherungsrecht werden hier besonders hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Gender Pay Gap, Lohndiskriminierung, Qualifikation, Berufswahl, Unternehmensgröße, Erwerbsbeteiligung, traditionelle Rollenbilder, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, gesetzliche Bestimmungen, Lohnunterschiede, Frauen, Männer.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht umfassend die bestehenden Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen in Deutschland. Ziel ist es, die vielschichtigen Ursachen des Gender Pay Gaps (GPG) zu beleuchten und nicht nur auf Lohndiskriminierung zu reduzieren.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, den Gender Pay Gap selbst, verschiedene Ursachen für Lohnunterschiede (Qualifikationsstand, Berufswahl, Unternehmensgröße, Erwerbsbeteiligung, traditionelle Rollenbilder, Fehlanreize im Steuer- und Sozialversicherungsrecht) und das Problem der Lohndiskriminierung.
Welche Faktoren werden als Ursachen für Lohnunterschiede analysiert?
Die Hausarbeit analysiert detailliert den Einfluss von Qualifikationsunterschieden, Berufswahl, Unternehmensgröße, Erwerbsbeteiligung von Frauen, traditionelle Rollenbilder und Fehlanreize im Steuer- und Sozialversicherungsrecht auf den Gender Pay Gap.
Wie wird der Gender Pay Gap (GPG) in der Arbeit behandelt?
Der GPG wird als wichtiger Indikator für Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern beschrieben und dient als Ausgangspunkt für die Analyse der verschiedenen Faktoren, die zu diesen Unterschieden beitragen. Der bereinigte GPG wird als Analysewerkzeug vorgestellt.
Welche Rolle spielen gesetzliche Bestimmungen?
Die Hausarbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen auf nationaler und europäischer Ebene, die Lohndiskriminierung verbieten. Es wird untersucht, warum trotz dieser Bestimmungen Lohnunterschiede bestehen bleiben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Schlussfolgerungen der Hausarbeit sind im Fazit zusammengefasst und werden in der Zusammenfassung der Kapitel angedeutet. Die Arbeit zeigt auf, dass der Gender Pay Gap multifaktoriell bedingt ist und nicht allein auf Lohndiskriminierung zurückgeführt werden kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Gender Pay Gap, Lohndiskriminierung, Qualifikation, Berufswahl, Unternehmensgröße, Erwerbsbeteiligung, traditionelle Rollenbilder, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, gesetzliche Bestimmungen, Lohnunterschiede, Frauen, Männer.
Welche Struktur hat die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, den Gender Pay Gap, die Ursachen von Lohnunterschieden und ein Fazit. Sie beinhaltet außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
- Arbeit zitieren
- Master of Science Peter Lanig (Autor:in), Jonathan Grinks (Autor:in), 2012, Frauen und Einkommen. Warum verdienen Männer mehr als Frauen?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/267966