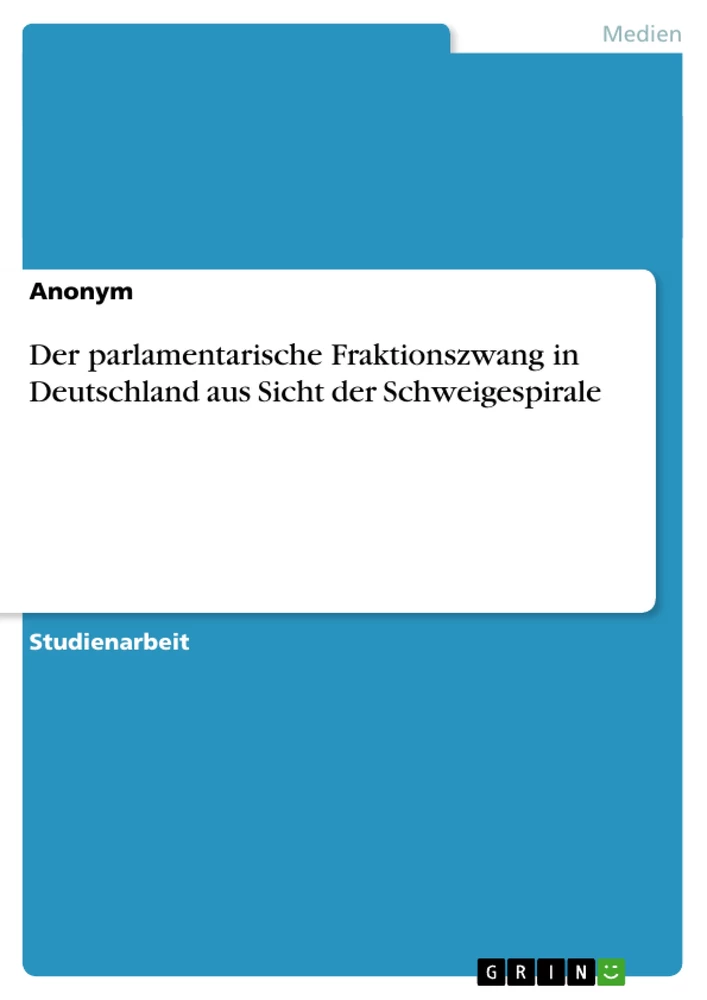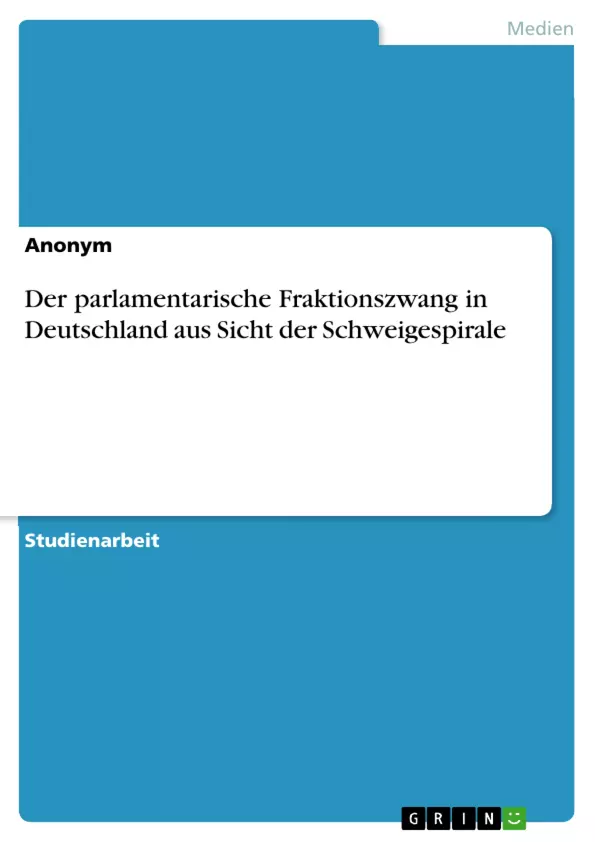Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie der Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann, angewandt auf den parlamentarischen Fraktionszwang in Deutschland. Um einen ersten Überblick zu vermitteln, ist es notwendig, die Biographie Noelle-Neumanns themenbezogen auf die
Entstehung der Schweigespirale nachzuzeichnen (Kapitel 2). Direkt im Anschluss folgt die Darstellung der Theorie der Schweigespirale basierend auf der Darstellung Noelle-Neumanns (Kapitel 3). Die psychologischen, kommunikations- und gesellschaftstheoretischen Aspekte werden eingehend erläutert, um den Bezug auf den Fraktionszwang, welcher im letzen Teil erläutert wird, nachvollziehbar zu verdeutlichen (Kapitel 3.1). Auf die empirische Überprüfung Noelle-Neumanns kann aufgrund der formalen Vorgaben nur sehr kurz eingegangen werden; deswegen wird der für diese Arbeit relevante Redebereitschaft anhand des „Eisenbahntests“ näher vorgestellt (Kapitel 3.3). Die Veröffentlichung des Werks „Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung“ löste eine große Welle an Kritik aus; zweckmäßig wird diese umfassend aufgezeigt (Kapitel 4). Der zweite Teil befasst sich mit der Frage, inwieweit sich die Theorie der Schweigespirale auf den politischen Fraktionszwang anwenden lässt (Kapitel 5). Die verwendete Literatur beschränkt sich auf die Grundwerke zur Theorie und Kritik zuzüglich einzelner Internetquellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Elisabeth Noelle-Neumann
- 3. Die Theorie der Schweigespirale
- 3.1 Die Aspekte der Schweigespirale
- 3.2 Rahmenbedingungen zur Entstehung…
- 3.3 Empirische Untersuchungen
- 4. Kritik
- 5. Der Fraktionszwang aus Sicht der Schweigespirale
- 5.1 Der Begriff Fraktionszwang
- 5.2 Anwendbarkeit der Schweigespirale auf den Fraktionszwang
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Schweigespirale-Theorie von Elisabeth Noelle-Neumann auf den parlamentarischen Fraktionszwang in Deutschland. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Theorie im Kontext des Fraktionszwangs zu analysieren und deren Relevanz zu bewerten.
- Die Biographie von Elisabeth Noelle-Neumann und die Entstehung ihrer Theorie.
- Die zentralen Aspekte der Schweigespirale-Theorie, einschließlich der psychologischen und gesellschaftlichen Grundlagen.
- Empirische Befunde zur Schweigespirale und deren methodische Limitationen.
- Die Kritik an der Schweigespirale-Theorie.
- Die Anwendung der Schweigespirale-Theorie auf den Fraktionszwang.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Anwendung der Schweigespirale-Theorie auf den parlamentarischen Fraktionszwang in Deutschland. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit, wobei die Biographie Noelle-Neumanns, die Darstellung der Schweigespirale-Theorie, die dazugehörige Kritik und schließlich die Anwendung auf den Fraktionszwang in separaten Kapiteln behandelt werden. Der Bezug zu Noelle-Neumanns Biographie wird als notwendig für das Verständnis der Theorie dargestellt, und die Limitationen hinsichtlich der empirischen Untersuchung werden aufgrund der formalen Vorgaben erwähnt. Die Einleitung legt den methodischen Rahmen und die Struktur der folgenden Argumentation dar.
2. Elisabeth Noelle-Neumann: Dieses Kapitel skizziert die Biographie von Elisabeth Noelle-Neumann, der Entwicklerin der Schweigespirale-Theorie. Es werden wichtige Stationen ihres Lebens hervorgehoben, insbesondere ihr Studium, ihre Zeit an der University of Missouri, die Gründung des Instituts für Demoskopie Allensbach mit ihrem Ehemann, und die Veröffentlichung ihres einflussreichen Werkes "Die Schweigespirale". Die Darstellung der Biographie dient als Kontextualisierung der Theorieentwicklung, indem sie den persönlichen und wissenschaftlichen Hintergrund Noelle-Neumanns beleuchtet und ihre Beweggründe für die Entwicklung der Theorie andeutet. Der Fokus liegt dabei auf den Ereignissen und Erfahrungen, die zur Entstehung ihrer Theorie beitrugen, insbesondere die Ergebnisse der Umfragen zu Bundestagswahlen.
3. Die Theorie der Schweigespirale: Dieses Kapitel beschreibt die Kernelemente der Schweigespirale-Theorie. Im Zentrum steht die Furcht vor sozialer Isolation als treibende Kraft im Prozess der Meinungsbildung. Es wird erklärt, wie das „Meinungsklima“ die Bereitschaft beeinflusst, Meinungen öffentlich zu äußern. Menschen mit einer Mehrheitsmeinung fühlen sich bestärkt, während Minderheitenmeinungen zum Schweigen gebracht werden können. Der „Spiralprozess“ wird als dynamische Entwicklung dargestellt, in der die vermeintlich schwächere Meinung immer schwächer erscheint, während die vermeintlich stärkere an Einfluss gewinnt. Die Ausführungen greifen auf sozialpsychologische Aspekte zurück und erläutern den Einfluss von Konformitätsdruck und die Rolle der Massenmedien bei der Wahrnehmung des Meinungsklimas. Die Theorie wird als Makro-Theorie dargestellt, die auf Erkenntnissen aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen aufbaut.
4. Kritik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kritik an der Schweigespirale-Theorie. Es wird angenommen, dass die Veröffentlichung des Werkes "Die Schweigespirale" eine umfangreiche Debatte ausgelöst hat. Das Kapitel setzt sich mit den verschiedenen Einwänden und kritischen Argumenten auseinander, die gegen die Theorie vorgebracht wurden. Die genaue Natur der Kritik wird hier nicht weiter ausgeführt, sondern es wird nur ihr Umfang und ihre Bedeutung für das Gesamtverständnis der Theorie erwähnt.
5. Der Fraktionszwang aus Sicht der Schweigespirale: Dieses Kapitel untersucht die Anwendbarkeit der Schweigespirale-Theorie auf den parlamentarischen Fraktionszwang. Es beginnt mit einer Definition des Begriffs „Fraktionszwang“ und analysiert, inwieweit die Mechanismen der Schweigespirale im Kontext des parlamentarischen Systems wirken. Die Analyse betrachtet die potentiellen Auswirkungen des Fraktionszwangs auf die Meinungsäußerung von Abgeordneten und die mögliche Entstehung eines „Meinungsklimas“ innerhalb der Fraktionen. Die Kapitel untersucht, ob die Furcht vor Ausgrenzung oder Sanktionen den Abgeordneten dazu bringen kann, von ihrer persönlichen Überzeugung abzuweichen und der Fraktionslinie zu folgen, wodurch eine Meinungsvielfalt unterdrückt werden kann. Das Kapitel argumentiert anhand der Theorie, wie sich diese Dynamik auf den politischen Prozess auswirkt.
Schlüsselwörter
Schweigespirale, Elisabeth Noelle-Neumann, öffentlicher Meinung, Meinungsbildung, sozialer Druck, Konformität, Massenmedien, Fraktionszwang, parlamentarische Demokratie, Meinungsfreiheit, politische Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: "Die Schweigespirale und der Fraktionszwang"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Schweigespirale-Theorie von Elisabeth Noelle-Neumann auf den parlamentarischen Fraktionszwang in Deutschland. Sie analysiert die Theorie im Kontext des Fraktionszwangs und bewertet deren Relevanz.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Biographie von Elisabeth Noelle-Neumann, die zentralen Aspekte der Schweigespirale-Theorie (einschließlich psychologischer und gesellschaftlicher Grundlagen und empirischer Befunde), die Kritik an der Theorie, und schließlich die Anwendung der Schweigespirale-Theorie auf den Fraktionszwang. Methodische Limitationen empirischer Untersuchungen werden ebenfalls angesprochen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Biographie Elisabeth Noelle-Neumanns, Darstellung der Schweigespirale-Theorie, Kritik an der Theorie, Anwendung der Schweigespirale auf den Fraktionszwang und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den Fokus und Aufbau der Arbeit. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der oben genannten Themen.
Was ist die Schweigespirale-Theorie?
Die Schweigespirale-Theorie beschreibt die Furcht vor sozialer Isolation als treibende Kraft in der Meinungsbildung. Das „Meinungsklima“ beeinflusst die Bereitschaft, Meinungen öffentlich zu äußern. Mehrheitsmeinungen werden verstärkt, Minderheitsmeinungen zum Schweigen gebracht. Die Theorie betrachtet den „Spiralprozess“ als dynamische Entwicklung, in der vermeintlich schwächere Meinungen immer schwächer erscheinen.
Welche Rolle spielen Massenmedien in der Schweigespirale-Theorie?
Massenmedien spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung des Meinungsklimas. Sie beeinflussen, welche Meinungen als vorherrschend wahrgenommen werden und somit den Konformitätsdruck verstärken oder abschwächen können.
Welche Kritikpunkte werden an der Schweigespirale-Theorie geäußert?
Die Arbeit erwähnt die umfangreiche Kritik an der Schweigespirale-Theorie, geht aber nicht im Detail darauf ein. Der Umfang und die Bedeutung dieser Kritik für das Gesamtverständnis der Theorie werden jedoch erwähnt.
Wie wird der Fraktionszwang im Kontext der Schweigespirale analysiert?
Die Arbeit analysiert, inwieweit die Mechanismen der Schweigespirale im Kontext des parlamentarischen Systems und des Fraktionszwangs wirken. Sie untersucht, ob die Furcht vor Ausgrenzung oder Sanktionen Abgeordnete dazu bringt, von ihrer persönlichen Überzeugung abzuweichen und der Fraktionslinie zu folgen, wodurch Meinungsvielfalt unterdrückt werden könnte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schweigespirale, Elisabeth Noelle-Neumann, öffentliche Meinung, Meinungsbildung, sozialer Druck, Konformität, Massenmedien, Fraktionszwang, parlamentarische Demokratie, Meinungsfreiheit, politische Kommunikation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Anwendbarkeit der Schweigespirale-Theorie auf den parlamentarischen Fraktionszwang zu untersuchen und die Relevanz der Theorie in diesem Kontext zu bewerten.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2011, Der parlamentarische Fraktionszwang in Deutschland aus Sicht der Schweigespirale, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/266845