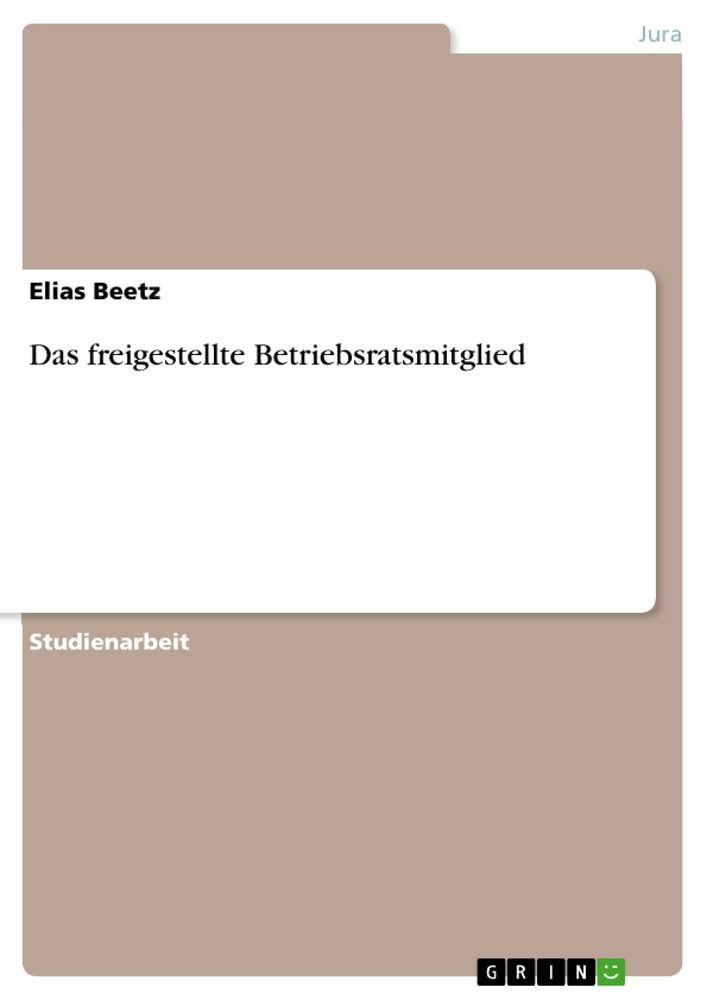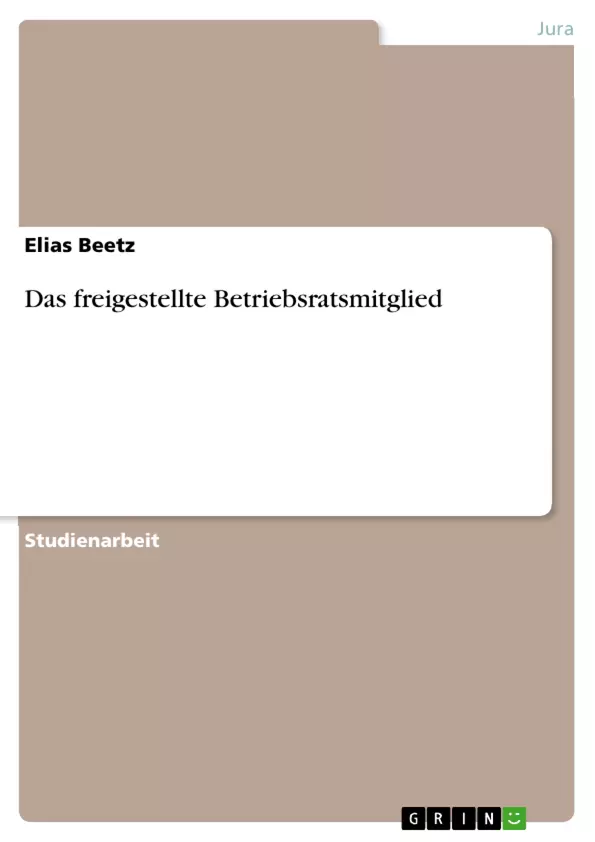Der Betriebsrat wirkt in seiner Funktion als Arbeitnehmervertretung sowohl zum Schutz der Arbeitnehmer als auch vermittelnd zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Diese Schutzfunktion ist in Hinblick auf das Machtungleichgewicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer generell notwendig und zugleich aufgrund aktueller wirtschaftspolitischer Entwicklungen hinsichtlich Kosteneinsparungen durch z.B. Personalabbau besonders relevant.
Um ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen zu können, werden Betriebsratsmitglieder nach den §§ 37 und 38 BetrVG1 betrieblichen Tätigkeit in gewissem Umfang befreit.
Derartige Befreiungen bedeuten für den Arbeitgeber zusätzliche Kosten, für den Betriebsrat hingegen zusätzliche Kapazitäten sich für die Interessen der Arbeitnehmer einzusetzen. In welchem Umfang Befreiungen einzuräumen sind, führt dementsprechend regelmäßig zu Uneinigkeit zwischen beiden Parteien. Der Gegenstand dieser Arbeit, die Freistellung i.S.d. § 38 als weitreichendste Form der Befreiung, ist daher von besonderer Bedeutung.
In dieser Arbeit wird unter anderem dargestellt, was eine Freistellung ausmacht, welche Formen es gibt und wie sie zustande kommt.
Weitgehend geregelte Bereiche, wie z.B. die Auswahl freigestellter Betriebsratsmitglieder, sind dabei bewusst kurz gehalten, während auf Kontroversen wie der Berücksichtigung von Leiharbeitern bei der Betriebsgröße oder dem Verfahren bei Veränderung der Betriebsgröße vertieft eingegangen wird.
Grundlagen zur Freistellung
I. Begriff und Abgrenzung
Gem. § 37 II sind Mitglieder des Betriebsrats von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie werden dadurch von ihrer Hauptpflicht gegenüber dem Arbeitgeber, der Verrichtung der Arbeit, befreit generell und auch über die Staffelung des § 38 I hinaus möglich. Im Unterschied zur Befreiung aus konkretem Anlass nach § 37 II wird bei der Freistellung i.S.d. § 38 I die Erforderlichkeit pauschal vermutet.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Grundlagen zur Freistellung
- I. Begriff und Abgrenzung
- II. Sinn und Zweck
- C. Zahl der Freistellungen
- I. Berechnung der Zahl der Freistellungen
- 1. Berücksichtigte Arten von Arbeitnehmern
- 2. Der Begriff „Regelmäßig“
- 3. Der Begriff „Betrieb“
- 4. Schwellenwerte des § 38 I
- II. Zusätzliche Freistellungen
- 1. Betriebsvereinbarung (BV) und Tarifvertrag (TV)
- 2. Befreiungen gem. § 37 II
- 3. Zusätzliche Freistellung ohne BV oder TV
- III. Ersatzfreistellungen
- 1. Eine Ansicht: Nachrücken
- 2. Andere Ansicht: Neuwahl/ Nachrücken durch Beschluss
- 3. Ergebnis
- IV. Veränderungen der Arbeitnehmerzahl
- 1. Erhöhung
- 2. Verringerung
- 3. Verfahren bei Veränderungen der Zahl der Freistellungen
- I. Berechnung der Zahl der Freistellungen
- D. Auswahl freigestellter Betriebsratsmitglieder nach § 38 II
- I. Beratung
- II. Wahl
- 1. Mehrheitswahl
- 2. Verhältniswahl
- III. Einigungsstelle
- IV. Einschränkung der Kompetenz von Betriebsrat und Einigungsstelle
- E. Umfang der Freistellungen
- I. Dauer der Freistellung
- II. Abgrenzung zwischen Voll- und Teilfreistellung
- 1. Berechnung
- 2. Gesamtumfang i.S.d. § 38 I
- III. Erforderlichkeit von Teilfreistellungen
- 1. Nachteile
- 2. Vorteile
- F. Rechtsstellung freigestellter Betriebsratsmitglieder
- I. Pflichten
- 1. Hauptleistungspflicht
- 2. Nebenleistungspflichten
- II. Rechte
- 1. Entgeltliche Ansprüche
- 2. Unentgeltliche Ansprüche
- III. Nach ihrer Betriebsratstätigkeit
- I. Pflichten
- G. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der freigestellten Betriebsratsmitglieder im deutschen Arbeitsrecht. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen, die Berechnung der Freistellungen, die Auswahlverfahren und die Rechtsstellung der freigestellten Mitglieder umfassend darzustellen. Der Fokus liegt auf der Klärung der komplexen Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) in diesem Bereich.
- Berechnung der Anzahl freizustellender Betriebsratsmitglieder
- Auswahlverfahren und Kriterien für freigestellte Betriebsratsmitglieder
- Umfang der Freistellung (Voll- und Teilfreistellung)
- Rechte und Pflichten freigestellter Betriebsratsmitglieder
- Rechtliche Aspekte bei Veränderungen der Arbeitnehmerzahl
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung dient als kurzer Überblick über die Thematik der freigestellten Betriebsratsmitglieder und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentralen Fragen, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
B. Grundlagen zur Freistellung: Dieses Kapitel legt den Begriff der Freistellung von Betriebsratsmitgliedern fest und grenzt ihn von anderen arbeitsrechtlichen Konzepten ab. Es beleuchtet den Sinn und Zweck dieser Regelung im Kontext des Betriebsverfassungsgesetzes, nämlich die Sicherstellung der effektiven Mitbestimmung der Arbeitnehmer.
C. Zahl der Freistellungen: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit der Berechnung der Anzahl freizustellender Betriebsratsmitglieder. Es analysiert die verschiedenen Faktoren, die in die Berechnung einfließen, wie die Anzahl der Arbeitnehmer, die Definition von „regelmäßig“ Beschäftigten und die Abgrenzung des Begriffs „Betrieb“. Zusätzliche Freistellungen aufgrund von Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen werden ebenso betrachtet, wie der Umgang mit Veränderungen der Arbeitnehmerzahl und die Problematik von Ersatzfreistellungen.
D. Auswahl freigestellter Betriebsratsmitglieder nach § 38 II: Hier wird das Verfahren der Auswahl freizustellender Betriebsratsmitglieder im Detail erläutert. Die unterschiedlichen Methoden der Wahl (Mehrheitswahl, Verhältniswahl) werden beschrieben und die Rolle der Einigungsstelle im Streitfall beleuchtet. Die Grenzen der Kompetenz von Betriebsrat und Einigungsstelle werden ebenfalls thematisiert.
E. Umfang der Freistellungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Dauer der Freistellung und der Unterscheidung zwischen Voll- und Teilfreistellung. Es analysiert die Berechnung der Freistellungsdauer und beleuchtet die Vor- und Nachteile von Teilfreistellungen im Hinblick auf die Effektivität der Betriebsratsarbeit.
F. Rechtsstellung freigestellter Betriebsratsmitglieder: Hier werden die Rechte und Pflichten der freigestellten Betriebsratsmitglieder im Detail behandelt. Die Haupt- und Nebenleistungspflichten werden ebenso betrachtet wie die entgeltlichen und unentgeltlichen Ansprüche. Die Rechtsstellung nach Beendigung der Betriebsratstätigkeit wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Freigestellte Betriebsratsmitglieder, Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), Freistellungsberechnung, Auswahlverfahren, Voll- und Teilfreistellung, Rechte und Pflichten, Arbeitnehmerzahl, Mitbestimmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Freigestellten Betriebsratsmitgliedern
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über freigestellte Betriebsratsmitglieder im deutschen Arbeitsrecht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden behandelt?
Das Dokument behandelt die rechtlichen Grundlagen der Freistellung von Betriebsratsmitgliedern, die Berechnung der Anzahl der Freistellungen, die Auswahlverfahren für freigestellte Mitglieder, den Umfang der Freistellung (Voll- und Teilfreistellung) sowie die Rechte und Pflichten freigestellter Betriebsratsmitglieder. Zusätzlich werden rechtliche Aspekte bei Veränderungen der Arbeitnehmerzahl beleuchtet.
Wie wird die Anzahl der freizustellenden Betriebsratsmitglieder berechnet?
Kapitel C befasst sich detailliert mit der Berechnung. Berücksichtigt werden die Anzahl der Arbeitnehmer, die Definition von „regelmäßig“ Beschäftigten, die Abgrenzung des Begriffs „Betrieb“ und Schwellenwerte gemäß § 38 I BetrVG. Zusätzliche Freistellungen durch Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge und der Umgang mit Veränderungen der Arbeitnehmerzahl werden ebenfalls behandelt.
Wie werden freigestellte Betriebsratsmitglieder ausgewählt?
Kapitel D beschreibt das Auswahlverfahren nach § 38 II BetrVG. Es werden unterschiedliche Wahlmethoden (Mehrheitswahl, Verhältniswahl) erläutert und die Rolle der Einigungsstelle im Streitfall sowie die Grenzen der Kompetenz von Betriebsrat und Einigungsstelle thematisiert.
Was ist der Unterschied zwischen Voll- und Teilfreistellung?
Kapitel E behandelt die Dauer der Freistellung und die Unterscheidung zwischen Voll- und Teilfreistellung. Die Berechnung der Freistellungsdauer und die Vor- und Nachteile von Teilfreistellungen bezüglich der Effektivität der Betriebsratsarbeit werden analysiert.
Welche Rechte und Pflichten haben freigestellte Betriebsratsmitglieder?
Kapitel F beschreibt detailliert die Rechte und Pflichten freigestellter Betriebsratsmitglieder. Es werden Haupt- und Nebenleistungspflichten, entgeltliche und unentgeltliche Ansprüche sowie die Rechtsstellung nach Beendigung der Betriebsratstätigkeit behandelt.
Wie wird mit Veränderungen der Arbeitnehmerzahl umgegangen?
Das Dokument behandelt die rechtlichen Aspekte von Veränderungen der Arbeitnehmerzahl im Kontext der Freistellung von Betriebsratsmitgliedern, insbesondere die Auswirkungen von Erhöhung und Verringerung der Mitarbeiterzahl auf die Anzahl der Freistellungen und die entsprechenden Verfahren (Kapitel C).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Freigestellte Betriebsratsmitglieder, Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), Freistellungsberechnung, Auswahlverfahren, Voll- und Teilfreistellung, Rechte und Pflichten, Arbeitnehmerzahl, Mitbestimmung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Dokument enthält Zusammenfassungen zu jedem Kapitel (Kapitel A bis G), die einen Überblick über die behandelten Themen geben. Das detaillierte Inhaltsverzeichnis ermöglicht eine gezielte Suche nach spezifischen Informationen.
- Arbeit zitieren
- Elias Beetz (Autor:in), 2013, Das freigestellte Betriebsratsmitglied, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/266546