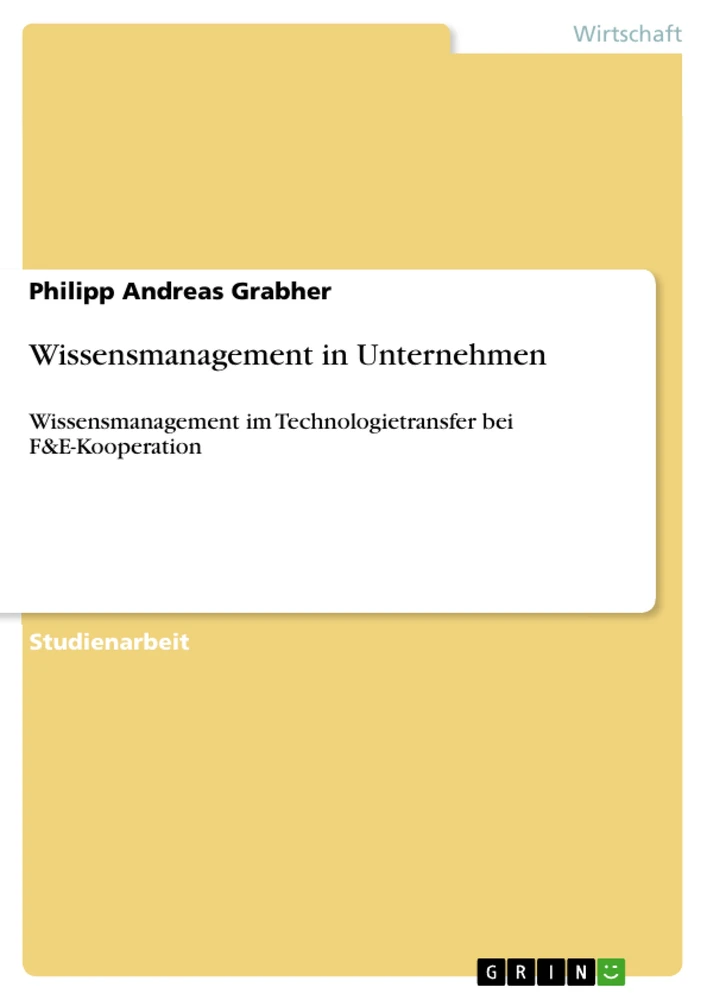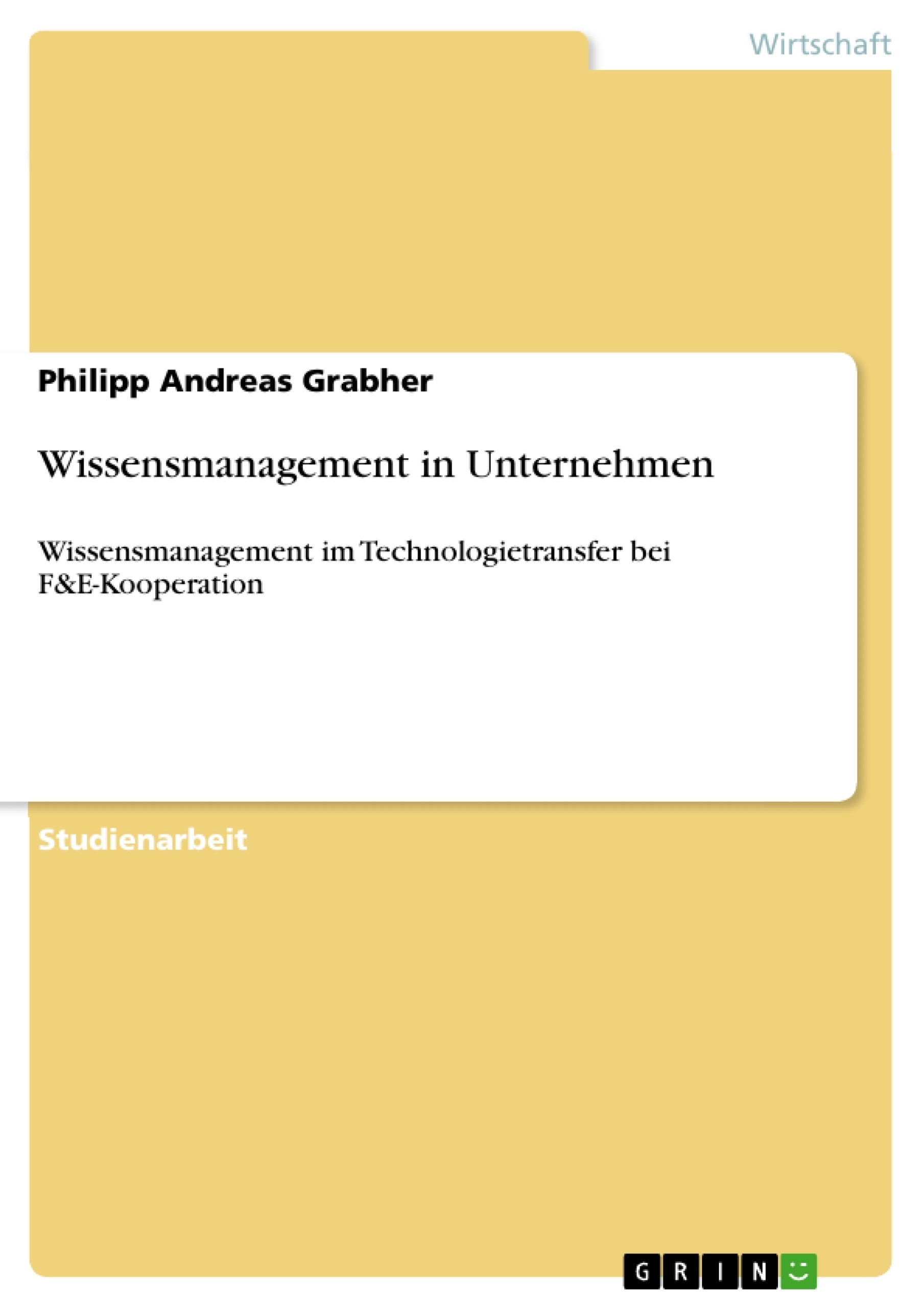,Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens." sagte einst Albert Einstein. Auch jeder Unternehmenserfolg ist vom Austausch des Wissens abhängig und dies gilt heute mehr denn je. Im Sinne des strategischen Managements, wird das Wissen als Ressource betrachtet und somit liegt das Wissen in Organisationen bei dem einzelnen Wissensträger. Oft wird das Wissen der Spezialisten nicht weitergegeben bzw. die Weitergabe erfolgt unter Umständen nur an Personen, von denen der Wissensinhaber meint, dass sie informiert werden müssen. Das Ziel sollte nun sein, eine gewisse Gemeinsamkeit des individuell vorhandenen Wissens zu ermöglichen, um das gemeinsame Verständnis der Fachstellen zu fördern. Diese Betrachtungsweise stellt den Ausgangspunkt des Wissenstransfers in Forschungs- und Entwicklungskooperationen bei Innovationsprojekten dar. In dieser Arbeit sind nicht die Prozesse der elektronischen Datenverarbeitung gemeint, auch wenn diese zum Austausch von Informationen benötigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung des Wissenstransfers in F&E-Kooperationen
- Problematik des Wissenstransfers in F&E-Kooperationen
- Ziel dieser Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen des Wissensmanagements & Wissenstransfers
- Was versteht man unter Wissen?
- Was versteht man unter Wissensmanagement?
- Was versteht man unter Wissenstransfer?
- Informationsverarbeitung und Informationspathologien
- Informationsverarbeitung in Unternehmen
- Informationspathologie - Formen und Ursachen
- Aufklärungsversagen und Informationsversagen
- Vermeidung von Informationspathologien und Informationsversagen
- Missverständnisse im Unternehmen
- Missverstehen im persönlichen Dialog
- Missverstehen in der unternehmensinternen Kommunikation
- Konsequenz der Informationsverarbeitung für den Wissenstransfer
- Informationsmanagement und Wissenstransfer
- Innovation im Unternehmen
- Grundlegendes zum Begriff „Innovation“
- Für den Wissensmanagement bedeutsame Innovationsmerkmale
- Der Innovationsprozess im Unternehmen
- Wissenstransfer im Innovationsmanagement
- Kooperation in Forschung und Entwicklung
- Struktur von F&E-Kooperationen
- Partner in F&E-Kooperationen
- Formen der Kooperation
- Wissenstransfer in F&E-Kooperationen
- Erfolgsfaktoren von Wissenstransferprojekten
- Einfluss der Wissensmerkmale auf den Transfer
- Empfehlungen für die Innovationszusammenarbeit in F&E-Kooperation
- Planung von kooperativer F&E und Innovationszusammenarbeit
- Durchführung und Steuerung der Innovationszusammenarbeit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Bedeutung des Wissensmanagements im Kontext von Forschung und Entwicklung (F&E)-Kooperationen. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen des Wissenstransfers in solchen Kooperationen zu beleuchten und Empfehlungen für eine erfolgreiche Innovationszusammenarbeit zu entwickeln.
- Wissenstransfer in F&E-Kooperationen
- Einflussfaktoren auf den Wissenstransfer
- Herausforderungen und Chancen des Wissensmanagements
- Empfehlungen für die Gestaltung und Steuerung von Innovationszusammenarbeit
- Bedeutung von Informationspathologien und Missverständnissen im Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Wissensmanagements in F&E-Kooperationen ein und erläutert die Bedeutung des Wissenstransfers in diesem Kontext. Kapitel 2 definiert die grundlegenden Begriffe "Wissen", "Wissensmanagement" und "Wissenstransfer". Kapitel 3 befasst sich mit Informationspathologien und Missverständnissen im Unternehmen und deren Auswirkungen auf den Wissenstransfer. Kapitel 4 analysiert die Bedeutung von Informationsmanagement und Wissenstransfer für die Innovation im Unternehmen. Kapitel 5 beleuchtet die Struktur von F&E-Kooperationen und die Herausforderungen des Wissenstransfers in diesem Bereich. Kapitel 6 schließlich bietet Empfehlungen für die Planung, Durchführung und Steuerung der Innovationszusammenarbeit in F&E-Kooperationen.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Wissenstransfer, F&E-Kooperation, Innovationsmanagement, Informationspathologien, Missverständnisse, Erfolgsfaktoren, Empfehlungen, Innovationszusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Wissensmanagement in Unternehmen?
Wissensmanagement betrachtet Wissen als strategische Ressource. Ziel ist es, individuelles Spezialwissen in gemeinsames Verständnis innerhalb der Organisation umzuwandeln.
Warum scheitert Wissenstransfer in F&E-Kooperationen oft?
Häufige Ursachen sind Informationspathologien, Missverständnisse in der Kommunikation und die Tendenz von Spezialisten, Wissen nicht aktiv weiterzugeben.
Was sind Informationspathologien?
Dazu gehören Informationsversagen und Aufklärungsversagen, bei denen relevante Informationen entweder nicht vorhanden sind oder falsch interpretiert werden, was Innovationsprojekte gefährdet.
Welche Rolle spielt Wissenstransfer für Innovationen?
Innovationen leben vom Austausch. Ein effektiver Transfer sorgt dafür, dass neue Erkenntnisse aus der Forschung schnell in marktfähige Produkte umgesetzt werden können.
Wie kann man die Innovationszusammenarbeit verbessern?
Die Arbeit empfiehlt eine strukturierte Planung der Kooperation, die gezielte Steuerung des Wissenstransfers und die Vermeidung von Kommunikationsbarrieren zwischen den Partnern.
- Arbeit zitieren
- Philipp Andreas Grabher (Autor:in), 2012, Wissensmanagement in Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/266173