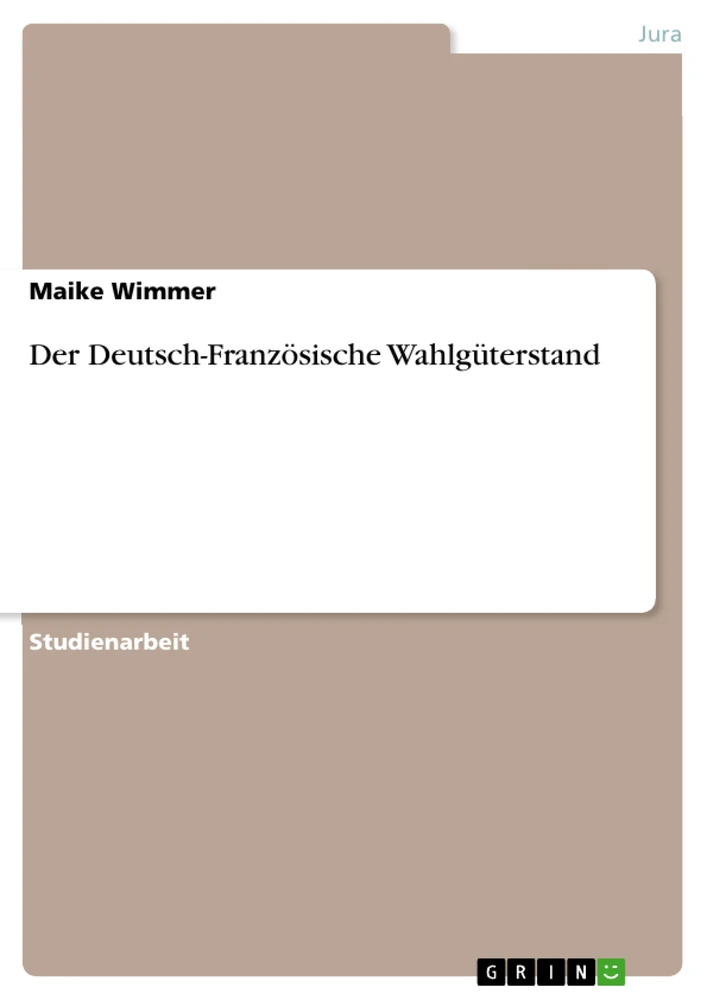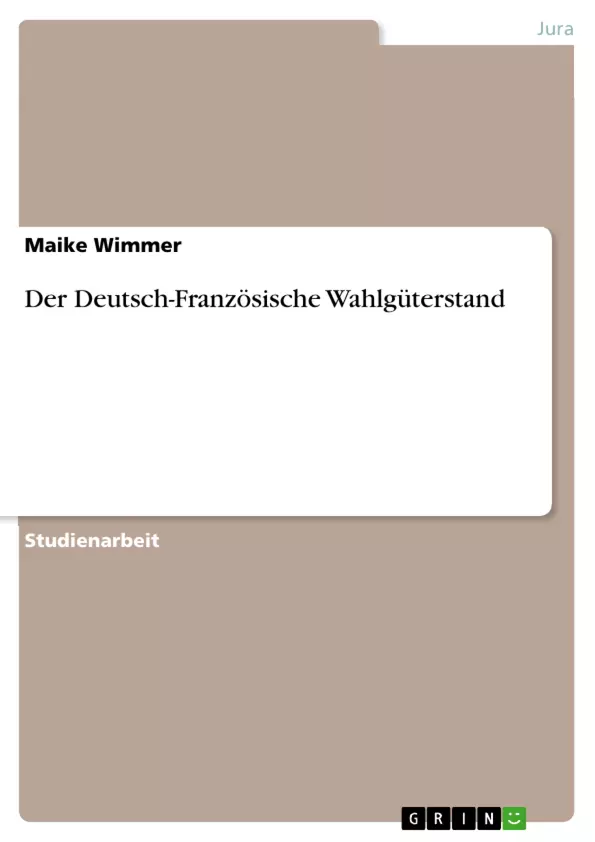Das Abkommen zum Deutsch-Französischen Wahlgüterstand ist ein Produkt 40-jähriger Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich seit der Unterzeichnung des Elysee-Vertrags 1963. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums 2003 gaben der deutsche Bundeskanzler und der französische Staatspräsident eine gemeinsame Erklärung ab, mit dem erklärten Ziel das Zivilrecht bzw. insbesondere das Familienrecht einander inhaltlich annähern zu wollen. Im Zeitraum von 2006–2008 arbeiteten zu diesem Zweck Experten aus Justizministerien, Praktiker und Wissenschaftler zusammen an einer entsprechenden Regelung. Heraus kam dabei der Entwurf eines Deutsch-Französischen Wahlgüterstandes, der am 4. Februar 2010 nach längeren Beratungen mit den Außenministern beider Staaten bei einem deutsch - französischen Gipfeltreffen von den Justizministerinnen Sabine Leutheusser - Schnarrenberger und Mme. Michèle Alliot Marie in Paris unterzeichnet wurde. Die Umsetzung ins nationale Recht durch Deutschland erfolgte im Wege eines dementsprechenden Gesetzesbeschluss am 15. März 2012. In Zukunft wird in Deutschland Ehepaaren nun also ein weiterer Wahlgüterstand zur Auswahl stehen. Im Folgenden soll dieser Deutsch-Französische Wahlgüterstand genauer vorgestellt werden. Dazu wird zunächst auf die Rechtslage vor dem Abkommen, also der tatsächlichen und rechtlichen Ausgangslage in Deutschland und Frankreich eingegangen. Bevor dann die inhaltliche Ausgestaltung des Abkommens näher untersucht wird und ihre Unterschiede zu den Regelungen in Frankreich und Deutschland herausgearbeitet werden, werden vorher die Ziele des Abkommens kurz dargestellt. Nach der inhaltlichen Auseinandersetzung wird anschließend auf die Regelung auf Bundesebene, also die Umsetzung ins nationale Recht und dar-aus resultierende Ungereimtheiten eingegangen, um schließlich die Arbeit mit der Einordnung unter das zugrundeliegende Ehebild und einer kritischen Bewertung des Güterstand bzw. dessen Erfolgschancen in der Zukunft abzurunden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- I. Rechtslage vor dem Abkommen – tatsächliche und rechtliche Ausgangssituation
- 1. Steigende Anzahl binationaler Ehen
- 2. Güterrecht in Deutschland
- 3. Güterrecht in Frankreich
- 4. Gescheiterte Harmonisierungsversuche durch die EU
- II. Ziele des Abkommens
- III. Wahlgüterstand – Inhaltliche Regelungen
- 1. Allgemeines
- 2. Persönlicher Anwendungsbereich
- 3. Definition Wahl – Zugewinngemeinschaft
- 4. Begründung des Güterstandes
- 5. Vermögensverwaltung, -nutzung und -verfügung
- a. Artikel 4 WZGA
- b. Artikel 5 WZGA
- c. Artikel 6 WZGA
- 6. Beendigung des Güterstandes
- 7. Berechnung des Zugewinnausgleichs
- a. Anspruch auf Zugewinnausgleich
- b. Anfangsvermögen
- aa. Zusammensetzung des Anfangsvermögens
- bb. Bewertung des Anfangsvermögens
- c. Endvermögen
- aa. Zusammensetzung des Endvermögens
- bb. Bewertung des Endvermögens
- d. Berechnungszeitpunkt in Sonderfällen
- e. Begrenzung der Zugewinnausgleichsforderung
- 8. Verjährung
- 9. Auskunftspflicht
- 10. Stundung
- 11. Vorzeitiger Zugewinnausgleich
- 12. Sonstiges
- IV. Umsetzung auf Bundesebene
- 1. Änderungen im BGB
- 2. Erbschaft- und Schenkungssteuer
- 3. Verfahrensrecht
- 4. Versorgungsausgleich
- 5. Erstreckung auf Lebenspartner
- 6. Auslegung und Lückenfüllung
- 7. Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht
- V. Zugrundeliegendes Ehebild
- VI. Erfolgschancen/Bewertung
- 1. Vorteile
- 2. Nachteile/Probleme
- 3. Wahlgüterstand als Rechtsvereinheitlichungsmodell
- I. Rechtslage vor dem Abkommen – tatsächliche und rechtliche Ausgangssituation
- C. Schluss/Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Deutsch-Französischen Wahlgüterstand, einem Abkommen, das Ehepaaren mit einem Auslandsbezug einen neuen Güterstand zur Wahl stellt. Die Arbeit untersucht die Rechtslage vor dem Abkommen, die Ziele, die mit der Einführung des Wahlgüterstandes erreicht werden sollen, und die inhaltlichen Regelungen des Abkommens. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Umsetzung auf Bundesebene, das zugrundeliegende Ehebild und die Erfolgschancen des Wahlgüterstandes bewertet.
- Rechtslage vor dem Abkommen in Deutschland und Frankreich
- Ziele des Abkommens zur Verbesserung der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
- Inhaltliche Regelungen des Wahlgüterstandes, insbesondere in Bezug auf die Vermögensverwaltung, -nutzung und -verfügung
- Umsetzung des Abkommens auf Bundesebene und Auswirkungen auf das nationale Recht
- Bewertung des Wahlgüterstandes und seiner Erfolgschancen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Abkommen zum Deutsch-Französischen Wahlgüterstand vor und beschreibt seinen Entstehungshintergrund. Der Hauptteil analysiert die Rechtslage vor dem Abkommen, die Ziele des Abkommens und die inhaltlichen Regelungen des Wahlgüterstandes. Dabei wird insbesondere auf die Vermögensverwaltung, -nutzung und -verfügung, die Beendigung des Güterstandes und die Berechnung des Zugewinnausgleichs eingegangen. Schließlich werden die Auswirkungen der Umsetzung auf Bundesebene, das zugrundeliegende Ehebild und die Erfolgschancen des Wahlgüterstandes bewertet.
Schlüsselwörter
Der Deutsch-Französische Wahlgüterstand, binationale Ehen, Güterrecht, Zugewinngemeinschaft, Errungenschaftsgemeinschaft, Rechtsklarheit, Rechtssicherheit, Vermögensverwaltung, -nutzung und -verfügung, Zugewinnausgleich, Ehebild, Erfolgschancen, Rechtsvereinheitlichung.
- Quote paper
- Maike Wimmer (Author), 2013, Der Deutsch-Französische Wahlgüterstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/264131