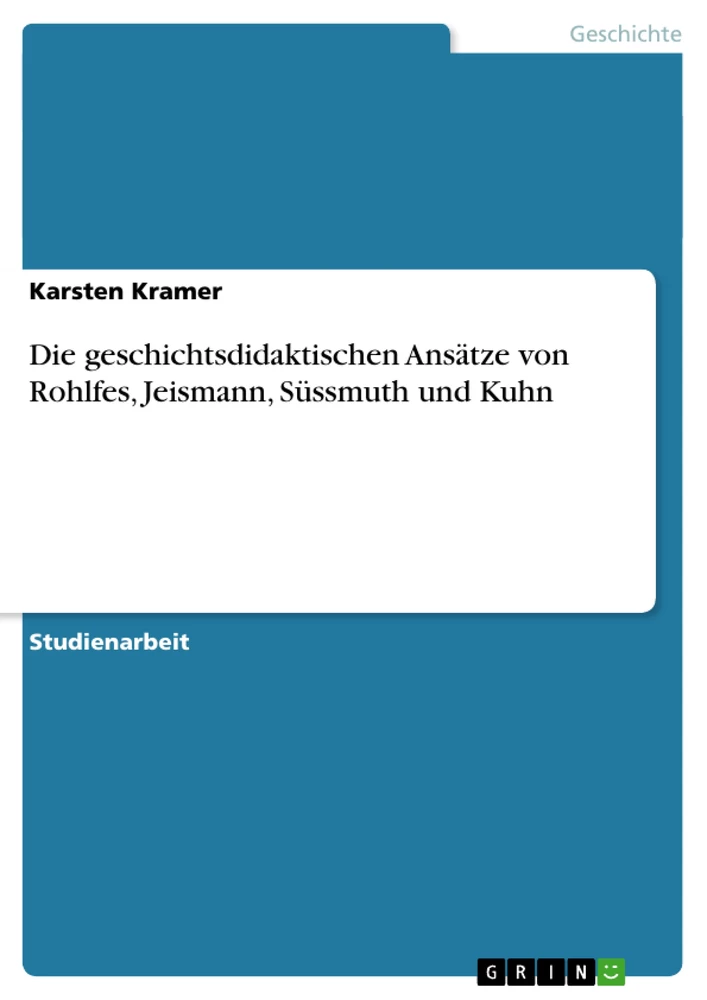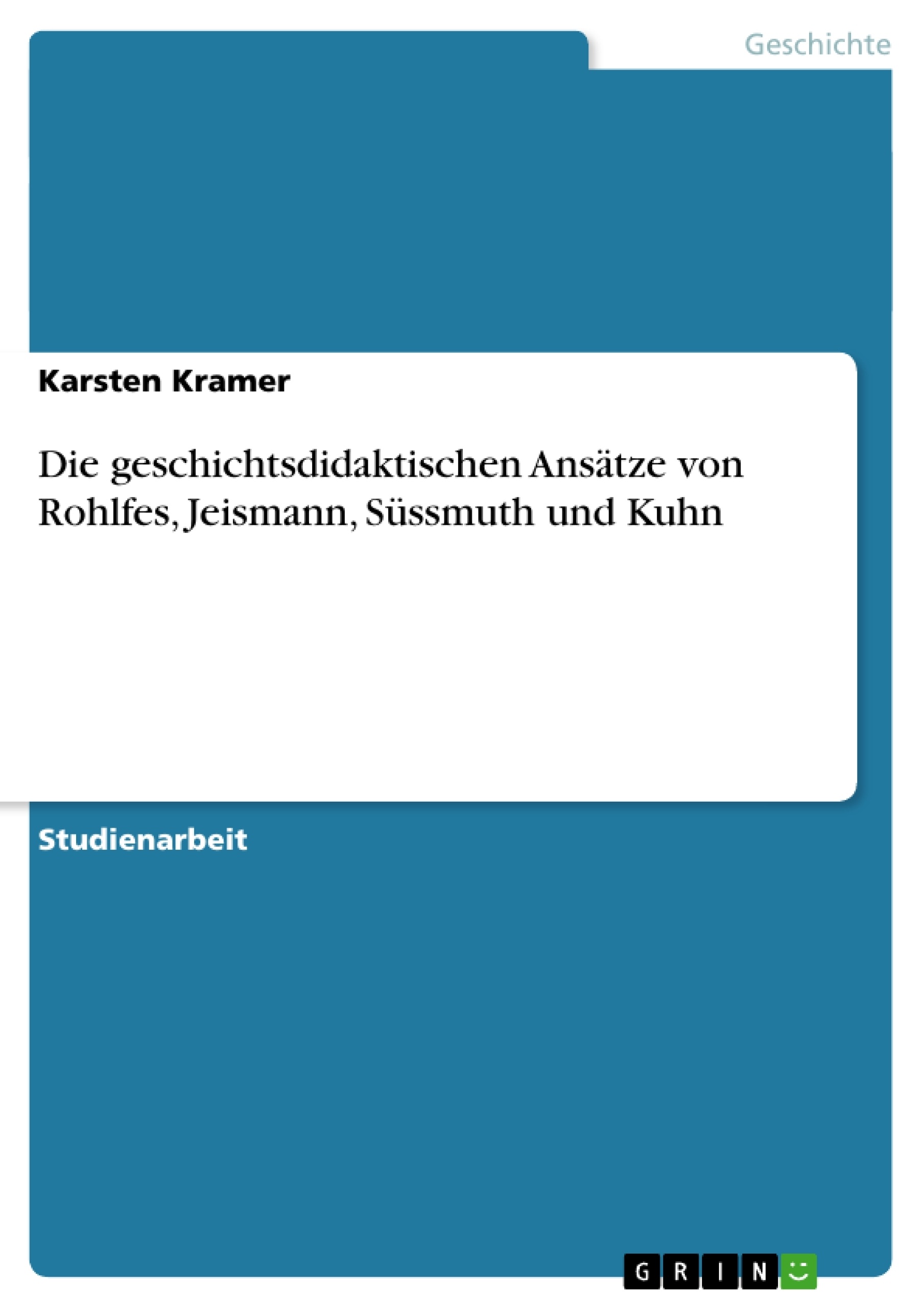Seit den Anfängen eines staatlich verordneten Geschichtsunterrichts in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind unterschiedliche Vorstellungen über die Art des Lehrens und Lernens entwickelt worden.1 Die älteste und lange Zeit am nachhaltigsten wirkende Konzeption stellt die Bildungstheorie dar. Sie sieht ihre Hauptaufgabe darin, Unterrichtsinhalte auszuwählen, zu strukturieren und für das Verständnis bestimmter Altersstufen zuzubereiten. Ausschlaggebend hierbei ist der Bildungsgehalt, d. h. nicht der Gegenstand als solcher, sondern die an ihm und in ihm zu gewinnenden Einsichten und Gesetzmäßigkeiten wirken bildend. Als bildungstheoretisches Kardinalproblem erweist sich die Ermittlung pädagogisch gültiger Kriterien bei der Auswahl von Unterrichtsinhalten. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass sich die Bildungstheorie jeglicher Normenkritik enthält und die herrschenden zeit- und gesellschaftstypischen Erziehungsziele und -formen als unumstößliche Tatsachen betrachtet.2 Bis in die späten 1960er Jahre hinein waren Geschichtsdidaktik und Bildungstheorie nahezu identisch. [...] 1 vgl.: Kuhn / Rothe 1980, S. 42.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtsdidaktische Positionen
- Der pragmatisch-eklektische Ansatz von Joachim Rohlfes
- Der Ansatz von Karl-Ernst Jeismann: „Geschichtsbewußtsein“ als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik
- Der strukturgeschichtliche Ansatz von Hans Süssmuth
- Der Ansatz von Annette Kuhn: Kritisch-kommunikative Geschichtsdidaktik in emanzipatorischer Absicht
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit vier einflussreichen geschichtsdidaktischen Ansätzen von Rohlfes, Jeismann, Süssmuth und Kuhn. Sie analysiert die Spezifika dieser Ansätze und beleuchtet, wie sie die Diskussion um die Geschichtsdidaktik der damaligen Zeit geprägt haben. Der Fokus liegt auf den jeweiligen Zielsetzungen, der Abgrenzung zu anderen Ansätzen und den einflussreichen Faktoren, die die Entwicklung der Ansätze beeinflusst haben.
- Die Bedeutung des Geschichtsbewußtseins in der heutigen Gesellschaft
- Die Relevanz von Fachwissenschaft und Lernforschung für die Geschichtsdidaktik
- Die Rolle der Bildungstheorie im Geschichtsunterricht
- Die Bedeutung der Operationalisierung von Lernzielen im Geschichtsunterricht
- Die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung skizziert die Entwicklung des Geschichtsunterrichts in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet die dominierende Rolle der Bildungstheorie und die damit verbundenen Kritikpunkte. Die Einleitung beschreibt auch die Entstehung einer Krise des historischen Denkens in den späten 1960er Jahren und die daraus resultierenden Impulse für die Geschichtsdidaktik.
Der pragmatisch-eklektische Ansatz von Joachim Rohlfes
Dieser Abschnitt stellt den Ansatz von Joachim Rohlfes vor. Rohlfes definiert Geschichtsdidaktik als ein umfassendes Feld, das sich nicht nur mit der Methodik des historischen Unterrichts beschäftigt, sondern auch mit den wissenschaftstheoretischen und fachwissenschaftlichen Grundlagen des Faches Geschichte. Sein Ansatz zeichnet sich durch die Integration von Bildungstheorie, Lerntheorie und Fachwissenschaft aus.
Der Ansatz von Karl-Ernst Jeismann: „Geschichtsbewußtsein“ als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik
Dieser Abschnitt beleuchtet den Ansatz von Karl-Ernst Jeismann. Jeismann sieht das Geschichtsbewußtsein als den zentralen Aspekt der Geschichtsdidaktik. Er argumentiert, dass Geschichtsdidaktik nicht nur den schulischen Unterricht umfasst, sondern auch die gesellschaftlichen Denkmuster und ihre Entstehungsprozesse untersucht.
- Quote paper
- Karsten Kramer (Author), 2004, Die geschichtsdidaktischen Ansätze von Rohlfes, Jeismann, Süssmuth und Kuhn, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/26361