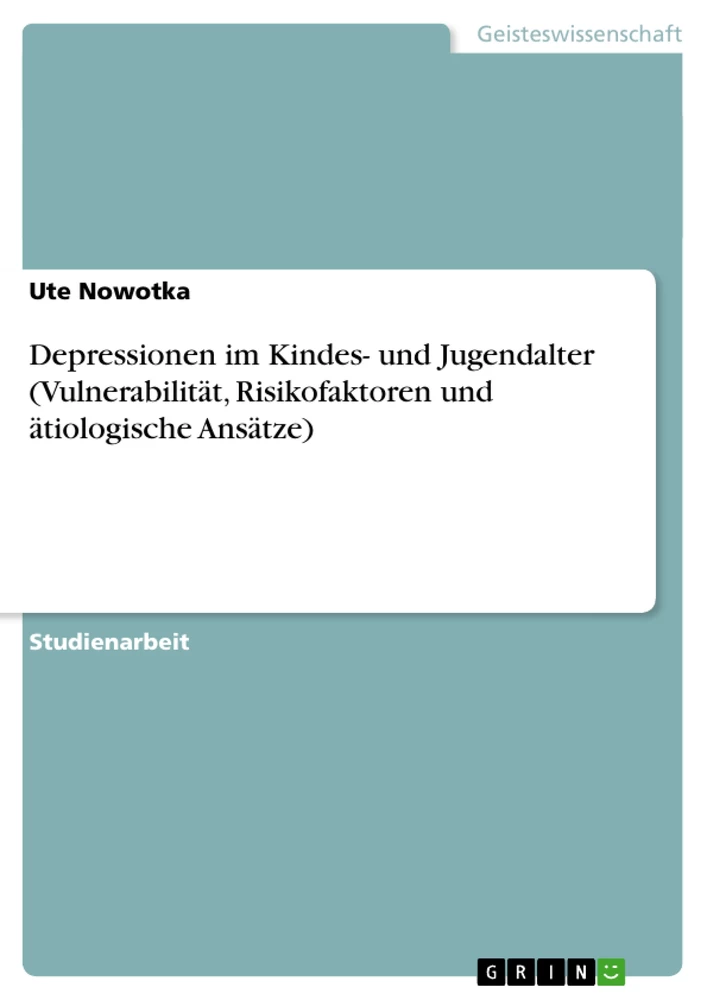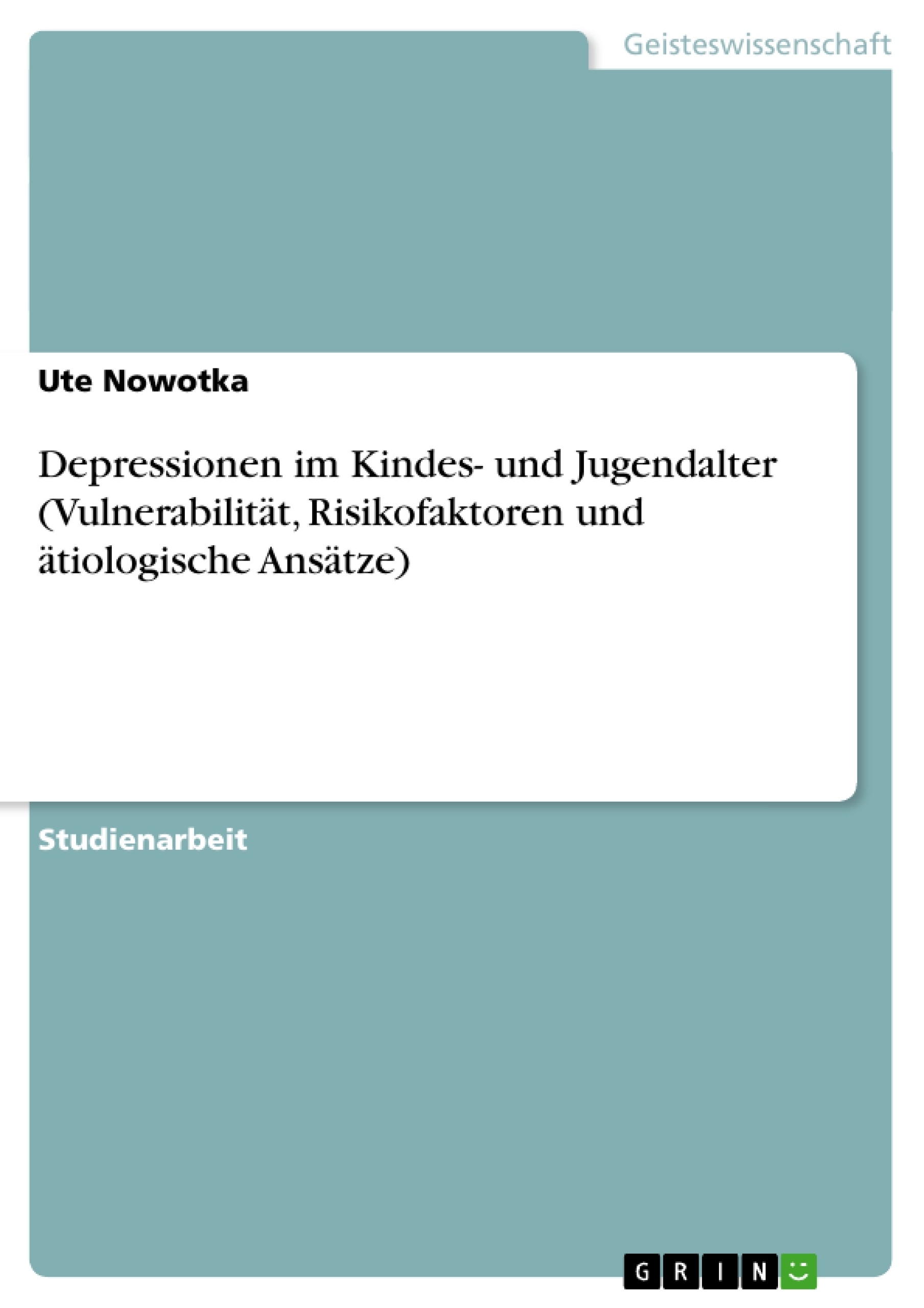„Bis vor drei Jahrzehnten war man davon überzeugt, dass Depression bei Kindern und
Jugendlichen nicht existiert oder nur sehr selten auftritt. Wenn sie überhaupt nicht existiert,
nahm man an, dass es sich dabei um vorübergehende Erfahrungen handelt, die mit dem
normalen Entwicklungsprozess zusammen hängen.“ (Essau, 2002, S.11)
In den späten siebziger und frühen achtziger Jahren trat mit den ersten ernst zu nehmenden
Studien über Depressionen bei Kindern und Jugendlichen eine Wende ein, die die zähe
Vorherrschaft des Dogmatismus, dass nicht ist, was nicht sein darf, beendete. Vor allem nach
psychodynamischen Modellvorstellungen war die Existenz von Depressionen bei Kindern
indiskutabel, da das Über-Ich, das bei Kindern erst in der Entwicklung begriffen ist, eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung einer Depression spiele. Depressive Störungen im Kindesund
Jugendalter wurden generell als Entwicklungsschwierigkeiten eingestuft. Kinder und
Jugendliche weisen jedoch in den meisten Fällen eine ähnliche, wenn nicht vergleichbare
Psychopathologie wie Erwachsene auf, so dass man kaum – wie einst – von „larvierten“
Depressionen sprechen kann. Da mag es auch nicht verwundern, dass die Aufmerksamkeit
gegenüber depressiven Symptomen im frühen Lebensabschnitt während der letzten Jahre
enorm zugenommen hat und auch vermehrt literarische Zeugnisse über depressive
Erscheinungsbilder bei Kindern und Jugendlichen, sogar aus der Antike, zutage treten.
Mit dem DSM-III (1980) stieg die Zahl der diesbezüglichen Untersuchungen aufgrund des
wachsenden Interesses an diesem neu aufgeschlossenen Themenbereich rapide an. Allgemeine
und bis heute bestätigte Befunde sprechen dafür, dass depressive Störungen Erwachsener in
den meisten Fällen in der Jugend bzw. Kindheit wurzeln, dass also frühe depressive Episoden
die Wahrscheinlichkeit für eine spätere Depression erhöhen. Wie Nissen schreibt, ist die
Depression, „ganz gleich, ob psychopathologische, lerntheoretische, humangenetische oder
metabolische Entstehungshypothesen herangezogen werden, eine Krankheit, die schon im
Kindesalter latent, als ‚Keim’, als ‚Vorform’ oder als ‚Struktur’ vorhanden ist.“ (Nissen, 2002,
S.198)
Häufig wird die Depression als die „gewöhnliche Grippe der Psychopathologie“ bezeichnet.
Und nach Ansicht vieler Autoren befinden wir uns momentan im „Zeitalter der Melancholie“. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Überblick
- Allgemeines zum klinischen Störungsbild der Depression
- Begriffsklärung und Symptomatik
- Diagnostik
- Komorbidität
- Epidemiologie
- Theoretische Modelle
- Psychodynamisch
- Kognitiv
- Lerntheoretisch
- Multifaktoriell
- Biologisch
- Ätiologische Aspekte und Risikofaktoren
- Biologische Faktoren
- Genetik
- Neurobiologische Dysfunktionen
- Psychosoziale/umweltbedingte Faktoren
- Kritische Lebensereignisse und chronische Belastungen
- Familiäre Einflüsse – psychische Störung der Eltern
- Soziale Beziehungen
- Merkmale des Betroffenen/Persönlichkeitsfaktoren
- Temperament
- Geschlecht
- Alter
- Bewältigungsstrategien
- Kognitive Faktoren
- Biologische Faktoren
- Protektive Faktoren
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Depression im Kindes- und Jugendalter. Sie beleuchtet die Entwicklung des Verständnisses dieser Erkrankung und geht auf die unterschiedlichen Perspektiven ein, die die Entstehung und die Auswirkungen von Depression im jungen Alter erklären.
- Entwicklung des Verständnisses von Depression im Kindes- und Jugendalter
- Theoretische Modelle zur Erklärung von Depressionen
- Ätiologische Aspekte und Risikofaktoren für die Entwicklung von Depressionen
- Protektive Faktoren, die vor der Entstehung von Depressionen schützen können
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die einen Überblick über das Thema Depression im Kindes- und Jugendalter gibt und die historische Entwicklung des Verständnisses dieser Erkrankung beleuchtet. Anschließend werden verschiedene theoretische Modelle zur Erklärung von Depressionen vorgestellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit den ätiologischen Aspekten und Risikofaktoren, die mit der Entstehung von Depressionen in Verbindung gebracht werden. Im vierten Kapitel werden protektive Faktoren behandelt, die vor der Entstehung von Depressionen schützen können. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Forschungsgebiete.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der klinischen Psychologie, insbesondere mit der Entwicklung und den Ursachen von Depression im Kindes- und Jugendalter. Schlüsselbegriffe sind dabei: Depression, Vulnerabilität, Risikofaktoren, ätiologische Ansätze, psychosoziale Faktoren, biologische Faktoren, kognitive Faktoren, protektive Faktoren, Entwicklungspsychopathologie.
- Arbeit zitieren
- Ute Nowotka (Autor:in), 2003, Depressionen im Kindes- und Jugendalter (Vulnerabilität, Risikofaktoren und ätiologische Ansätze), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/25032