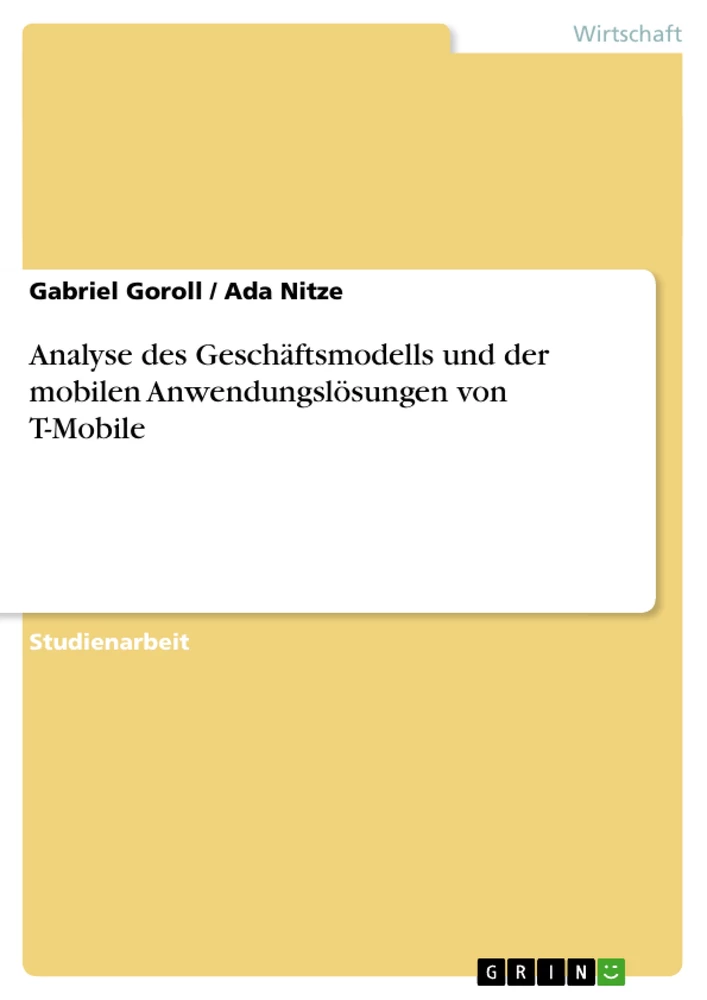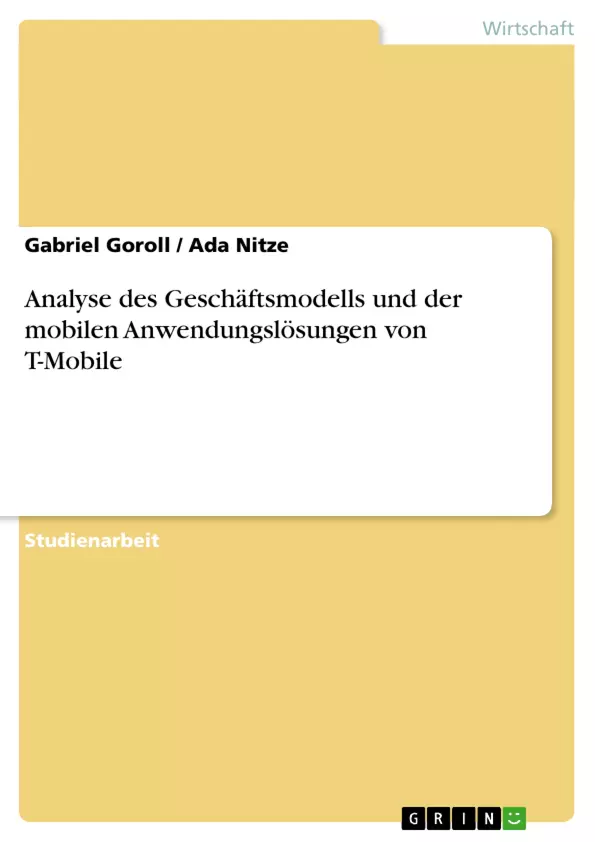Diese Seminararbeit stellt die schriftliche Ausarbeitung der Präsentation „Analyse des
Geschäftsmodells und der mobilen Anwendungslösungen von T-Mobile“ im Kurs Mobile
Business bei Prof. Dr. Walter Gora im Sommersemester 2003 dar. Es existieren
vergleichend dazu Seminararbeiten zu den Unternehmen Vodafone und O2.
Präsentation und Hausarbeit sind, der expliziten Aufgabenstellung folgend, inhaltlich
nach den Partialmodellen des integrierten Geschäftsmodells von Wirtz1 strukturiert.
Wirtz definiert ein Geschäftsmodell als die Darstellung des betrieblichen Leistungssystems
einer Unternehmung. Das Modell beschreibt „... welche externen Ressourcen in die Unternehmung
fließen und wie diese durch den innerbetrieblichen Leistungserstellungsprozess in vermarktungsfähige
Informationen, Produkte und/oder Dienstleistungen transformiert werden.“2 Gleichzeitig
werden Aussagen getroffen, durch welche Kombination der Produktionsfaktoren die
Geschäftsstrategie umgesetzt werden soll und welche Funktion den involvierten Teilnehmern
dabei zukommt.3
In den nachfolgenden Kapiteln wird das Unternehmen T-Mobile Deutschland nach den
Partialmodellen – Markt-, Beschaffungs-, Leistungserstellungs-, Leistungsangebots-,
Distributions- und Kapitalmodell – analysiert. Da T-Mobile in eine Konzernstruktur
eingegliedert ist, werden teilweise die Mutterfirma T-Mobile International und der Konzern
Deutsche Telekom mit einbezogen.
1 vgl. Wirtz, B.W. (2001), S.51
2 vgl. vgl. Gora (2003), Teil 5 Folie 24
3 vgl. Wirtz, B.W. (2001), S.50f
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Marktmodell
- 2.1 Das Unternehmen T-Mobile und die Konzernstruktur der Deutschen Telekom
- 2.2 Marktsituation
- 2.3 Wettbewerber und Wettbewerbsintensität
- 2.4 SWOT-Analyse
- 2.4.1 Stärken
- 2.4.2 Schwächen
- 2.4.3 Chancen
- 2.4.4 Risiken
- 3 Beschaffungsmodell
- 3.1 Lagebericht der Deutschen Telekom 2002 – Einkauf
- 3.2 Partnerschaften und Kooperationen
- 3.2.1 Content
- 3.2.2 Roaming
- 3.2.3 Partnerschaften mit Systemintegratoren
- 3.2.4 Entwicklungspartnerschaften
- 3.3 Mobile Wertschöpfungskette
- 4 Leistungserstellungsmodell
- 5 Leistungsangebotsmodell
- 5.1 Das 4-C Modell
- 5.2 Content
- 5.2.1 t-zones
- 5.2.2 MyLounge
- 5.3 Commerce
- 5.4 Connection
- 5.4.1 Business to Consumer (B2C)
- 5.4.2 Business to Business (B2B)
- 5.5 Context
- 6 Distributionsmodell
- 6.1 Kundenstruktur
- 6.2 Standorte und Service
- 6.3 Vertriebsstruktur
- 7 Kapitalmodell
- 7.1 Erlösmodell
- 7.2 Finanzielle Kenndaten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Geschäftsmodell und die mobilen Anwendungslösungen von T-Mobile. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte des Geschäftsmodells zu untersuchen und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens im Kontext des Marktes zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Wertschöpfungskette, das Leistungsangebot und die Distributionsstrategie von T-Mobile.
- Analyse des Geschäftsmodells von T-Mobile
- Untersuchung der mobilen Anwendungslösungen
- Bewertung der Marktposition und des Wettbewerbs
- Erlösmodell und finanzielle Kenndaten
- Bedeutung von Partnerschaften und Kooperationen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit dar und definiert die Forschungsfrage. Es beschreibt den Fokus auf die Analyse des Geschäftsmodells und der mobilen Anwendungslösungen von T-Mobile und umreißt die Methodik der Untersuchung.
2 Marktmodell: Der zweite Abschnitt liefert einen umfassenden Überblick über den Markt für Mobilfunk in Deutschland und Europa. Er analysiert die Marktposition von T-Mobile im Kontext der Konzernstruktur der Deutschen Telekom, beschreibt die Wettbewerbslandschaft und führt eine detaillierte SWOT-Analyse durch, um Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Unternehmens zu identifizieren. Die Analyse der Wettbewerber und deren Marktanteile bildet einen wichtigen Bestandteil dieses Kapitels.
3 Beschaffungsmodell: Dieses Kapitel beleuchtet die Beschaffungsstrategie von T-Mobile, beginnend mit der Analyse des Lageberichts der Deutschen Telekom. Ein Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Partnerschaften und Kooperationen, die T-Mobile eingeht, um Content, Roaming-Dienste und technologische Innovationen zu ermöglichen. Die mobile Wertschöpfungskette wird detailliert beschrieben und analysiert.
4 Leistungserstellungsmodell: Das Kapitel beschreibt die mehrschichtige Leistungserstellung von T-Mobile. Es geht auf die internen Prozesse und Ressourcen ein, die notwendig sind, um die angebotenen Dienstleistungen zu erbringen.
5 Leistungsangebotsmodell: Hier wird das Leistungsangebot von T-Mobile im Detail analysiert, mit dem Fokus auf das 4-C-Modell (Customer, Cost, Convenience, Communication). Die Kapitel betrachten die verschiedenen Content-Angebote (t-zones, MyLounge), Commerce-Aktivitäten, Connection-Strategien (B2C und B2B) und den Context des Angebots. Die Interdependenzen zwischen den einzelnen Elementen des 4-C-Modells werden herausgearbeitet.
6 Distributionsmodell: Dieses Kapitel analysiert die Vertriebsstrategie von T-Mobile, einschließlich der Kundenstruktur, der Standorte und des Serviceangebots. Die Vertriebsstruktur wird detailliert dargestellt und die verschiedenen Vertriebskanäle werden im Hinblick auf ihre Marktanteile untersucht. Es wird die Frage nach der Effektivität der Vertriebskanäle beleuchtet.
7 Kapitalmodell: Der letzte analysierte Abschnitt befasst sich mit dem Erlösmodell und den finanziellen Kenndaten von T-Mobile. Die wichtigsten Einnahmequellen werden erläutert und die finanzielle Performance des Unternehmens wird analysiert. Dies beinhaltet u.a. die Betrachtung von Umsatzzahlen und Marktanteilen.
Schlüsselwörter
T-Mobile, Geschäftsmodell, mobile Anwendungslösungen, Marktmodell, SWOT-Analyse, Wettbewerbsintensität, Beschaffungsmodell, Partnerschaften, Kooperationen, Wertschöpfungskette, Leistungserstellungsmodell, Leistungsangebotsmodell, 4-C-Modell, Content, Commerce, Connection, Context, Distributionsmodell, Kundenstruktur, Vertriebsstruktur, Kapitalmodell, Erlösmodell, Finanzielle Kenndaten, Deutsche Telekom.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Geschäftsmodell und mobile Anwendungslösungen von T-Mobile
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das Geschäftsmodell und die mobilen Anwendungslösungen von T-Mobile. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der verschiedenen Aspekte des Geschäftsmodells und der strategischen Entscheidungen des Unternehmens im Kontext des Marktes. Schwerpunkte sind die Wertschöpfungskette, das Leistungsangebot und die Distributionsstrategie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Analyse des T-Mobile Geschäftsmodells, einschließlich Marktmodell (mit SWOT-Analyse und Wettbewerberanalyse), Beschaffungsmodell (mit Fokus auf Partnerschaften und Kooperationen), Leistungserstellungsmodell, Leistungsangebotsmodell (basierend auf dem 4-C-Modell), Distributionsmodell und Kapitalmodell (mit Erlösmodell und Finanzdaten). Die mobilen Anwendungslösungen von T-Mobile werden ebenfalls untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: 1. Problemstellung, 2. Marktmodell, 3. Beschaffungsmodell, 4. Leistungserstellungsmodell, 5. Leistungsangebotsmodell, 6. Distributionsmodell und 7. Kapitalmodell. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Geschäftsmodells von T-Mobile und bietet eine detaillierte Analyse.
Was wird im Kapitel "Marktmodell" behandelt?
Das Kapitel "Marktmodell" liefert einen Überblick über den deutschen und europäischen Mobilfunkmarkt. Es analysiert die Marktposition von T-Mobile im Kontext der Deutschen Telekom, untersucht die Wettbewerbslandschaft und führt eine detaillierte SWOT-Analyse durch, die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von T-Mobile identifiziert.
Was wird im Kapitel "Beschaffungsmodell" behandelt?
Das Kapitel "Beschaffungsmodell" beleuchtet die Beschaffungsstrategie von T-Mobile, basierend auf dem Lagebericht der Deutschen Telekom. Es konzentriert sich auf Partnerschaften und Kooperationen bezüglich Content, Roaming, Systemintegratoren und Entwicklung. Die mobile Wertschöpfungskette wird detailliert analysiert.
Was wird im Kapitel "Leistungsangebotsmodell" behandelt?
Das Kapitel "Leistungsangebotsmodell" analysiert das Leistungsangebot von T-Mobile anhand des 4-C-Modells (Customer, Cost, Convenience, Communication). Es untersucht Content-Angebote (t-zones, MyLounge), Commerce-Aktivitäten, Connection-Strategien (B2C und B2B) und den Context des Angebots.
Was wird im Kapitel "Distributionsmodell" behandelt?
Das Kapitel "Distributionsmodell" analysiert die Vertriebsstrategie von T-Mobile, einschließlich Kundenstruktur, Standorte, Service und Vertriebsstruktur. Es untersucht die verschiedenen Vertriebskanäle und deren Effektivität.
Was wird im Kapitel "Kapitalmodell" behandelt?
Das Kapitel "Kapitalmodell" befasst sich mit dem Erlösmodell und den finanziellen Kenndaten von T-Mobile. Es erläutert die wichtigsten Einnahmequellen und analysiert die finanzielle Performance, inklusive Umsatzzahlen und Marktanteile.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: T-Mobile, Geschäftsmodell, mobile Anwendungslösungen, Marktmodell, SWOT-Analyse, Wettbewerbsintensität, Beschaffungsmodell, Partnerschaften, Kooperationen, Wertschöpfungskette, Leistungserstellungsmodell, Leistungsangebotsmodell, 4-C-Modell, Content, Commerce, Connection, Context, Distributionsmodell, Kundenstruktur, Vertriebsstruktur, Kapitalmodell, Erlösmodell, Finanzielle Kenndaten, Deutsche Telekom.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, das Geschäftsmodell von T-Mobile und seine mobilen Anwendungslösungen zu analysieren und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens im Marktkontext zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Gabriel Goroll (Autor:in), Ada Nitze (Autor:in), 2003, Analyse des Geschäftsmodells und der mobilen Anwendungslösungen von T-Mobile, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/24743