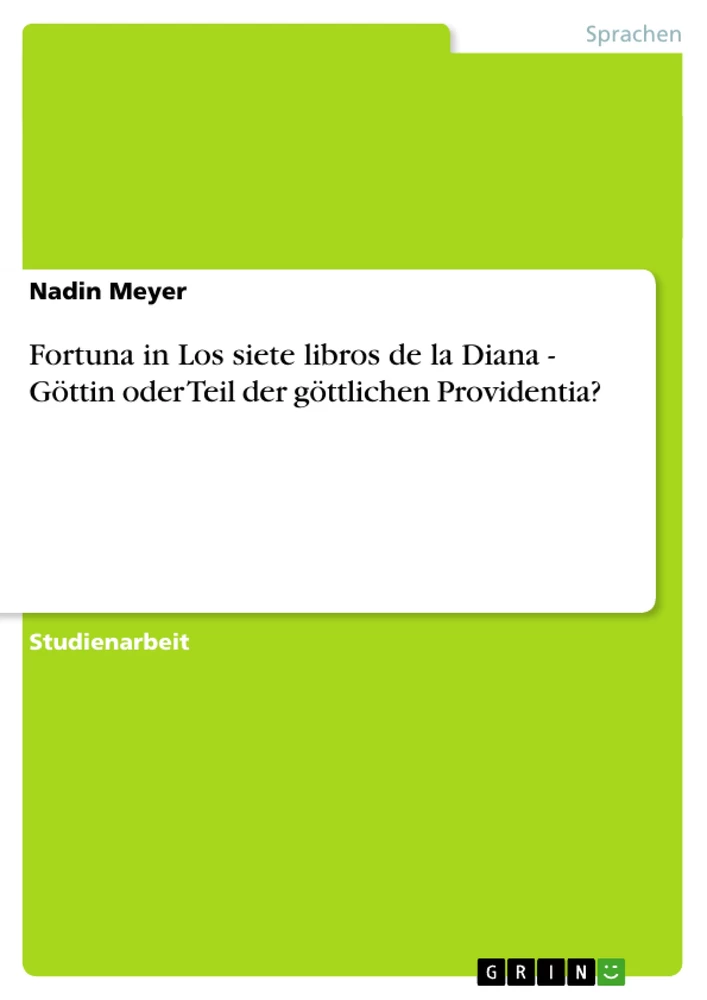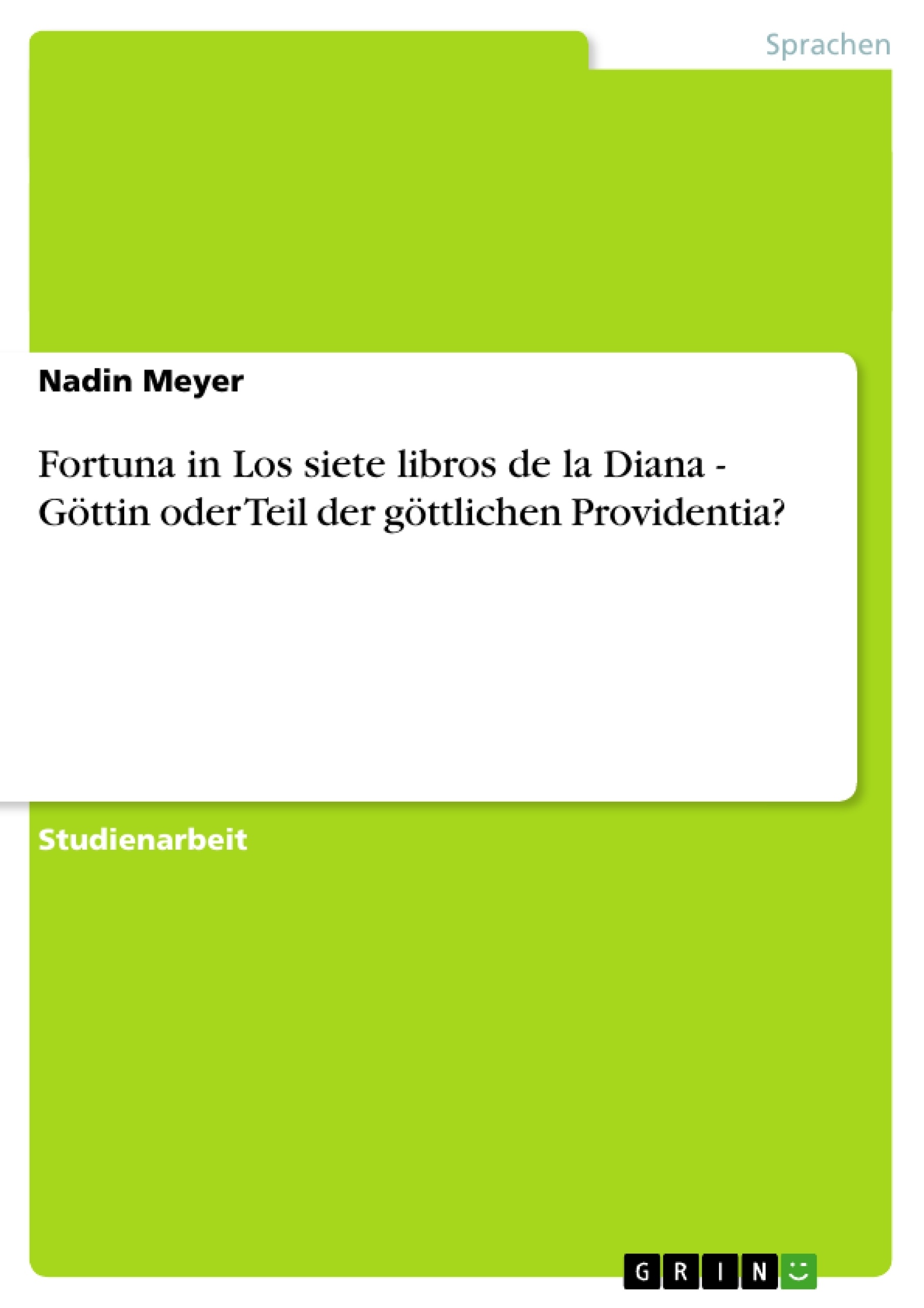Der Schäferroman als solcher blickt auf eine lange Tradition zurück, denn bereits die Antike
kennt die Hirtendichtung und schon während des Hellenismus entstand der Hirten- bzw.
Schäferroman, erhalten ist hier jedoch nur “Daphnis und Chloë“ von Longos.1
Im Zuge der Antikerezeption während der italienischen und französischen Renaissance wird
auch die Hirtendichtung abermals zum Leben erweckt und gelangt so zu neuer Blüte.2 Dabei
steht die Schäferdichtung
in Wechselbeziehung zu der bis zum Beginn des 17. Jh.s
verbreiteten europäischen Mode der “Schäferei“ als aristokratisches
Gesellschaftsspiel [...]. Die literarische Hirtenwelt wird [...] immer mehr
zur manieristisch gestalteten konventionellen Fiktion, die [...]
Spielart eines schäferlich kostümierten höfischen Lebens und seiner
verfeinerten Sitten ist.“3
Am Ritterroman, insbesondere am “Amadís“, orientiert, entsteht eine neue Form des
Schäferromans, dessen Figuren, im Gegensatz zu den Protagonisten des Ritterromans und
denen des hellenistischen Hirtenromans, ein weitestgehend ungefährliches Leben führen. Sie
sehen sich nicht mit bedrohlichen Situationen konfrontiert und befinden sich in einem
natürlich-harmonischen Umfeld. Die einzige Problematik, der sie sich stellen müssen, besteht
in den Leiden der Liebe, wobei die unerwiderte Liebe das größte Unglück bedeutet.4
Da der Schäferroman sich, wie zuvor auch die Schäferdichtung, an ein adeliges Publikum
richtete, blieb die überwiegend normierte Liebeshandlung dem höfischen Gesellschaftsideal
unterworfen. 5
Nichtsdestotrotz oder vielleicht auch gerade deswegen erreichte die Gattung eine äußerst hohe
Breitenwirksamkeit und war insbesondere beim weiblichen Publikum derart populär, daß Fray
Pedro Malón de Chaide spöttelte: “¿ Que ha de hacer la doncellita que apenas sabe andar, y
ya trae una Diana en la faldriquera?“6 [...]
1Metzler Literaturlexikon, Stichwörter zur Weltliteratur, Hg. G. Schweikle/I. Schweikle, Stuttgart,
1984, 387
2 Metzler Literaturlexikon,1984, 387
3 Metzler Literaturlexikon,1984, 387
4 Spanische Literaturgeschichte, Hg. H.-J. Neuschäfer, Stuttgart, 1997, 127-128
5 Metzler Literaturlexikon,1984, 388
6 J. C. Nieto, El Renacimiento y la otra España, Visión cultural socioespiritual, Genève,
1997, 553
Inhaltsverzeichnis
- I. Der Schäferroman - Einleitung
- II. Die Geschichte der Göttin Fortuna
- II.1. Fortuna in der Antike
- II.2. Fortuna im Mittelalter
- II.3. Fortuna in der Renaissance
- III. Fortuna in Los siete libros de la Diana
- IV. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Stellenwert der Göttin Fortuna in Jorge de Montemayors "Los siete libros de la Diana". Die Arbeit verfolgt das Ziel, Fortunas Rolle zu klären: Ist sie eine eigenständige Göttin oder lediglich ein Aspekt der göttlichen Vorsehung? Hierzu wird die Entwicklung des Fortuna-Bildes von der Antike über das Mittelalter bis in die Renaissance nachgezeichnet.
- Der Schäferroman in der spanischen Renaissance
- Die Entwicklung des Fortuna-Konzeptes über verschiedene Epochen
- Fortunas Attribute und Symbole
- Der Einfluss der Antike auf die Renaissance-Literatur
- Fortuna in "Los siete libros de la Diana"
Zusammenfassung der Kapitel
I. Der Schäferroman - Einleitung: Der einführende Kapitel beleuchtet die lange Tradition des Schäferromans, beginnend mit der antiken Hirtendichtung und deren Wiederaufleben während der Renaissance. Es wird die Beziehung zwischen der literarischen Schäferwelt und dem aristokratischen Gesellschaftsspiel der "Schäferei" hervorgehoben. Der Text beschreibt den Schäferroman als eine neue Form, die sich am Ritterroman orientiert, aber im Gegensatz zu diesem, ein ungefährliches und harmonisches Leben für seine Protagonisten darstellt. Die zentralen Konflikte drehen sich um die Leiden der Liebe, wobei unerwiderte Liebe als größtes Unglück gilt. Die normative Liebeshandlung ist dem höfischen Ideal unterworfen, trotzdem oder gerade deswegen erlangte die Gattung eine große Beliebtheit, besonders bei weiblichen Lesern. "Los siete libros de la Diana" wird als gattungs- und modebildendes Werk für den Schäferroman dargestellt, vergleichbar mit dem "Amadis" für den Ritterroman.
II. Die Geschichte der Göttin Fortuna: Dieses Kapitel untersucht die Geschichte der Schicksalsgöttin Fortuna, beginnend mit ihrer Darstellung in der Antike. Es wird erläutert, dass Fortuna als Göttin des Überflusses, der Fruchtbarkeit und des glücklichen Gewinns verehrt wurde, jedoch auch ihre frühesten Kultformen und ihre enge Beziehung zu anderen Gottheiten, wie der Mater Matuta, thematisiert. Der Aufstieg Fortunas zur römischen Nationalgöttin wird beschrieben, ebenso ihre vielfältigen Bezeichnungen und Attribute (z.B. Fortuna muliebris, Fortuna virilis), die ihre verschiedenen Rollen und Zuständigkeiten widerspiegeln. Die Entwicklung und die Veränderungen des Fortuna-Bildes im Zuge des religiösen Synkretismus während der römischen Kaiserzeit werden detailliert dargestellt, einschließlich ihrer Verbindung mit Isis und Merkur. Der Text betont die Verschmelzung von Fortuna mit der griechischen Tyche im Hellenismus, wodurch Fortuna an Tiefe und Komplexität gewinnt.
Schlüsselwörter
Schäferroman, Spanische Renaissance, Fortuna, Tyche, Göttliche Providentia, Mythologie, Antike, Mittelalter, Renaissance, Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana, Literaturgeschichte, höfisches Gesellschaftsideal, Liebesleid, Schicksal, Zufall.
Häufig gestellte Fragen zu "Los siete libros de la Diana" und Fortuna
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Stellenwert der Göttin Fortuna in Jorge de Montemayors Werk "Los siete libros de la Diana". Im Fokus steht die Klärung von Fortunas Rolle: Ist sie eine eigenständige Göttin oder ein Aspekt der göttlichen Vorsehung? Die Arbeit verfolgt dies anhand der Entwicklung des Fortuna-Bildes von der Antike bis zur Renaissance.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Schäferroman in der spanischen Renaissance, die Entwicklung des Fortuna-Konzeptes über verschiedene Epochen, Fortunas Attribute und Symbole, den Einfluss der Antike auf die Renaissance-Literatur und schließlich Fortunas Rolle in "Los siete libros de la Diana" selbst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Kapitel I ("Der Schäferroman - Einleitung") beleuchtet die Geschichte des Schäferromans, seine Verbindung zum aristokratischen Gesellschaftsspiel und seine Darstellung von Liebe und Leid. Kapitel II ("Die Geschichte der Göttin Fortuna") untersucht die Entwicklung des Fortuna-Bildes von der Antike über das Mittelalter bis zur Renaissance, inklusive ihrer Attribute, Symbole und ihrer Beziehung zu anderen Gottheiten. Kapitel III ("Fortuna in Los siete libros de la Diana") analysiert die Rolle Fortunas im spezifischen Kontext des Werkes. Kapitel IV ("Zusammenfassung") fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird Fortuna in der Arbeit dargestellt?
Fortuna wird als komplexe Figur dargestellt, deren Bild sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Die Arbeit beleuchtet ihre Verehrung als Göttin des Überflusses und des Glücks, aber auch ihre Verbindungen zu anderen Gottheiten und ihre verschiedenen Bezeichnungen und Attribute (z.B. Fortuna muliebris, Fortuna virilis). Der Einfluss des Hellenismus und des religiösen Synkretismus auf die Darstellung Fortunas wird ebenfalls untersucht.
Welche Bedeutung hat "Los siete libros de la Diana" im Kontext der Arbeit?
"Los siete libros de la Diana" dient als Fallbeispiel, um die Rolle Fortunas im Schäferroman der spanischen Renaissance zu analysieren. Das Werk wird als gattungs- und modebildendes Werk für den Schäferroman dargestellt, ähnlich wie "Amadis" für den Ritterroman.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Schäferroman, Spanische Renaissance, Fortuna, Tyche, Göttliche Providentia, Mythologie, Antike, Mittelalter, Renaissance, Jorge de Montemayor, Los siete libros de la Diana, Literaturgeschichte, höfisches Gesellschaftsideal, Liebesleid, Schicksal und Zufall.
- Quote paper
- Nadin Meyer (Author), 2002, Fortuna in Los siete libros de la Diana - Göttin oder Teil der göttlichen Providentia?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/23311