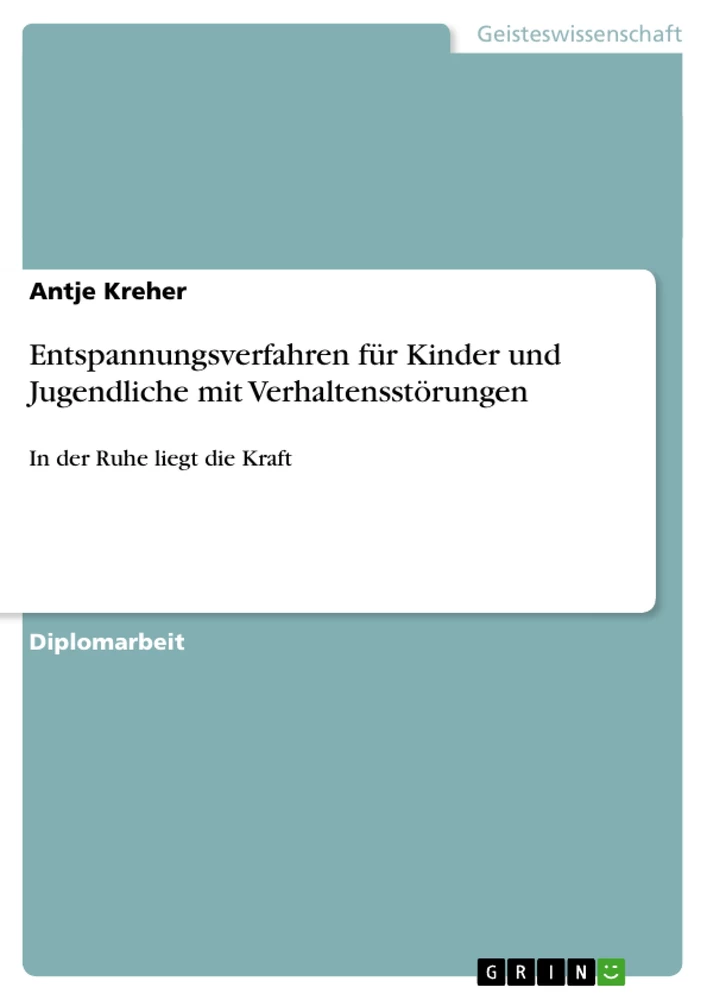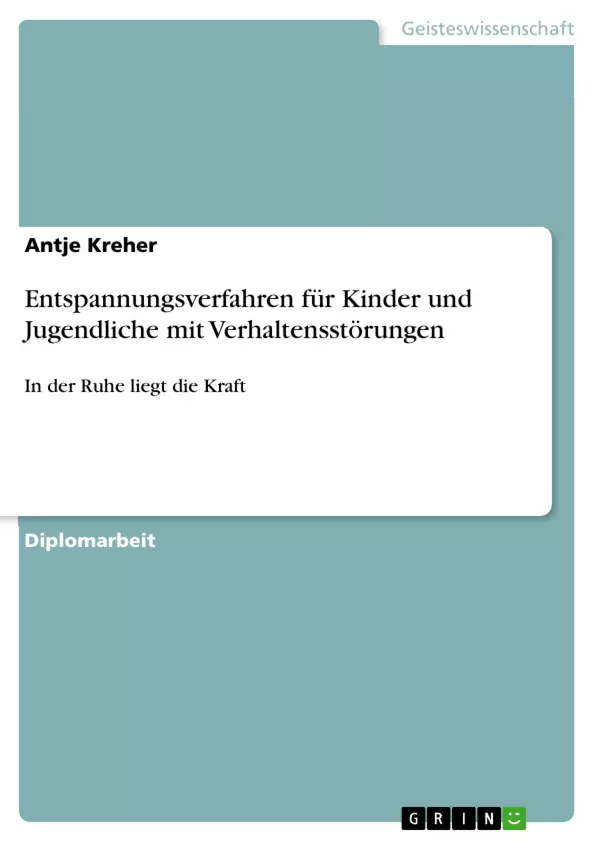In der Arbeit werde ich zunächst relevante Begriffe definieren und die Frage klären, was aus sozialpädagogischer Sicht die Ursachen für Verhaltensstörungen sind. Dabei gehe ich explizit auf die Familienkonstellation, den Erziehungsstil, die sozioökonomischen Verhältnisse und die Schulsituation ein. Im Anschluss daran gebe ich einen Überblick über die Klassifikation von Verhaltensstörungen, um in Anlehnung daran spezifischer zu werden und kurz die weit verbreitesten Verhaltensstörungen zu beschreiben. Diese sind aufgeschlüsselt in externalisierte Störungen, wie aggressives Verhalten und die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und internalisierte Störungen, Angststörungen. Am Ende des allgemeinen Teils möchte ich mich dann mit der Frage beschäftigen, warum man Entspannung in der sozialen Arbeit bei verhaltensgestörten Kindern und Jungendlichen anwenden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen
- Begriffsbestimmungen
- Ursachen und Entstehungen von Verhaltensstörungen
- Die Familie
- Der Erziehungsstil
- Die Schule
- Sozioökonomische Verhältnisse
- Klassifikation von Verhaltensstörungen
- Darstellung von Verhaltensstörungen
- Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung
- Aggressives Verhalten
- Angststörungen
- Notwendigkeit von Entspannungsverfahren in der sozialen Arbeit bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen
- Grundlagen von Entspannungsverfahren
- Physiologische und Psychologische Kennzeichen einer Entspannungsreaktion
- Physiologische Kennzeichen einer Entspannungsreaktion
- Neuromuskuläre Veränderungen
- Kardiovaskuläre Veränderungen
- Respiratorische Veränderungen
- Elektrodermale Veränderungen
- Zentralnervöse Veränderungen
- Psychologische Kennzeichen einer Entspannungsreaktionen
- Physiologische Kennzeichen einer Entspannungsreaktion
- Klassifikation von Entspannungsverfahren
- Standarttechniken der Entspannung
- Das autogene Training
- Autogenes Training für Kinder mit Verhaltensstörungen
- Die progressive Muskelrelaxation
- Progressive Muskelrelaxation für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen
- Weitere Entspannungsverfahren
- Das autogene Training
- Physiologische und Psychologische Kennzeichen einer Entspannungsreaktion
- Anwendung und Durchführung von Entspannungsverfahren
- Indikation
- Kontraindikation
- Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen
- Durchführungsmodalitäten
- Vorbereitung
- Personelle Bedingungen
- Äußere Bedingungen
- Reflexion
- Geeignete Entspannungsverfahren für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen
- Sensorische Entspannungsverfahren
- Schildkrötenphantasieverfahren
- Durchführung
- Progressive Muskelrelaxation für verhaltensgestörte Jugendliche
- Durchführung
- Schildkrötenphantasieverfahren
- Imaginative Entspannungsverfahren
- Kapitän-Nemo-Geschichten
- Durchführung
- Kapitän-Nemo-Geschichten
- Sensorische Entspannungsverfahren
- Abschlussbetrachtung
- Sozialpädagogische Schlussfolgerung
- Fazit
- Tabellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „In der Ruhe liegt die Kraft" befasst sich mit der Entwicklung und Anwendung von Entspannungsverfahren für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Erscheinungsformen von Verhaltensstörungen und beleuchtet die Bedeutung von Entspannung in der sozialen Arbeit. Der Fokus liegt auf der Auswahl und Durchführung von Entspannungsverfahren, die speziell auf die Bedürfnisse verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher abgestimmt sind.
- Definition und Klassifikation von Verhaltensstörungen
- Ursachen und Entstehungsfaktoren von Verhaltensstörungen
- Grundlagen und Wirkungsmechanismen von Entspannungsverfahren
- Geeignete Entspannungsverfahren für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen
- Praktische Anwendung und Durchführung von Entspannungsverfahren in der sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Diplomarbeit vor und erläutert die Relevanz von Entspannungsverfahren für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen.
Kapitel 2 definiert den Begriff „Verhaltensstörungen" und beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zur Klassifikation von Verhaltensstörungen. Es werden die Ursachen und Entstehungsfaktoren von Verhaltensstörungen aus sozialpädagogischer Sicht untersucht, wobei die Familie, der Erziehungsstil, die Schule und sozioökonomische Verhältnisse im Fokus stehen.
Kapitel 3 behandelt die Grundlagen von Entspannungsverfahren. Es werden die physiologischen und psychologischen Kennzeichen einer Entspannungsreaktion beschrieben, sowie verschiedene Klassifikationsmodelle vorgestellt. Die Standarttechniken des autogenen Trainings und der progressiven Muskelrelaxation werden erläutert und auf ihre Anwendung bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen angepasst.
Kapitel 4 widmet sich der Anwendung und Durchführung von Entspannungsverfahren. Es werden Indikationsbereiche, Kontraindikationen und Nebenwirkungen von Entspannungsverfahren beleuchtet. Die Durchführungsmodalitäten werden anhand der Vorbereitung, personellen und äußeren Bedingungen sowie der Reflexionsphase erläutert.
Kapitel 5 präsentiert verschiedene Entspannungsverfahren, die sich für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen eignen. Es werden sensorische Verfahren, wie das Schildkrötenphantasieverfahren und die progressive Muskelrelaxation, sowie imaginative Verfahren, wie die Kapitän-Nemo-Geschichten, vorgestellt und ihre konkrete Durchführung beschrieben.
Der Abschluss enthält eine sozialpädagogische Schlussfolgerung und ein Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse der Diplomarbeit zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Verhaltensstörungen, Entspannungsverfahren, Kinder, Jugendliche, soziale Arbeit, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Schildkrötenphantasieverfahren, Kapitän-Nemo-Geschichten, Prävention, Intervention, pädagogische Konzeption, psychophysiologische Effekte.
- Arbeit zitieren
- Antje Kreher (Autor:in), 2013, Entspannungsverfahren für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/232456