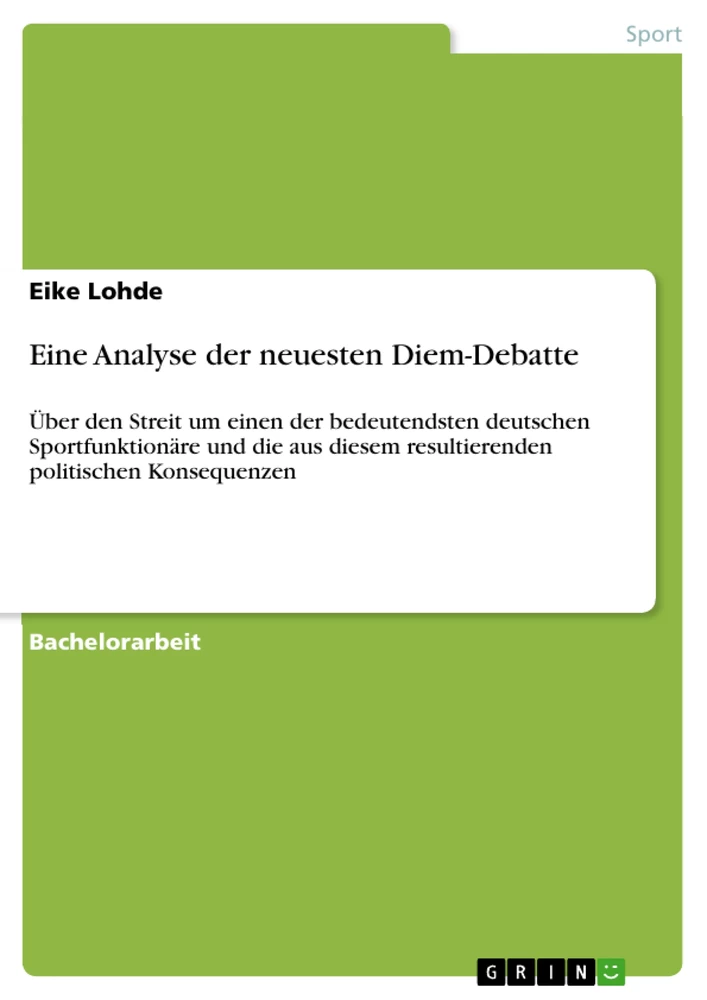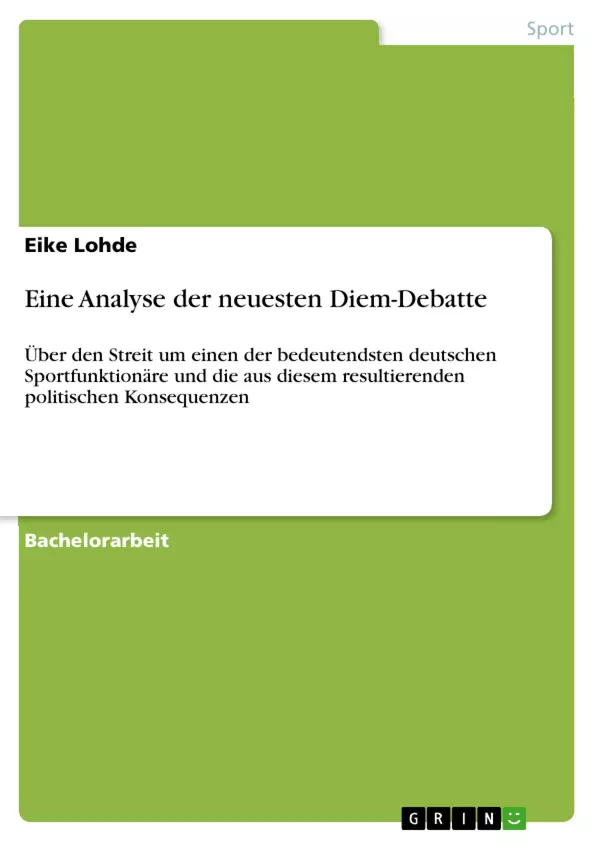Über wohl kaum einen deutschen Sportfunktionär des 20. Jahrhunderts herrscht mehr Uneinigkeit innerhalb der Sportgeschichte als über Carl Diem (1882-1962). Diem bekleidete zahlreiche sportorganisatorische Ämter in vier Epochen Deutscher Geschichte: Bereits im Alter von 22 Jahren wurde er im Deutschen Kaiserreich Schriftführer der Deutschen Sportbehörde für Athletik, zwischen 1913 und 1933 war er Generalsekretär des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen, 1920 gründete er die Berliner Hochschule für Leibesübungen (DHfL) mit und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war er 1947 der Gründer der Deutsche Sporthochschule in Köln (DSHS) als Nachfolgeeinrichtung der DHfL.
Doch ein Abschnitt seines Lebens wurde hierbei nicht erwähnt. Eben dieser brachte ihm noch zu Lebzeiten und weit über diese hinaus scharfe Kritik. Als Generalsekretär des Organisationskomitees der XI. Olympischen Spiele 1936 in Berlin war er maßgeblich an der Planung der vom US-amerikanischen Kultur- und Politikhistoriker David Clay Large bezeichneten „Nazi games“ beteiligt, die auch für viele andere Historiker eine pure Propagandainszenierung darstellten. Weiterhin wurde Diem 1939 zum Reichssportführer des Gaues Ausland ernannt und füllte damit eine offizielle Position innerhalb des NS-Regimes aus. Aber nicht nur seine sportorganisatorischen Ämter führten zur kritischen Hinterfragung.
Vor allem seine Publikationen Sturmlauf durch Frankreich im Reichssportblatt von 1940 und Olympische Flamme von 1942 sowie seine Tagebucheinträge und Briefe, die im Laufe der zweiten Hälfte des 20.-Jahrhunderts erschlossen werden konnten, brachten Politiker, Historiker und Sportwissenschaftler dazu, mit ihm härter ins Gericht zu gehen. Allerdings überwog lange Zeit für die Mehrzahl der Fachwissenschaftler und Politiker das Diem-Bild eines Mannes, der den deutschen Sport in die Moderne führte und seine Zeit im Nationalsozialismus damit verbrachte, eben diesen Sport vor der Beeinflussung der NSDAP fernzuhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diem-Debatten im 20. Jahrhundert
- Die erste Diem-Debatte um die Bundestagssitzung vom 23. März 1950
- Die zweite Diem-Debatte im Vorfeld der Olympischen Spiele 1972
- Die dritte Diem-Debatte — Mythos Carl Diem von 1987
- Die vierte Diem-Debatte — Das Gutachten von Teichler 1996
- Die neueste Diem-Debatte: Auslöser, Positionen, Gegenstände und Deutungen
- Das Forschungsprojekt „Leben und Werk Carl Diems"
- Schäfers Diem-Eintrag im Handbuch des Antisemitismus
- Diskussionsgegenstände
- Antisemitismus
- Nationalsozialismus
- Militarismus
- „Kritische Historiker" gegen „Diemologen"
- Geschichtspolitische Konsequenzen im Zuge der neuesten Diem-Debatte
- Zum Verhältnis von (Sport-)Geschichtswissenschaft und (Sport-)Geschichtspolitik
- Die Umbenennung der Carl-Diem-Plakette
- Die Umbenennungen von Carl-Diem-Straßen, -Wegen, -Sportplätzen und -Hallen
- Schlussbetrachtung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Literatur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die neueste Diem-Debatte, welche von circa 2009 im Grunde bis heute anhält. Die Arbeit untersucht die Debatte innerhalb der deutschen Fachöffentlichkeit und fokussiert sich auf folgende Fragestellungen: Welche Entwicklungen führten zur neuesten Diem-Debatte und wodurch wurde diese ausgelöst? Welche Gegenstände wurden diskutiert und wie wurde von wem argumentiert? Welche politischen Konsequenzen zog die neueste Diem-Debatte nach sich und welchen Einfluss leisteten dabei die wissenschaftlichen Untersuchungen?
- Die vier Diem-Debatten des 20. Jahrhunderts und ihre Diskussionsgegenstände
- Die Entstehung der neuesten Diem-Debatte durch das Forschungsprojekt „Leben und Werk Carl Diems" und den Eintrag im Handbuch des Antisemitismus
- Die verschiedenen Positionen und Deutungen der Debattierenden zu den Themen Antisemitismus, Nationalsozialismus und Militarismus
- Der Konflikt zwischen „kritischen Historikern" und „Diemologen" und deren unterschiedliche Ansätze zur Interpretation von Carl Diems Leben und Werk
- Die geschichtspolitischen Konsequenzen der neuesten Diem-Debatte, insbesondere die Umbenennung der Carl-Diem-Plakette und von Carl-Diem-Straßen, -Wegen, -Sportplätzen und -Hallen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Übersicht über die vier Diem-Debatten des 20. Jahrhunderts, um den Kontext für die neueste Debatte zu schaffen. Anschließend wird die neueste Diem-Debatte im Detail untersucht. Hierbei werden die verschiedenen Auslöser, Diskussionsgegenstände, Positionen und Deutungen der Debattierenden aufgezeigt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Rolle von Frank Beckers Biographie über Carl Diem und dem Eintrag im Handbuch des Antisemitismus von Ralf Schäfer. Die Arbeit beleuchtet den Konflikt zwischen „kritischen Historikern" und „Diemologen" und analysiert die unterschiedlichen Ansätze, die diese beiden Lager zur Interpretation von Carl Diems Leben und Werk verfolgen. Schließlich werden die politischen Konsequenzen der neuesten Diem-Debatte untersucht, insbesondere die Umbenennung der Carl-Diem-Plakette und von Carl-Diem-Straßen, -Wegen, -Sportplätzen und -Hallen. Die Arbeit zeigt, dass die Debatte um Carl Diem bis heute anhält und dass es keinen Konsens darüber gibt, wie sein Leben und Werk zu beurteilen sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Carl Diem, Sportgeschichte, Antisemitismus, Nationalsozialismus, Militarismus, Geschichtspolitik, Erinnerungskultur, wissenschaftliche Kontroversen, Umbenennungen, Sporthochschule Köln, Handbuch des Antisemitismus, „kritische Historiker", „Diemologen", Frank Becker, Ralf Schäfer, Michael Krüger.
- Quote paper
- Eike Lohde (Author), 2013, Eine Analyse der neuesten Diem-Debatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231944