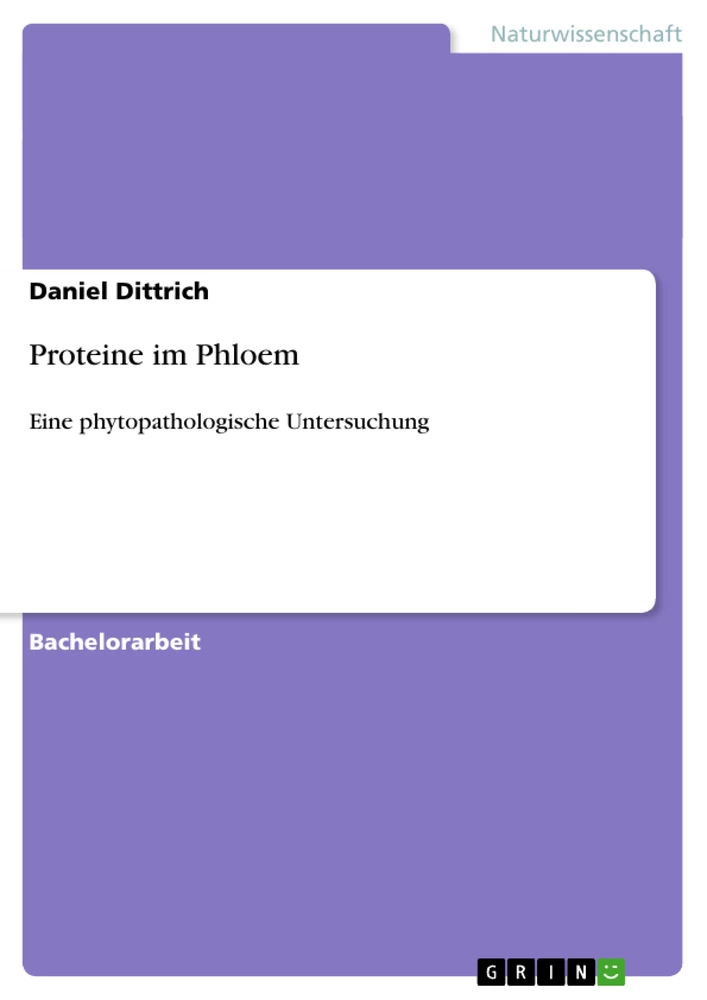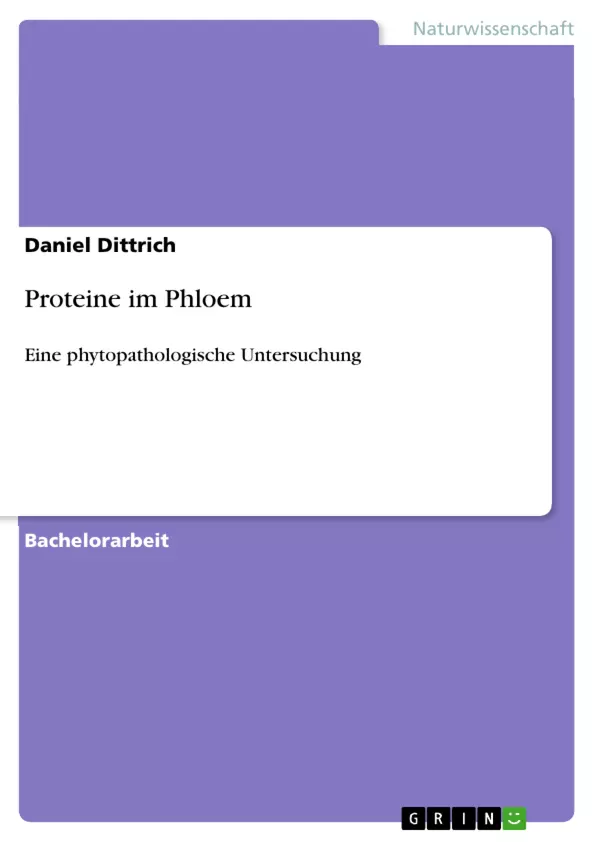Pflanzen sind eine der wichtigsten Grundlagen für die Existenz von Leben auf unserer Erde. Ihnen werden zwei bedeutende Funktionen zugeschrieben. Erstens sind Pflanzen der elementare Baustein der Vegetationsdecke und stellen eine Nahrungsquelle für Tiere, Pilze und Mikroben dar. Zweitens dienen sie als Nutzpflanzen der menschlichen Ernährung. Aus diesem Grund ist der Mensch abhängig von einer ertragreichen Pflanzenproduktion. Vor allem nimmt diese Abhängigkeit angesichts der globalen Bevölkerungsentwicklung zu, da die Landwirtschaft zwangsläufig weiter intensiviert werden muss. Des Weiteren ist das heutige Wissen über die Nutzpflanzenproduktion noch sehr gering und es bestehen erhebliche internationale Unterschiede im Anbau der Kulturen. Durch diese Problematik entstehen Hungersnöte in vielen Entwicklungsländern, während potenzielle Erträge meist nicht erreicht werden können. Diese Umstände verdeutlichen, dass Forschung und Entwicklung für die pflanzliche Erzeugung essenziell sind.
Pflanzen sind konstant abiotischen und biotischen Stressbedingungen ausgesetzt, weshalb sie sich in ihrer Entwicklung diverse Abwehrmechanismen angeeignet haben (Hallmann, J. et al. 2007). Diese Abwehrmechanismen entstehen zum größten Teil durch die Interaktion zwischen Pflanzen und Pathogenen. Die Pflanze schützt sich vor Bakterien, Viren und Pilzen durch strukturelle, biochemische oder chemische Mechanismen. Als Reaktion darauf entwickelten sich bei den Pflanzenpathogenen mit der Zeit mehrere Formen der Besiedlung und Penetration in die Pflanze. Insbesondere die Blätter und Wurzeln stehen im engen Kontakt mit Pathogenen, da hier natürliche Öffnungen (Stomata, Lentizellen, Nektarien) und Wunden vorhanden sind (Buchanan, B. et al. 2000).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Verzeichnisse
- 2 Zusammenfassung
- 3 Einleitung
- 3.1 Pflanzliche Abwehrmechanismen
- 3.2 Das Phloem
- 3.3 Verschluss der Siebelemente
- 4 Ziel der Arbeit
- 5 Material
- 6 Methoden
- 7 Ergebnisse
- 8 Literaturverzeichnis
- 9 Danksagung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht physiologische Veränderungen im Phloem höherer Pflanzen durch mikrobielle Elicitoren. Das Hauptziel ist die Analyse der Forisomreaktion, einem Prozess des Siebröhrenverschlusses, als Reaktion auf die Applikation von mikrobiellen assoziierten molekularen Mustern (MAMPs). Die Arbeit konzentriert sich auf die Pflanzen Vicia faba und Cucurbita maxima.
- Pflanzliche Abwehrmechanismen und die Rolle des Phloems
- Forisomreaktion als Antwort auf mikrobielle Elicitoren
- Analyse der Forisomposition und -bewegung in Siebelementen
- Untersuchung der beteiligten Proteine mittels SDS-Page
- In-vivo-Beobachtung der Forisomreaktion
Zusammenfassung der Kapitel
3 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der pflanzlichen Abwehrmechanismen ein, wobei ein Schwerpunkt auf der Rolle des Phloems und der Bedeutung von Elicitoren, insbesondere MAMPs, gelegt wird. Es wird der Prozess des Siebröhrenverschlusses durch Forisome und Callose erläutert, sowie die relevanten Proteine in Cucurbita maxima und Vicia faba vorgestellt. Der Abschnitt dient als fundierte Grundlage für die darauffolgenden Kapitel, indem er den wissenschaftlichen Kontext und die Forschungsfrage klar definiert.
5 Material: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das verwendete Pflanzenmaterial (Vicia faba und Cucurbita maxima), die verwendeten Lösungen (Puffer, Farbstoffe, MAMPs), die Methoden der SDS-Page, die eingesetzte Geräte und Verbrauchsmittel. Die präzise Beschreibung der Materialien ist essentiell für die Reproduzierbarkeit der Experimente und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Die Auswahl der Pflanzen und Substanzen wird durch die Einleitung begründet und ihre Eigenschaften im Detail erläutert.
6 Methoden: In diesem Kapitel werden die angewandten Methoden zur Beobachtung des intakten Phloems (in-vivo-Technik) und die Probenentnahme von Cucurbita maxima für die eindimensionale SDS-Page detailliert beschrieben. Die Beschreibung der "in-vivo-Technik" mit Brennreiz und MAMP-Applikation sowie die Färbemethoden für das Phloem sind von großer Bedeutung, um die Vorgehensweise zu verstehen. Die detaillierte Erläuterung der SDS-Page-Methode ist zentral für die Analyse der Proteine im Phloemsaft.
7 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Experimente, unter anderem die Beobachtung der Forisomreaktion nach Applikation von flg22 und Chitin (N-acetylchitooctaose) in Vicia faba. Die Ergebnisse der eindimensionalen SDS-Page mit Phloemsaft von Cucurbita maxima werden ebenfalls dargestellt und analysiert, insbesondere im Hinblick auf die Proteinveränderungen. Die Ergebnisse sind mit Abbildungen und Tabellen dokumentiert, die eine detaillierte visuelle Darstellung der Daten ermöglichen. Die Interpretation der Ergebnisse bleibt im Wesentlichen der Diskussion vorbehalten.
Schlüsselwörter
Phloem, mikrobielle Elicitoren, MAMPs (Microbe-associated-molecular-patterns), Forisome, Callose, Vicia faba, Cucurbita maxima, Pflanzliche Abwehr, SDS-Page, Siebröhrenverschluss, in-vivo-Technik, flg22, Chitin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Physiologische Veränderungen im Phloem höherer Pflanzen durch mikrobielle Elicitoren
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die physiologischen Veränderungen im Phloem höherer Pflanzen, insbesondere Vicia faba und Cucurbita maxima, als Reaktion auf mikrobielle Elicitoren (MAMPs). Der Fokus liegt auf der Analyse der Forisomreaktion, einem Prozess des Siebröhrenverschlusses.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Das Hauptziel ist die Analyse der Forisomreaktion als Antwort auf die Applikation von MAMPs (z.B. flg22 und Chitin). Die Arbeit untersucht die Forisomposition und -bewegung in Siebelementen und analysiert beteiligte Proteine mittels SDS-Page. Die in-vivo-Beobachtung der Forisomreaktion ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
Welche Pflanzen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Pflanzenarten: Vicia faba (Saubohne) und Cucurbita maxima (Große Kürbis).
Welche Methoden werden angewendet?
Es werden sowohl eine in-vivo-Technik zur Beobachtung des intakten Phloems als auch die eindimensionale SDS-Page zur Analyse der Proteine im Phloemsaft eingesetzt. Die in-vivo-Technik beinhaltet die Applikation von MAMPs und die Beobachtung der Reaktion. Die SDS-Page dient der Untersuchung von Proteinveränderungen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die Beobachtung der Forisomreaktion nach Applikation von flg22 und Chitin in Vicia faba. Die eindimensionale SDS-Page liefert Daten zu Proteinveränderungen im Phloemsaft von Cucurbita maxima. Die Ergebnisse werden durch Abbildungen und Tabellen visualisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Phloem, mikrobielle Elicitoren, MAMPs, Forisome, Callose, Vicia faba, Cucurbita maxima, pflanzliche Abwehr, SDS-Page, Siebröhrenverschluss, in-vivo-Technik, flg22, Chitin.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung, eine Einleitung mit Fokus auf pflanzliche Abwehrmechanismen und das Phloem, ein Kapitel zur Zielsetzung und den Themenschwerpunkten, Kapitel zu Material und Methoden, die Darstellung der Ergebnisse und ein Literaturverzeichnis sowie eine Danksagung.
Welche Rolle spielt das Phloem in der Arbeit?
Das Phloem steht im Zentrum der Arbeit, da es ein wichtiger Bestandteil der pflanzlichen Abwehr ist und die Forisomreaktion im Phloem stattfindet. Die Arbeit untersucht die Veränderungen im Phloem als Reaktion auf mikrobielle Elicitoren.
Was sind MAMPs und ihre Bedeutung in der Arbeit?
MAMPs (Microbe-associated molecular patterns) sind mikrobielle assoziierte molekulare Muster, die von Pflanzen als Signale für eine Infektion erkannt werden und die pflanzliche Abwehr aktivieren, einschließlich der Forisomreaktion im Phloem, die in dieser Arbeit untersucht wird.
Was ist die Forisomreaktion?
Die Forisomreaktion ist ein Prozess des Siebröhrenverschlusses in Pflanzen als Reaktion auf Stress, beispielsweise eine mikrobielle Infektion. Sie dient dazu, den weiteren Transport von Pathogenen zu verhindern.
- Arbeit zitieren
- Daniel Dittrich (Autor:in), 2012, Proteine im Phloem, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/231364