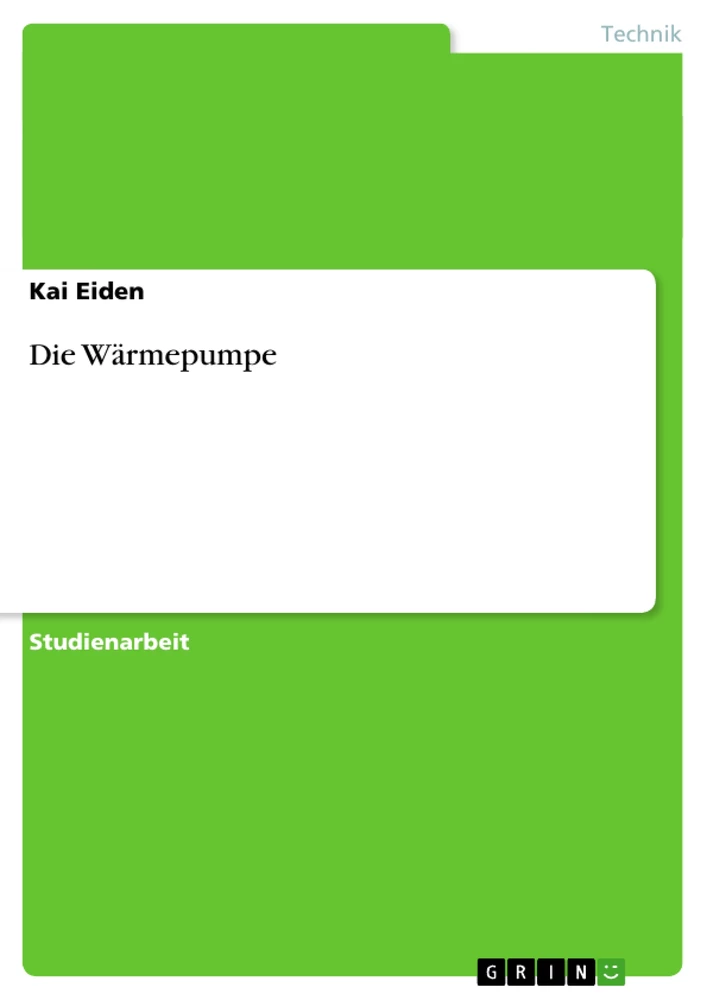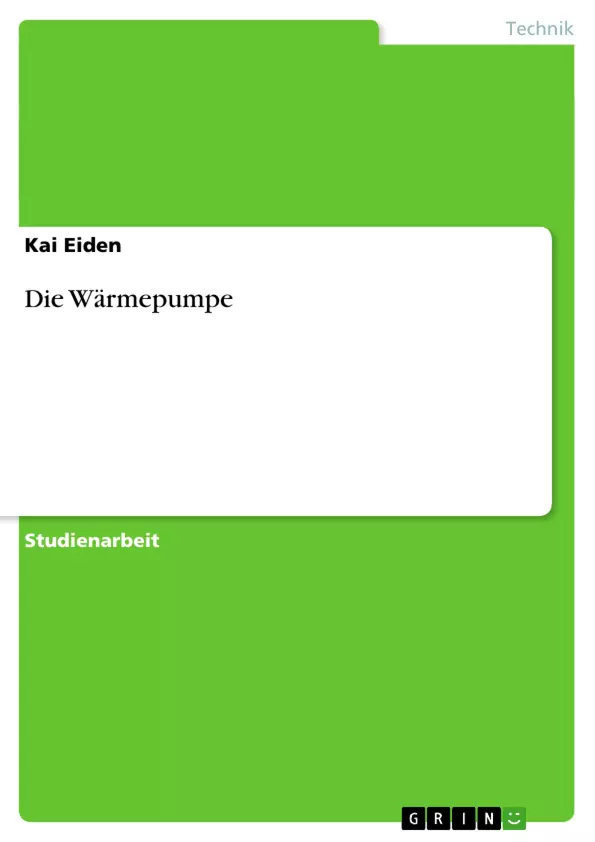Der Wärmeinhalt der Außenluft, des Erdreichs und des Grundwassers ist auch im Winter
noch hoch. Diese Umweltwärme lässt sich aber wegen der niedrigen Temperatur für die
Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung nicht ohne weiteres nutzen. Deshalb muss
die Temperatur dieser Umweltenergie mit einer Wärmepumpe angehoben werden.
Eine Wärmepumpe transformiert bereits vorhandene Wärme in einem
thermodynamischen Kreislauf auf ein höheres Wärmeniveau. Die vorhandene Wärme kann
aus unterschiedlichen Quellen genutzt werden. Die Atmosphäre, Massiv-Absorber und auch
die nahe an der Oberfläche liegenden Bodenschichten werden durch eingestrahlte
Sonnenenergie erwärmt und können als Wärmequelle zur Verfügung stehen. Die Nutzung
der Wärme tieferer Schichten beruht auf dem Zerfall radioaktiver Elemente im Erdinneren
und ist dem Bereich der Geothermie zuzuordnen. Die genutzte Wärme aus dem
Grundwasser beruht sowohl auf der Sonnenenergie als auch auf der Erdwärme. Weiterhin ist
die Nutzung von Abwärme aus gewerblichen/industriellen Produktionsprozessen möglich.
Für die Transformation auf ein höheres Wärmeniveau ist Fremdenergie erforderlich,
jedoch ist der Wirkungsgrad der eingesetzten Fremdenergie dadurch besonders hoch, dass
die vorhandene Wärme aus der genutzten Wärmequelle kostenlos zur Verfügung steht.
Die besonders günstigen Primärenergie- und CO2-Vermeidungskosten von Wärmepumpen
werden leider heute noch viel zu wenig beachtet. Sie geben an, mit welchem
zusätzlichen Kostenaufwand welche Menge an Primärenergie oder CO2 eingespart werden
kann. Im Fall der Elektrowärmepumpe liegen diese Vermeidungskosten vergleichsweise
niedrig, in vielen Fällen ergeben sich sogar Kosteneinsparungen. Die Wärmepumpe zählt
daher zu den wenigen Energiesparmaßnahmen, die sich nach heutigen Investitionen und
Tarifen überhaupt rechnen und die den größten Umweltnutzen aufweisen.
In Deutschland entfallen etwa 75 % der benötigten Primärenergie auf den Bereich Raumwärme.
Ca. 36,1 % des Endenergieverbrauchs wird für die Raumheizung aufgewendet
(einschließlich der Warmwasserbereitung in Haushalten). Die Wärmeversorgung basiert
überwiegend auf der Verbrennung fossiler Rohstoffe, wie z. B. Erdgas und Erdöl, in
Heizkesseln. Mit Wärmepumpen lassen sich in Verbindung mit Niedertemperaturheizungen
bereits heute höhere exergetische Wirkungsgrade erzielen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeines.
- Funktionsprinzip einer Wärmepumpe
- Kennwerte
- Einflüsse durch das Kältemittel..
- Betriebsweisen
- Bivalente Betriebsweisen...
- Monovalente Betriebsweise..
- Wärmequellen
- Erdreich.....
- Grundwasser..
- Umgebungsluft...
- Fazit...................
- Literaturverzeichnis...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Funktionsweise und den Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen. Sie analysiert das Funktionsprinzip, verschiedene Betriebsweisen, mögliche Wärmequellen und die Bedeutung von Wärmepumpen im Kontext der Energieeinsparung und des Umweltschutzes.
- Funktionsprinzip einer Wärmepumpe
- Einsatzmöglichkeiten und Betriebsweisen
- Verschiedene Wärmequellen
- Wärmepumpen im Kontext der Energieeinsparung
- Wärmepumpen und Umweltschutz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeines
Dieses Kapitel führt den Leser in die Thematik der Wärmepumpen ein und erläutert die Bedeutung der Nutzung von Umweltwärme für die Gebäudeheizung und Trinkwassererwärmung. Es wird die Funktionsweise einer Wärmepumpe als thermodynamischer Kreislauf beschrieben, der vorhandene Wärme auf ein höheres Wärmeniveau transformiert. Weiterhin werden verschiedene Wärmequellen, wie Atmosphäre, Erdreich, Grundwasser und Abwärme, vorgestellt. Die Bedeutung von Wärmepumpen im Kontext der Energieeinsparung und der Vermeidung von CO2-Emissionen wird hervorgehoben.
2. Funktionsprinzip einer Wärmepumpe
Dieses Kapitel beleuchtet das Funktionsprinzip einer Wärmepumpe, das dem Prinzip eines Kühlschranks ähnelt. Es wird der Kreislauf einer Kompressionswärmepumpe mit Elektro-, Gas- oder Dieselantrieb erläutert, der aus Verdampfung, Verdichtung, Kondensation und Expansion eines Kältemittels besteht. Es werden die einzelnen Phasen des Kreislaufs im Detail beschrieben, einschließlich der Wärmeübertragung von der Wärmequelle auf das Kältemittel, der Verdichtung und Erwärmung des Kältemittels sowie der Abgabe der Wärme an das Heizsystem.
3. Betriebsweisen
Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Betriebsweisen von Wärmepumpen, unterteilt in bivalente und monovalente Betriebsweisen. Es werden die spezifischen Einsatzgebiete und Vorteile der jeweiligen Betriebsweise erläutert.
4. Wärmequellen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit unterschiedlichen Wärmequellen, die von Wärmepumpen genutzt werden können. Es werden die Wärmegewinnung aus dem Erdreich, dem Grundwasser und der Umgebungsluft, sowie die Nutzung von Abwärme aus gewerblichen/industriellen Produktionsprozessen beschrieben.
Schlüsselwörter
Wärmepumpe, Funktionsprinzip, Wärmequelle, Betriebsweise, Energieeinsparung, CO2-Vermeidung, Umweltwärme, thermodynamischer Kreislauf, Kältemittel, Energieeffizienz, exergetische Bilanzierung, Niedertemperaturheizung
- Arbeit zitieren
- Kai Eiden (Autor:in), 2003, Die Wärmepumpe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/23020