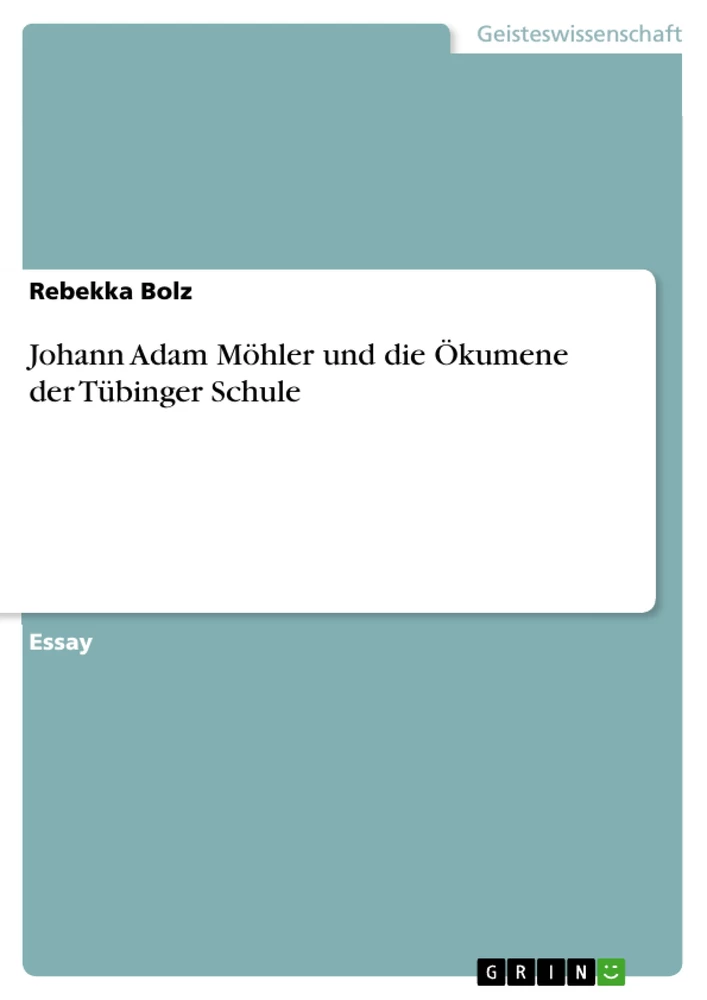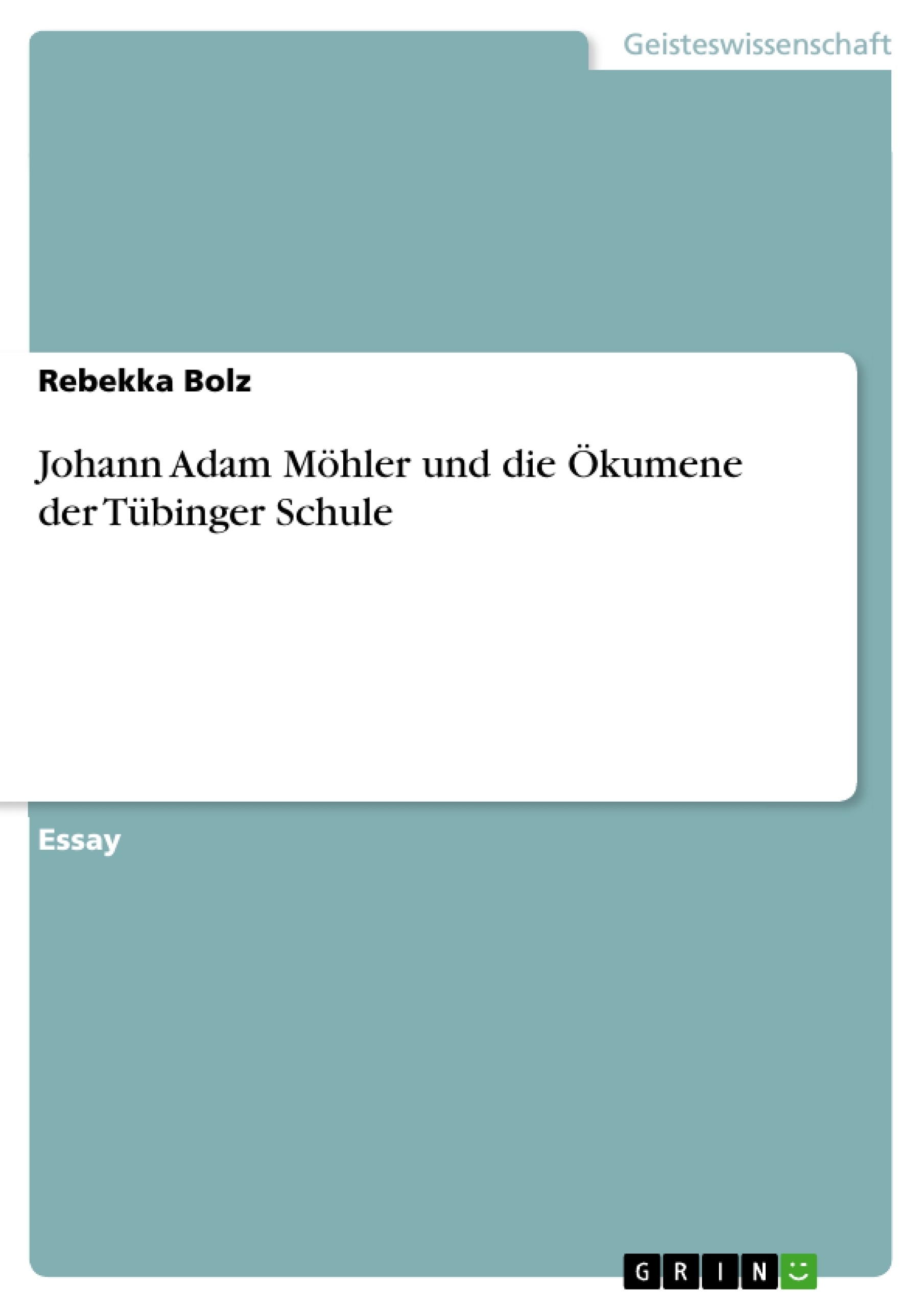Johann Sebastian Drey (1777-1853) gründete 1819 die Tübinger Schule. Nach Hermann Josef Brosch hatte die Tübinger Schule das Ziel, mit der Aufklärung und ihrem Moralismus zu brechen und die Theologie wieder in ihr Innerstes zu vertiefen. Erkennbar ist somit, dass es sich um eine zeitgebundene Theologie handelte.
„Das Wollen der Tübinger Schule von ihren ersten Anfängen an war, ihren Teil zum Geistesleben der Gegenwart beizutragen“, schreibt der Theologe Geiselmann. Johann Adam Möhler war Schüler von Drey in Tübingen und führte neben anderen Theologen die Tübinger Schule weiter. Er ist derjenige der Tübinger Theologen, der sich mit den Unterschieden der Konfessionen und somit mit dem noch heute aktuellen Thema der Ökumene lebenslang beschäftigt hat.
Johann Sebastian Drey (1777-1853) gründete 1819 die Tübinger Schule. Nach Hermann Josef Brosch hatte die Tübinger Schule das Ziel, mit der Aufklärung und ihrem Moralismus zu brechen und die Theologie wieder in ihr Innerstes zu vertie- fen. Erkennbar ist somit, dass es sich um eine zeitgebundene Theologie handelte.
„Das Wollen der Tübinger Schule von ihren ersten Anfängen an war, ihren Teil zum Geistesleben der Gegenwart beizutragen“1, schreibt der Theologe Geisel- mann. Johann Adam Möhler war Schüler von Drey in Tübingen und führte neben anderen Theologen die Tübinger Schule weiter. Er ist derjenige der Tübinger Theologen, der sich mit den Unterschieden der Konfessionen und somit mit dem noch heute aktuellen Thema der Ökumene lebenslang beschäftigt hat.
Johann Adam Möhler – Kurzbiographie
Johann Adam Möhler wurde am 06.05.1796 in Igersheim bei Mergentheim gebo- ren. Nach seiner Laufbahn am Lyzeum in Mergentheim und in Ellwangen, nahm er 1815 das Studium der Theologie in Ellwangen auf. Zwei Jahre später wechselte er zwangsweise an die Universität Tübingen, da König Wilhelm die Universität dorthin verlegt hatte, und lebte dort im Theologenkonvikt Wilhelmsstift, wo er wie schon gesagt Schüler von Johann Sebastian Drey war. Am 18.09.1819 wurde Möhler zum Priester geweiht. Nach ein paar Jahren Lehrtätigkeit und einigen Studienreisen, auf denen er einigen evangelischen Theologen begegnete, durch die er sein Interesse für die konfessionellen Probleme schärfte, hatte er ab 1823 eine Professur für Kirchenrecht und Patristik an der Tübinger Universität inne. Mehrere Rufe an andere deutsche katholisch-theologische Fakultäten lehnte Möhler ab. 1825 veröffentlichte er sein erstes bekanntes Werk: „Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus, dargestellt im Geiste der Kirchen- väter der ersten drei Jahrhunderte“. Nachdem er dann im Jahre 1832 seine be- rühmte „Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholi- ken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnißschriften“ veröffent- lichte, wurde er 1835 an die Maximilians-Universität nach München berufen, wo er eine Professorenstelle für neutestamentliche Exegese und Kirchengeschichte annahm. Am 12.04.1838 starb der noch junge Möhler in München an einer Lun- generkrankung.
Gesellschaft zur Zeit Möhlers
Die Zeit um 1800 herum war gekennzeichnet durch Umbrüche, neue Denkrich- tungen, Revolutionen und andere gesellschaftlichen Phänomenen. Dies alles spiegelt sich ebenfalls in der Kirchengeschichte und im theologischen Denken wieder. „Geschichte und Schicksal der Nation wird so irgendwie zur Geschichte und zum Schicksal auch ihrer Theologie“2, schreibt Geiselmann sehr treffend. Man kann also die Theologie Möhlers nur vor dem Hintergrund aktueller Einflüs- se der Aufklärung und der Romantik betrachten. Er selbst hat diesen Blick wäh- rend seiner Arbeit nie verloren. Geiselmann schreibt weiterhin, dass der junge Theologe „in den geschichtlich gewordenen Formen der theologischen Ausei- nandersetzung der Konfessionen den wissenschaftlichen Ausdruck der geistig politischen Gesamtlage einer bestimmten Epoche [sieht]“3. In der Gesellschaft kann man einen Wandel vom aufklärerischen rationalen Den- ken hin zu wiederkehrenden Empfindungen in der Romantik. Die Romantik ist die Epoche, die religionsgeschichtlich den Blick auf das Einende der Konfessionen geschärft hat.
[...]
1 Geiselmann, Josef Rupert: Johann Adam Möhler. Die Einheit der Kirche und die Wiedervereini- gung der Konfessionen. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen den Konfessionen, Paderborn 1940, S.123.
2 Geiselmann, Josef Rupert: Johann Adam Möhler. Die Einheit der Kirche und die Wiedervereini- gung der Konfessionen. Ein Beitrag zum Gespräch zwischen den Konfessionen, Paderborn 1940, S.108.
3 Geiselmann, Josef Rupert: Johann Adam Möhler, S.124.
- Quote paper
- Rebekka Bolz (Author), 2013, Johann Adam Möhler und die Ökumene der Tübinger Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/230176