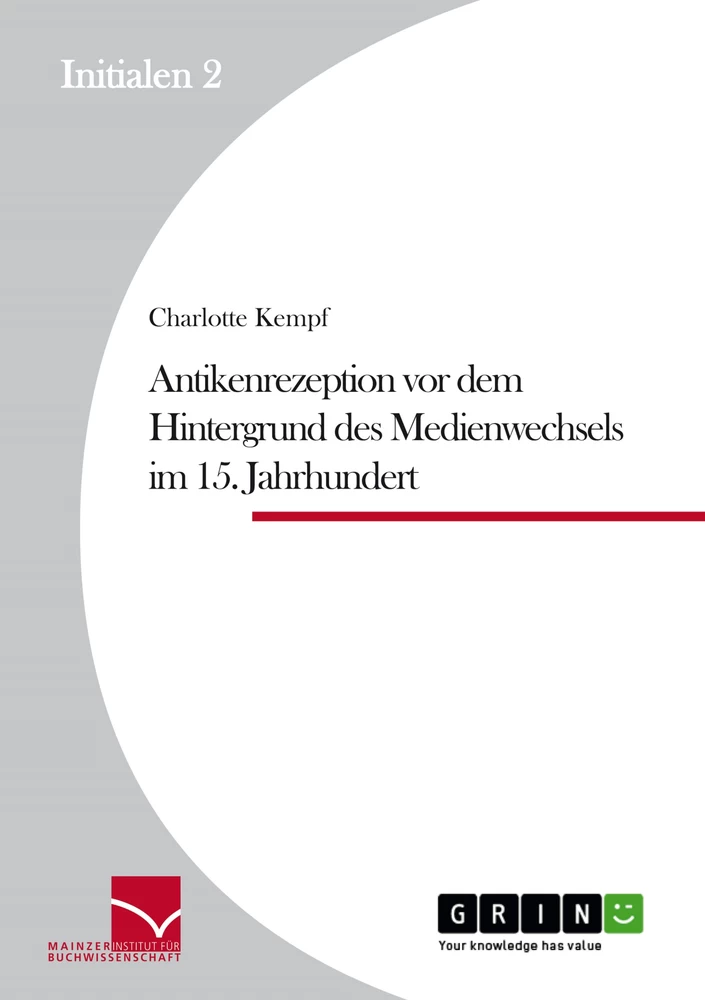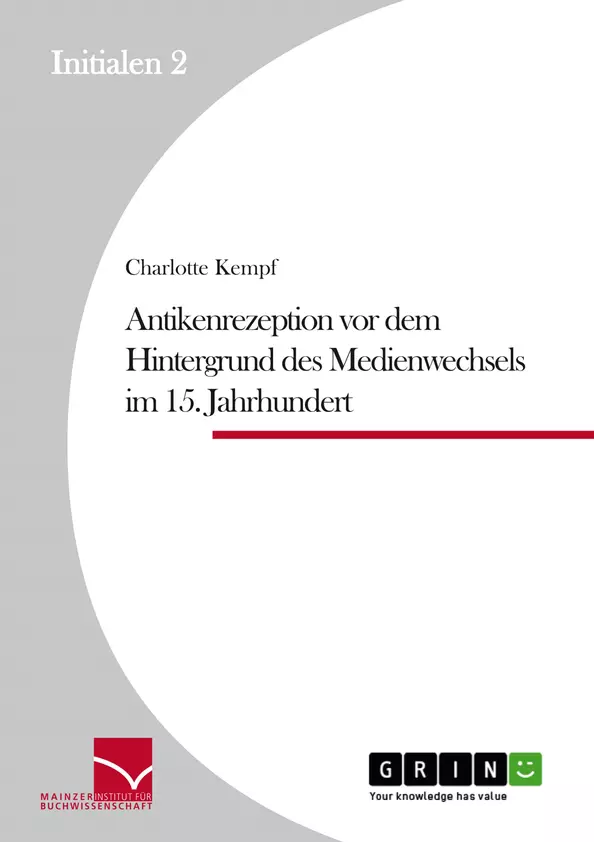Charlotte Kempf widmet sich in dieser Arbeit der Rezeption von antiker Literatur in der Epoche der Renaissance. Dabei wird untersucht, welche Auswirkungen die Erfindung Gutenbergs, der Druck mit beweglichen Lettern, auf die Antikenrezeption im 15. Jahrhundert hatte und wie sich die Wahrnehmung antiker Literatur dadurch änderte.
Der Wandel der Schriftkultur in der Renaissance führte zu einer Verbreitung, Bewahrung und teilweise auch Wiederentdeckung antiker Literatur, die ohne den Buchdruck nicht möglich gewesen wäre.
Diese Untersuchungen führt Kempf exemplarisch an der Literatur des antiken Autors Plinius dem Jüngeren durch, dessen „Epistulae“ vor dem Hintergrund des Medienwechsels im 15. und frühen 16. Jahrhundert zum ersten Mal einem größeren Publikum in seiner Gesamtheit bekannt wurde, da der Buchdruck eine weite Verbreitung des kompletten Werks in Europa erlaubte. Zu dieser Verbreitung von antiker Literatur trug vor allem auch die 1508 von Aldus Manutius gedruckte Ausgabe der „Epistulae“ bei, die in mehreren Auflagen bis weit in das 16. Jahrhundert hinein nachgedruckt wurde.
Charlotte Kempf studierte an der Johannes Gutenberg- Universität in Mainz Buchwissenschaft und Lateinische Philologie, seit 2011 widmet sie sich ihrem Masterstudium in Mittelalter- und Renaissancestudien an der Albert- Ludwigs- Universität Freiburg.
Inhaltsverzeichnis
- Thema, Forschungsumfeld und Fragestellung der Untersuchung
- Antikenrezeption und medienhistorischer Kontext
- Antikenrezeption in der Epoche der Renaissance
- Der Medienwechsel von der Handschrift zum gedruckten Buch
- Die „Epistulae" des Plinius und ihre Rezeption vor dem Hintergrund des Medienwechsels
- Handschriftenüberlieferung und Übergang zum Buchdruck bei Plinius
- Buchausgaben und Verbreitung der „Epistulae"
- Überlieferungsgeschichtliche Auswirkungen des Medienwechsels
- Die Bedeutung des Medienwechsels für die Rezeption der „Epistulae" des Plinius — ein Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Forschungsliteratur
- Elektronische Ressourcen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Antikenrezeption der Frühen Neuzeit, exemplarisch dargestellt am Werk des römischen Autors Plinius minor. Der Fokus liegt auf der Überlieferungsgeschichte seiner „Epistulae" und der Frage, wie der Medienwechsel von der Handschrift zum Buchdruck im 15. Jahrhundert die Rezeption des Werkes beeinflusst hat.
- Die Bedeutung des Buchdrucks für die Bewahrung und Verbreitung antiker Literatur
- Die Rolle der Humanisten bei der Wiederentdeckung und Erforschung antiker Texte
- Die Entwicklung der Textkritik im Kontext des Medienwechsels
- Die Veränderungen in der Wahrnehmung antiker Literatur durch den Buchdruck
- Die Auswirkungen des Medienwechsels auf die Überlieferungsgeschichte der „Epistulae" des Plinius
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt das Thema, das Forschungsumfeld und die Fragestellung der Untersuchung vor. Es wird der Kontext der Antikenrezeption in der Epoche der Renaissance beleuchtet und die Rolle des Humanismus für die Rückbesinnung auf die antike Kultur hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel wird der Medienwechsel von der Handschrift zum Buchdruck im 15. Jahrhundert und seine Bedeutung für die Überlieferung antiker Literatur behandelt. Es wird die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wissenskultur dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Rezeption der „Epistulae" des Plinius im Kontext des Medienwechsels. Es wird die Handschriftenüberlieferung des Werkes bis zum Einsetzen des Buchdrucks untersucht und die Verbreitung der „Epistulae" durch den Buchdruck im 15. und 16. Jahrhundert dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Antikenrezeption, den Medienwechsel, die „Epistulae" des Plinius, die Handschriftenüberlieferung, den Buchdruck, die Renaissance, den Humanismus, die Textkritik und die Überlieferungsgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Charlotte Kempf (Autor:in), 2011, Antikenrezeption vor dem Hintergrund des Medienwechsels im 15. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/230056