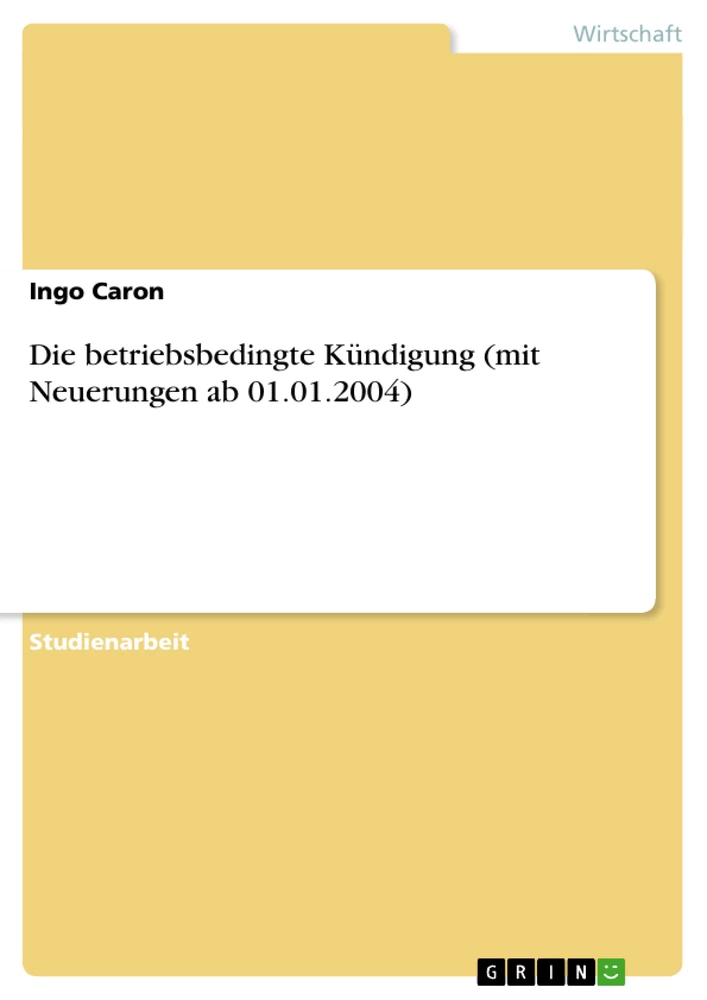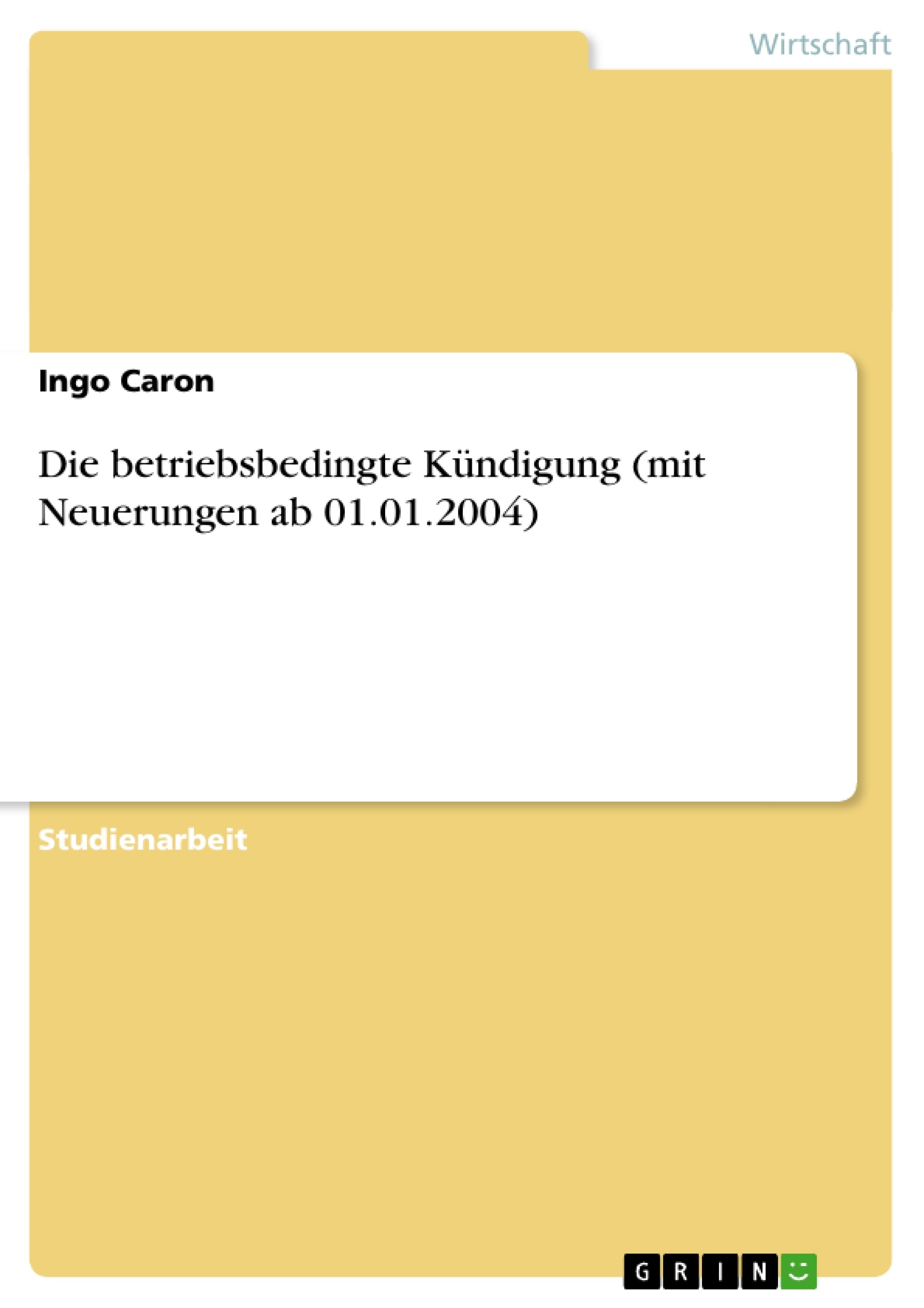1.1 Definition
Arbeitsverhältnisse können aus verschiedenen Gründen enden. Neben Zeitablauf,
Zweckerreichung, Tod des Arbeitnehmers, Aufhebungsvertrag, Anfechtung und der
richterlichen Entscheidung ist der in der Praxis häufigste Beendigungsgrund die
Kündigung.
Wegen der existenziellen Bedeutung, die das Arbeitsverhältnis für einen Arbeitnehmer mit
sich bringt, unterliegt die Kündigung strengen Form- und Fristvorschriften. Darüber hinaus
hat der Gesetzgeber die Rechte des Betriebsrates gestärkt und den Kündigungsschutz
verankert.1
1.2 Arten von Kündigungen
Man unterscheidet zwei Arten von Kündigungen: die außerordentliche Kündigung und die
ordentliche Kündigung.
1.2.1 Die außerordentliche Kündigung
"Bei der außerordentlichen Kündigung ist jeder Vertragsteil berechtigt, das Dienstverhältnis
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, wenn Tatsachen
vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des
Dienstverhältnisses (...) nicht zugemutet werden kann" (§ 626 BGB). Ohne "wichtigen
Grund" ist eine a.o. Kündigung also unwirksam und sie kann nur innerhalb von zwei
Wochen nach Kenntnis des Kündigungsgrundes ausgesprochen werden (Ausschlussfrist
nach § 626 Abs. 2 BGB). Absolute Kündigungsverbote bestehen nicht.
1.2.2 Ordentliche Kündigung
Eine ordentliche Kündigung liegt dann vor, wenn ein unbefristetes Arbeitsverhältnis unter
Einhaltung der gesetzlich geltenden (§ 622 BGB) oder tarif- bzw. einzelvertraglich
vereinbarten Kündigungsfrist durch einseitige Erklärung beendet wird. Die Wirksamkeit
hängt von bestimmten Voraussetzungen ab:
1. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bedarf der Schriftform (§ 623 BGB).
2. Die Kündigung muss dem Vertragspartner zugehen (§ 130 BGB).
3. Die Kündigungsfristen müssen eingehalten worden sein (s.o.).
4. Es greift kein Kündigungsschutz zugunsten des Arbeitnehmers ein:
a) Kündigungsverbote
b) Mitwirkungsgebote des Betriebsrates nach Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
c) Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
Liegt ein Kündigungsverbot vor, so ist die Kündigung unwirksam und das Arbeitsverhältnis
besteht weiter. [...]
1vgl. Harald Roth: Das Einzelarbeitsverhältnis, AKAD-Lerneinheit Arbeitsrecht 103, Stuttgart 2000, Seite 54
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundsätzliches zur Kündigung
- 1.1 Definition
- 1.2 Arten von Kündigungen
- 1.2.1 Die außerordentliche Kündigung
- 1.2.2 Die ordentliche Kündigung
- 2. Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- 3. Die betriebsbedingte Kündigung
- 3.1 Begriffsdefinition
- 3.2 Voraussetzungen für die Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung
- 3.2.1 Betriebliche Erfordernisse
- 3.2.2 Dringlichkeit der Kündigung
- 3.2.3 Interessenabwägung
- 4. Die Sozialauswahl
- 4.1 Begründung der sozialen Auswahl
- 4.2 Systematik der Sozialauswahl
- 4.3 Sonderfälle
- 4.4 Soziale Auswahlkriterien
- 4.4.1 Alte Fassung des KSchG
- 4.4.2 Neue Fassung des KSchG
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat behandelt die betriebsbedingte Kündigung im deutschen Arbeitsrecht. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen, Voraussetzungen und die praktische Anwendung der betriebsbedingten Kündigung zu erläutern.
- Definition und Arten von Kündigungen
- Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) und seine Anwendbarkeit
- Voraussetzungen für eine wirksame betriebsbedingte Kündigung
- Die Rolle der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen
- Soziale Auswahlkriterien im Kontext des KSchG
Zusammenfassung der Kapitel
1. Grundsätzliches zur Kündigung: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in das Thema Kündigung im Arbeitsrecht. Es definiert den Begriff Kündigung und erläutert die Unterscheidung zwischen außerordentlichen und ordentlichen Kündigungen. Die Bedeutung der Schriftform, der Fristen und der strengen gesetzlichen Vorgaben wird hervorgehoben. Der existenzielle Einfluss der Kündigung auf den Arbeitnehmer wird betont, indem die Rechte des Betriebsrates und der Kündigungsschutz als wichtige Schutzmechanismen herausgestellt werden. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die strengen formalen und rechtlichen Anforderungen zu beachten, um eine wirksame Kündigung zu gewährleisten.
2. Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG): Dieses Kapitel beschreibt das Kündigungsschutzgesetz und seine Anwendungsbedingungen. Es erläutert die Voraussetzungen für dessen Geltung (Betriebsgröße, Dauer des Arbeitsverhältnisses) und die Bedeutung des sozial gerechtfertigten Kündigungsgrundes. Das Kapitel benennt die drei Kündigungsgründe nach dem KSchG (personen-, verhaltens- und betriebsbedingt) und legt den Fokus auf die Notwendigkeit eines vernünftigen Grundes für eine wirksame Kündigung. Es verdeutlicht, dass selbst bei Vorliegen eines dieser Gründe die Kündigung unter bestimmten Umständen (z.B. Verstoß gegen Auswahlrichtlinien) unwirksam sein kann. Der Schutz des Arbeitnehmers durch das KSchG steht im Mittelpunkt.
3. Die betriebsbedingte Kündigung: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der betriebsbedingten Kündigung. Es definiert den Begriff und erläutert die notwendigen Voraussetzungen für eine wirksame Kündigung dieser Art: dringende betriebliche Erfordernisse, die Unmöglichkeit der Weiterbeschäftigung und die Abwesenheit anderer Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Bedeutung der Interessenabwägung und die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme werden hervorgehoben. Die Darstellung impliziert die Komplexität der Prüfung und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung der Interessen aller Beteiligten.
4. Die Sozialauswahl: Dieses Kapitel behandelt die Sozialauswahl im Kontext betriebsbedingter Kündigungen. Es beschreibt die Begründung und Systematik der Sozialauswahl, einschließlich Sonderfälle und die unterschiedlichen Kriterien nach der alten und neuen Fassung des KSchG. Die Bedeutung der fairen und gerechten Auswahl von Arbeitnehmern bei Kündigungen wird betont, um die soziale Härte der Maßnahme zu minimieren. Der Vergleich der alten und neuen Fassung des KSchG unterstreicht die Entwicklung des Kündigungsschutzes im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Betriebsbedingte Kündigung, Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Sozialauswahl, ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung, Arbeitnehmerrechte, betriebliche Erfordernisse, Interessenabwägung, Kündigungsgründe, wirksame Kündigung, Arbeitsschutz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Referat: Betriebsbedingte Kündigung
Was ist der Gegenstand dieses Referats?
Das Referat behandelt die betriebsbedingte Kündigung im deutschen Arbeitsrecht. Es erklärt die rechtlichen Grundlagen, Voraussetzungen und die praktische Anwendung der betriebsbedingten Kündigung.
Welche Themen werden im Referat behandelt?
Das Referat umfasst folgende Themen: Definition und Arten von Kündigungen, das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) und seine Anwendbarkeit, Voraussetzungen für eine wirksame betriebsbedingte Kündigung, die Rolle der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen und soziale Auswahlkriterien im Kontext des KSchG.
Was wird unter "Grundsätzliches zur Kündigung" verstanden?
Dieses Kapitel liefert eine Einführung in das Thema Kündigung im Arbeitsrecht. Es definiert den Begriff Kündigung, erläutert die Unterscheidung zwischen außerordentlichen und ordentlichen Kündigungen und betont die Bedeutung der Schriftform, Fristen und gesetzlichen Vorgaben. Der existenzielle Einfluss der Kündigung auf den Arbeitnehmer und die Schutzmechanismen durch Betriebsrat und Kündigungsschutz werden hervorgehoben.
Was ist das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) und wann gilt es?
Das Kapitel beschreibt das Kündigungsschutzgesetz und seine Anwendungsbedingungen. Es erläutert die Voraussetzungen für dessen Geltung (Betriebsgröße, Dauer des Arbeitsverhältnisses) und die Bedeutung des sozial gerechtfertigten Kündigungsgrundes. Die drei Kündigungsgründe nach dem KSchG (personen-, verhaltens- und betriebsbedingt) werden genannt, und es wird betont, dass selbst bei Vorliegen eines Grundes die Kündigung unter Umständen unwirksam sein kann.
Welche Voraussetzungen muss eine betriebsbedingte Kündigung erfüllen?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die betriebsbedingte Kündigung. Es definiert den Begriff und erläutert die notwendigen Voraussetzungen: dringende betriebliche Erfordernisse, die Unmöglichkeit der Weiterbeschäftigung und das Fehlen anderer Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Bedeutung der Interessenabwägung und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme werden hervorgehoben.
Was versteht man unter Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen?
Dieses Kapitel behandelt die Sozialauswahl im Kontext betriebsbedingter Kündigungen. Es beschreibt die Begründung und Systematik der Sozialauswahl, einschließlich Sonderfälle und die unterschiedlichen Kriterien nach der alten und neuen Fassung des KSchG. Die Bedeutung der fairen und gerechten Auswahl von Arbeitnehmern wird betont.
Welche Schlüsselwörter sind im Zusammenhang mit dem Referat relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Betriebsbedingte Kündigung, Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Sozialauswahl, ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung, Arbeitnehmerrechte, betriebliche Erfordernisse, Interessenabwägung, Kündigungsgründe, wirksame Kündigung, Arbeitsschutz.
Welche Arten von Kündigungen werden unterschieden?
Das Referat unterscheidet zwischen der außerordentlichen und der ordentlichen Kündigung. Die jeweiligen Unterschiede in Bezug auf die Voraussetzungen und die Folgen werden im Detail behandelt.
Wie wird die Sozialauswahl im Detail erklärt?
Die Sozialauswahl wird im Detail erläutert, indem die Begründung, die Systematik, Sonderfälle und die Kriterien nach alter und neuer Fassung des KSchG behandelt werden. Der Fokus liegt auf der fairen und gerechten Auswahl der Arbeitnehmer, um die soziale Härte der Maßnahme zu minimieren.
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema?
Zusätzliche Informationen zum Thema können in einschlägiger arbeitsrechtlicher Literatur und Rechtsprechung gefunden werden. Die im Referat genannten Schlüsselwörter unterstützen die Suche.
- Quote paper
- Ingo Caron (Author), 2004, Die betriebsbedingte Kündigung (mit Neuerungen ab 01.01.2004), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/22757