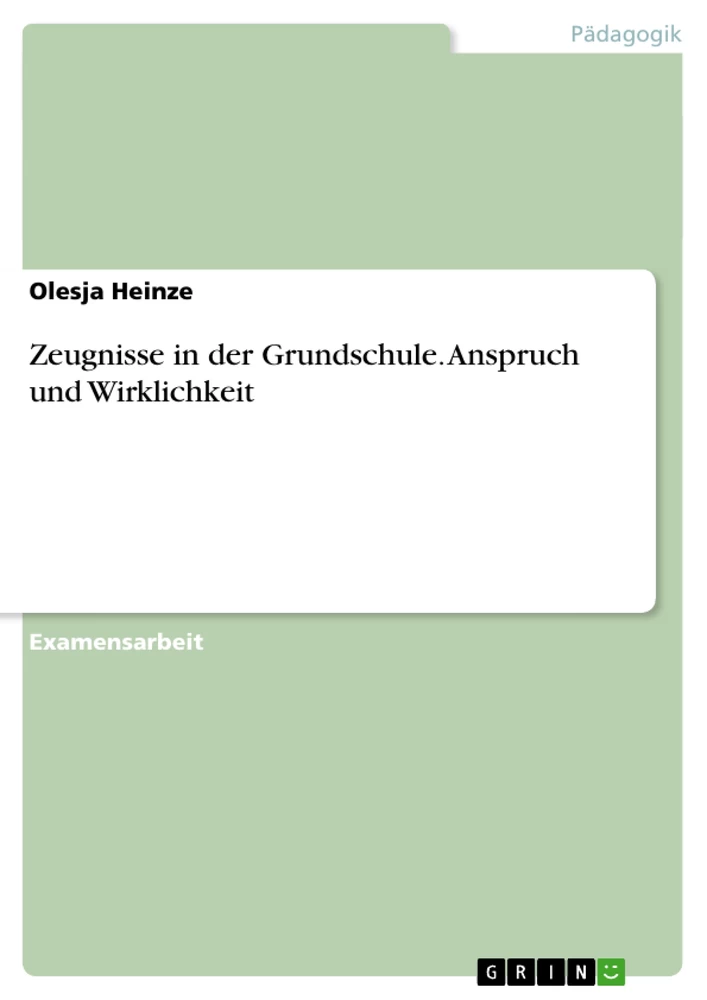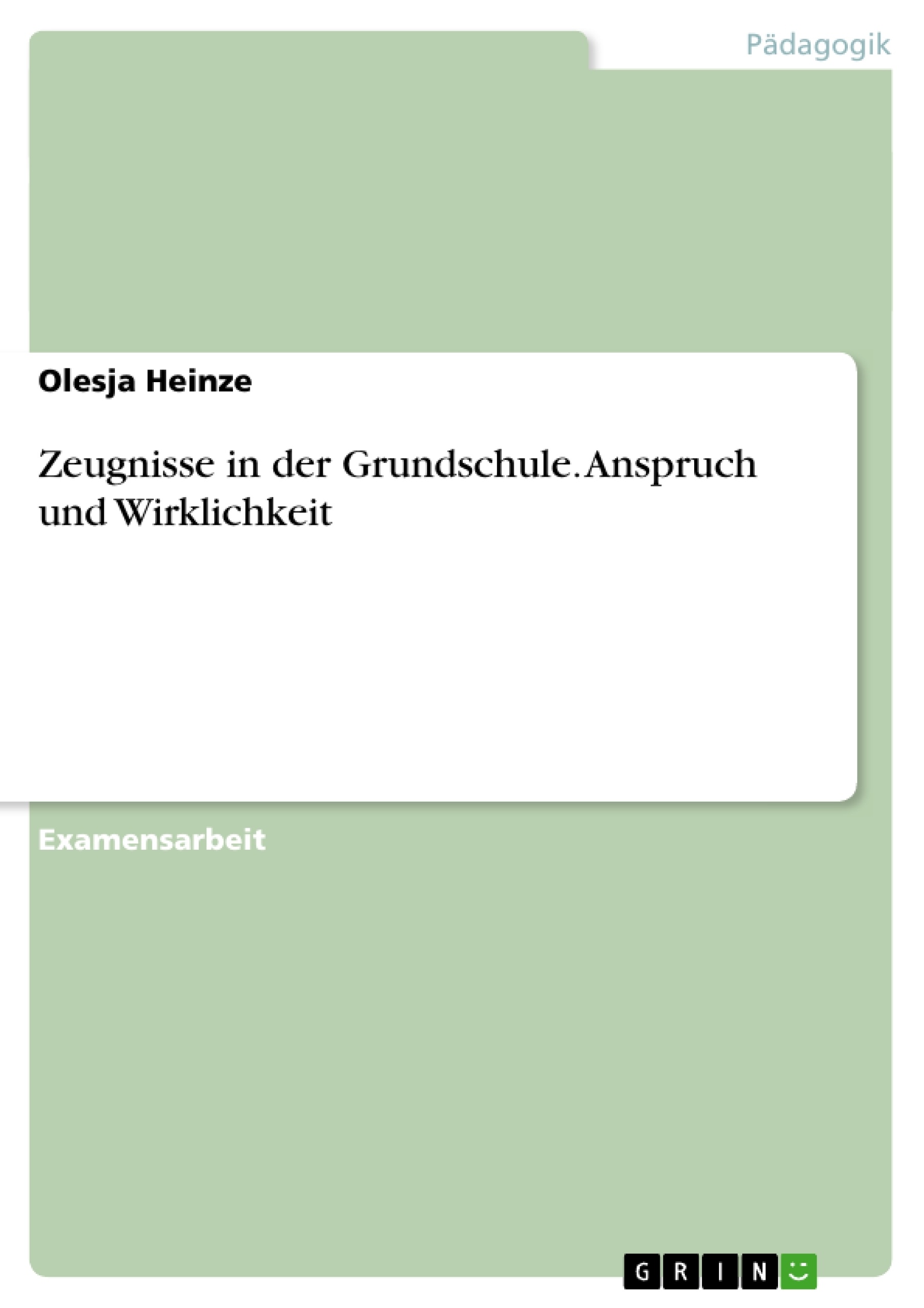Angesichts der entscheidenden Bedeutung von Zensuren und
Zeugnissen im Leben von Kindern und Jugendlichen wundert es kaum, dass schulische Leistungsmessung und -beurteilung seit langem ein zentrales Thema der Schulpädagogik darstellt. Wer sich damit beschäftigt, wird schnell feststellen, dass es kaum ein anderes Thema gibt, bei dem die Meinungen so weit auseinander gehen.
Seit die Kritik an der Ziffernbenotung in den zwanziger Jahren laut wurde, sind alternative Formen pädagogischer Bewertung erprobt und vielfach diskutiert worden. Das Ergebnis dieser Diskussion war die Empfehlung der Kultusminister, in den ersten beiden Grundschuljahren Noten durch Verbalbeurteilung zu ersetzen. Damit verband sich u.a. die Hoffnung, Kindern eine fördernde und individuelle Leistungsbestätigung geben zu können. In meiner Arbeit werde ich zunächst einmal versuchen, einen Überblick über das komplexe Problem der Leistung in der Schule zu geben. Ferner soll der Frage nachgegangen werden, ob die verschiedenen Funktionen der schulischen Leistungsbewertung durch Ziffernzensuren erfüllt werden können.
Anschließend soll untersucht werden, welche Vorteile man sich von der
Zeugnisreform in der Grundschule versprach und inwieweit Zeugnisse in Form von Wortgutachten (auch Lernentwicklungsberichte oder Berichtszeugnisse genannt) den angestrebten Intentionen gerecht werden konnten.
Um einen Einblick in die Meinungen und Einstellungen von Eltern zu Noten und Berichtszeugnissen zu bekommen, werden die wichtigsten Ergebnisse von Elternbefragungen vorgestellt und anschließend mit den Resultaten des eigenen Elterninterviews verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zum Begriff der Leistung
- 1.2 Begründung der Leistung in der Schule
- 1.3 Gesellschaftlicher Leistungsbegriff
- 1.4 Pädagogischer Leistungsbegriff
- 1.5 Fazit
- 2. Einführung in die Thematik schulischer Leistungsbewertung
- 2.1 Zur Entstehungsgeschichte von Zensuren und Zeugnissen
- 2.2 Leistungsbewertung in der Grundschule: Rechtsgrundlagen und amtliche Bestimmungen
- 2.3 Zeugnisregelungen in der Primarstufe
- 2.4 Fazit
- 3. Bezugsnormen der Leistungsbewertung
- 3.1 Subjektorientierte (individuelle) Bezugsnorm
- 3.2 Lernzielorientierte (sachliche) Bezugsnorm
- 3.3 Vergleichsorientierte (soziale) Bezugsnorm
- 3.4 Fazit
- 4. Zur Messqualität von Leistungsbeurteilungen
- 4.1 Objektivität
- 4.2 Reliabilität
- 4.3 Validität
- 4.4 Störfaktoren und Urteilsfehler bei der Leistungsbewertung
- 4.5 Fazit
- 5. Funktionen der Leistungsbewertung
- 5.1 Gesellschaftliche Funktionen
- 5.2 Pädagogische Funktionen
- 5.3 Relevanz der Funktionen in den verschiedenen Schulstufen
- 5.4 Notenzeugnisse: Ansprüche und Realität
- 6. Lernentwicklungsberichte als Alternative zum Notenzeugnis
- 6.1 Begründung für Zeugnisse ohne Zensuren
- 6.2 Zur Entstehungsgeschichte von Lernentwicklungsberichten
- 7. Berichtszeugnisse: Ansprüche und Realität
- 7.1 Motive, die mit verbaler Beurteilungsform verbunden werden
- 7.2 Bedenken und Einwände gegen Berichtszeugnisse
- 7.3 Aktueller Forschungsstand zur Praxis der Berichtszeugnisse
- 7.3.1 Ergebnisse von Zeugnisanalysen und Lehrerbefragungen
- 7.3.2 Fazit
- 7.4 Ergebnisse von Elternbefragungen
- 7.5 Eigene Elternbefragung
- 7.5.1 Informationen zum Ablauf der Befragung
- 7.5.2 Auswertung der Ergebnisse und Vergleich mit anderen Elternbefragungen
- 7.5.4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Problematik der Leistungsbewertung in der Grundschule zu beleuchten und die verschiedenen Funktionen von Zensuren und Zeugnissen zu analysieren. Dabei wird insbesondere die Frage untersucht, ob die Zeugnisreform, die Noten durch Lernentwicklungsberichte ersetzt, den angestrebten Zielen gerecht wird.
- Der Begriff „Leistung“ und seine verschiedenen Bedeutungen
- Die Funktionen der Leistungsbewertung in der Schule
- Die verschiedenen Bezugsnormen der Leistungsbewertung
- Die Vor- und Nachteile von Zensuren und Lernentwicklungsberichten
- Die Ergebnisse von Elternbefragungen zur Bewertung von Zensuren und Berichtszeugnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Leistungsbewertung in der Schule ein und beleuchtet die Bedeutung von Zensuren und Zeugnissen für den weiteren Bildungsweg von Kindern und Jugendlichen. Sie erläutert die komplexe Problematik, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen individueller Förderung und gesellschaftlichen Leistungsanforderungen ergibt.
Kapitel 1 widmet sich dem Begriff „Leistung“ und beleuchtet seine unterschiedlichen Bedeutungen im gesellschaftlichen und pädagogischen Kontext. Die Vielschichtigkeit des Begriffs wird anhand seiner sprachgeschichtlichen Entwicklung und verschiedenen Definitionen verdeutlicht.
Kapitel 2 führt in die Thematik der schulischen Leistungsbewertung ein und beleuchtet die Entstehungsgeschichte von Zensuren und Zeugnissen. Es geht auf die Rechtsgrundlagen und amtlichen Bestimmungen sowie auf die spezifischen Zeugnisregelungen in der Primarstufe ein.
Kapitel 3 behandelt die verschiedenen Bezugsnormen der Leistungsbewertung, nämlich die subjektorientierte, lernzielorientierte und vergleichsorientierte Bezugsnorm. Die Vor- und Nachteile jeder Bezugsnorm werden diskutiert und es wird herausgestellt, welche Bedeutung sie für die Beurteilungspraxis hat.
Kapitel 4 untersucht die Messqualität von Leistungsbeurteilungen und analysiert die Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Es werden Störfaktoren und Urteilsfehler bei der Leistungsbewertung aufgezeigt, die die Genauigkeit der Beurteilung beeinflussen können.
Kapitel 5 beleuchtet die gesellschaftlichen und pädagogischen Funktionen der Leistungsbewertung und diskutiert die Bedeutung der jeweiligen Funktionen in den verschiedenen Schulstufen. Es wird herausgestellt, inwieweit Notenzeugnisse den Anforderungen gerecht werden, die an sie gestellt werden.
Kapitel 6 befasst sich mit Lernentwicklungsberichten als Alternative zum Notenzeugnis und beleuchtet die Begründungen für die Einführung von Zeugnissen ohne Zensuren. Die Entstehungsgeschichte von Lernentwicklungsberichten wird nachgezeichnet und die Chancen und Herausforderungen dieser Form der Leistungsbewertung werden diskutiert.
Kapitel 7 widmet sich der Praxis von Berichtszeugnissen und analysiert die Motive, die mit der verbalen Beurteilungsform verbunden werden. Es werden Bedenken und Einwände gegen Berichtszeugnisse sowie der aktuelle Forschungsstand zu ihrer Praxis beleuchtet. Die Ergebnisse von Zeugnisanalysen, Lehrerbefragungen und Elternbefragungen werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen Leistungsbewertung, Schulzeugnisse, Zensuren, Lernentwicklungsberichte, Berichtszeugnisse, Bezugsnormen, Objektivität, Reliabilität, Validität, gesellschaftliche Funktionen, pädagogische Funktionen, Elternbefragungen, Vergleichsstudien, Grundschule.
- Arbeit zitieren
- Olesja Heinze (Autor:in), 2003, Zeugnisse in der Grundschule. Anspruch und Wirklichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/22475