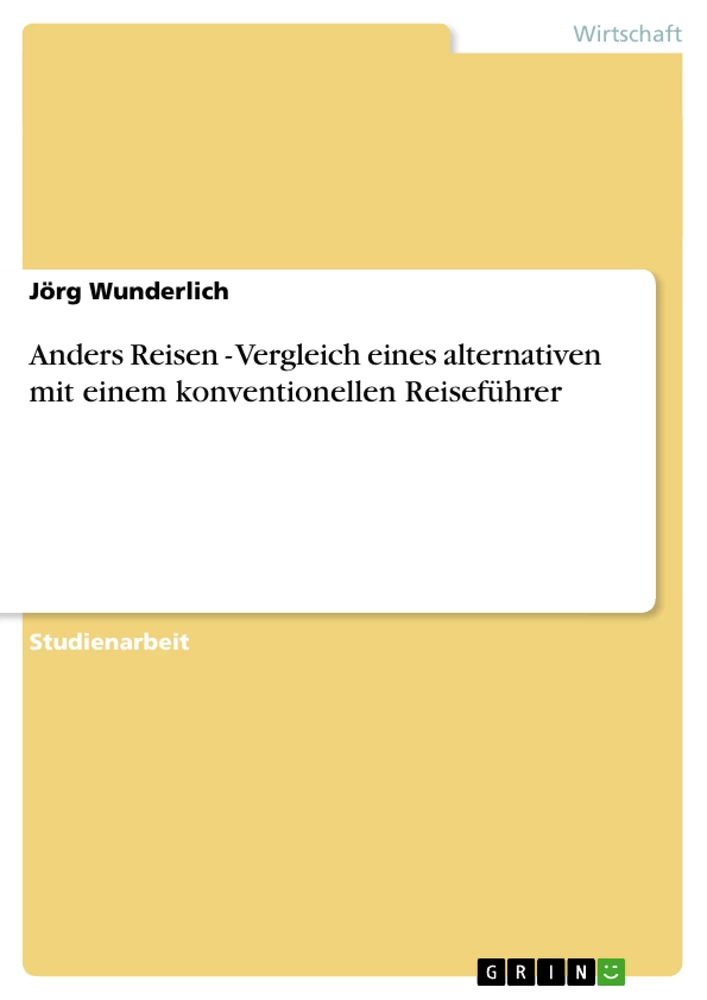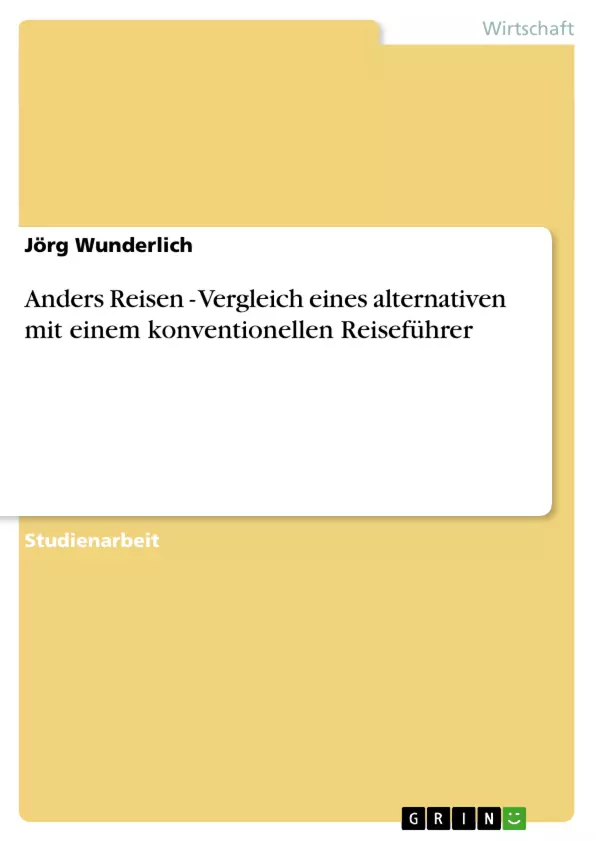Gegenstand dieser Arbeit ist die vergleichende und bewertende Betrachtung des Frankreich-Reiseführers von Günther Liehr aus der rororo- Reihe „anders reisen“ mit dem „Allianz-Reiseführer Frankreich“ von Baedeker.( im folgenden mit ANDERS REISEN bzw. BAEDEKER bezeichnet ) Beide Bücher sind zu Beginn der Achtziger Jahre erschienen und repräsentieren jeweils für sich einen komplett anderen, ja sogar gegensätzlichen Background hinsichtlich Zielgruppe, Autoren, Verlag ,Inhalt und das zu vermittelnde Frankreichbild.
Ausgehend von der Bemerkung GYRS´,dass das, was“ Reiseführer aus der
kulturellen Wirklichkeit ausschneiden, reduzieren oder ausklammern, sehr aufschlußreich“(1) ist , kann man sie also genauso gut über die Kultur und Gesellschaft Ihrer Herausgeberländer bzw. die Identität ihrer jeweiligen Leser-Zielgruppen untersuchend befragen.
Neben den beiden originären Quelltexten habe ich Forschungsarbeiten und Aufsätze aus kultur- , literatur- und komunikationswissenschaftlicher Sicht herangezogen, die sich ganz konkret mit Reiseführern und Reiseliteratur beschäftigen. Der selbstverständliche Gebrauch des attributes „anders“ veranlasste mich zu einigen einleitenden Überlegungen und Betrachtungen , die als Mini-Essay gelesen werden sollten. Beim Detailvergleich bin ich schrittweise nach bestimmten Indikatoren vorgegangen und habe meine Vergleichsergebnisse, wenn es sich anbot, kapitelweise in einem
Fazit formuliert. Aus diesem Grund verzichte ich auf ein zusammenfassendes Schlussresümee.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand der Arbeit, Literatur und Methode
- Reiseführer als Literarische Gattung
- Exkursversuch über die Kategorie des „anderen“
- Detailvergleich „Anders Reisen“ – „Baedeker“
- Äußerliches: Format, Aufmachung, Layout
- Antizipierte Reiseformen und Zielgruppen
- Inhaltliche Gliederung
- Texte, Informationen und Sprache
- Fotos, Grafiken und Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Vergleich zweier Frankreich-Reiseführer – „Anders Reisen“ von Günther Liehr und „Allianz-Reiseführer Frankreich“ von Baedeker – und untersucht, wie sie unterschiedliche Perspektiven auf Frankreich vermitteln. Die Arbeit analysiert die beiden Reiseführer anhand verschiedener Kriterien, darunter Format, Aufmachung, Zielgruppen, Inhalt und Sprache. Dabei wird auch der Einfluss der Herausgeberländer und die Identität der jeweiligen Leser-Zielgruppen berücksichtigt.
- Reiseführer als literarische Gattung und ihre Rolle im Tourismus
- Die Kategorie des „anderen“ und ihre Bedeutung im Kontext von Reiseführern
- Der Vergleich zweier unterschiedlicher Reiseführer-Konzepte
- Analyse der Inhalte und der Sprache der Reiseführer
- Der Einfluss der Herausgeberländer auf die Darstellung Frankreichs
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel „Gegenstand der Arbeit, Literatur und Methode“ führt in die Thematik ein, stellt die beiden zu vergleichenden Reiseführer vor und erläutert die methodische Vorgehensweise.
- Das Kapitel „Reiseführer als Literarische Gattung“ beleuchtet die Gattung des Reiseführers in der Literaturwissenschaft, betrachtet seine Funktion im Tourismus und untersucht die Rolle, die er in der Kommunikation zwischen Reisenden und Bereisten spielt.
- Das Kapitel „Exkursversuch über die Kategorie des „anderen““ analysiert die Kategorie des „anderen“ in Bezug auf die Konstruktion von Identität und die Legitimierung von Machtverhältnissen.
Schlüsselwörter
Reiseführer, Reiseliteratur, Frankreich, "Anders Reisen", Baedeker, Vergleich, Kultur, Identität, Tourismus, Kommunikation, "Anderes", Dualität, Hegemonie, Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Jörg Wunderlich (Author), 2004, Anders Reisen - Vergleich eines alternativen mit einem konventionellen Reiseführer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/21701