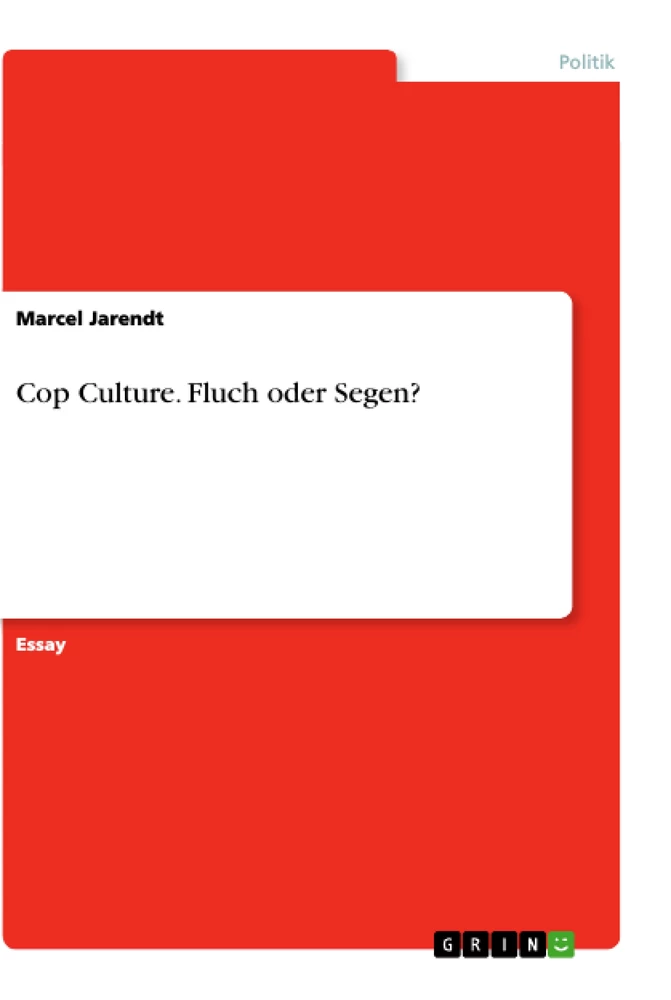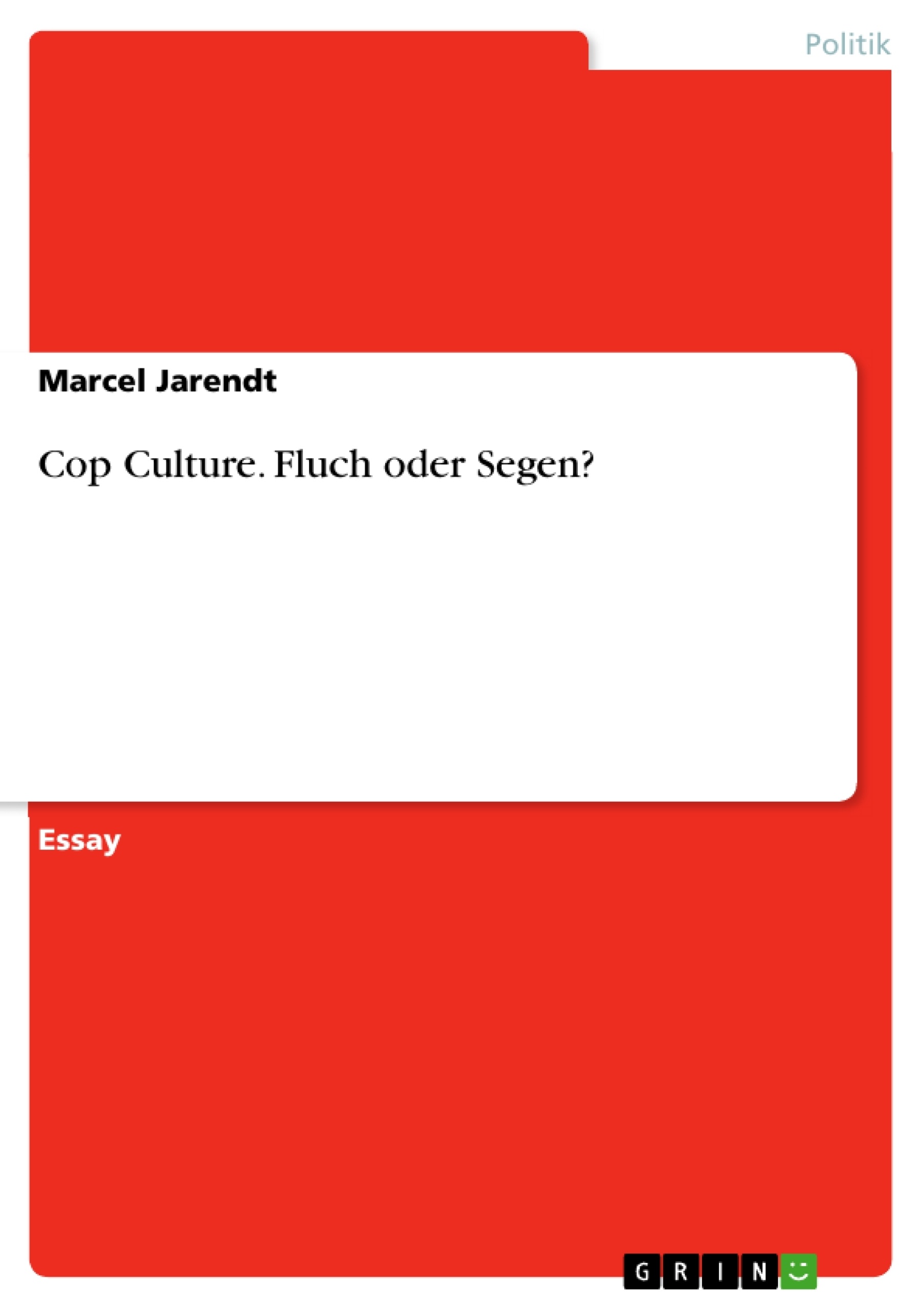Im Vorwort der zweiten Auflage des Buches "Cop Culture – Der Alltag des Gewaltmonopols" beschreibt der Autor, Rafael Behr, die Problematik, in der Öffentlichkeit über Kultur und Kulturen der Polizei nachzudenken oder zu reden. Gegenargumente wie zum Beispiel: "Das gab es vielleicht früher einmal" oder "das kann woanders so sein, aber nicht bei uns" wurden dem Autor entgegen gebracht.
Da das Thema mittlerweile aber mehr und mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, sowie in der Organisations- und Personalentwicklung der Polizei substantieller diskutiert wird, empfand ich es als lohnenswert, mich relativ zeitnah zum Ausbildungsbeginn mit diesem Thema im Rahmen einer wissenschaftlichen Ausarbeitung auseinander zu setzen.
Glaubt man nämlich der einseitigen Berichterstattung der Presse, stellen die Polizeivollzugsbeamten regelmäßig "Loyalität über Integrität". Wie steht es also wirklich um den Umgang mit dem Gewaltmonopol? Wie weit geht der Zusammenhalt der Kollegen untereinander? Werden Verfahren gegen Kollegen tatsächlich eingestellt, weil die anderen Kollegen angeben, nichts gesehen, beziehungsweise bewusst weg geschaut haben? Gibt es also Kulturen innerhalb der Polizei?
Bevor diesen und weiteren Fragen nachgegangen wird, findet eine kurze Erläuterung der in der Arbeit häufig verwendeten Begrifflichkeiten statt. Anschließend erfolgt eine Beleuchtung des Begriffes der Polizeikultur als normatives Gerüst zur Polizeiarbeit in Abgrenzung zur Cop Culture als subkulturelles Handlungsmuster der einzelnen Polizeibeamten. Im Verlauf der Arbeit wird der Begriff der Cop Culture näher erläutert. Es folgt eine Einordnung der Cop Culture zwischen Korpsgeist und Binnenkohäsion. Weiterhin werden die Effekte der Cop Culture erläutert, die Schutzfunktion als positiver Aspekt und die Problematik der Positionierung zwischen Loyalität und Integrität auf der anderen Seite. Im Anschluss an diese theoretischen Erläuterungen folgen Gesprächsausschnitte aus der polizeilichen Praxis, um die Thesen zu bekräftigen.
Ziel dieser Arbeit ist die Veranschaulichung von Vor- und Nachteilen des Phänomens "Cop Culture".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 3. Abgrenzung von Polizeikultur und Polizistenkultur
- 4. Cop Culture - Korpsgeist oder Binnenkohäsion?
- 5. Effekte der Cop Culture
- 5.1 Schutzfunktionen der Cop-Culture
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Cop Culture innerhalb der Polizeikultur. Ziel ist es, Vor- und Nachteile dieser Subkultur zu veranschaulichen und ihre Auswirkungen auf das Handeln von Polizeibeamten zu beleuchten. Die Arbeit stützt sich auf bestehende Literatur und praktische Beispiele.
- Begriffsbestimmung von Polizeikultur und Cop Culture
- Abgrenzung von Cop Culture und Korpsgeist/Binnenkohäsion
- Schutzfunktionen und negative Auswirkungen der Cop Culture
- Analyse der Handlungsmuster von Polizeibeamten im Kontext der Cop Culture
- Diskussion der ethischen Implikationen der Cop Culture
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um Polizeikultur und Cop Culture, die zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit und der polizeilichen Organisationsentwicklung rückt. Sie thematisiert die kontroversen öffentlichen Diskussionen und die einseitige Berichterstattung in der Presse, die oft von einer "Loyalität über Integrität" bei Polizeibeamten ausgeht. Die Arbeit stellt relevante Fragen zum Umgang mit dem Gewaltmonopol und den internen Zusammenhalt innerhalb der Polizei, wobei Begrifflichkeiten wie Polizeikultur und Cop Culture erläutert werden. Das Ziel der Arbeit ist die Veranschaulichung der Vor- und Nachteile des Phänomens "Cop Culture".
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel erläutert kurz die für die Arbeit relevanten Begriffe, insbesondere "Cop Culture" als Ermöglichungsform und Überschreitung des Gewaltmonopols, "Polizeikultur" als normatives Gerüst, "Korpsgeist" als Abschottung gegenüber einer feindlichen Außenwelt und "Binnenkohäsion" als aus sozialer Nähe gewachsene Gemeinschaft. Es legt die Grundlage für das Verständnis der zentralen Konzepte der Arbeit.
3. Abgrenzung von Polizeikultur und Polizistenkultur: Dieses Kapitel grenzt Polizeikultur als normatives System des "guten" Polizeihandelns von Cop Culture als subkulturelles Handlungsmuster ab. Es wird argumentiert, dass die Polizeikultur ein normatives Bild vermittelt, aber keine konkreten Handlungsvorschriften liefert. Cop Culture hingegen wird als subkulturelle Identität und Erklärung für Handlungsmuster einzelner Beamter verstanden. Die visuelle Darstellung eines Modells verdeutlicht die Wechselwirkung zwischen kollektiver und subkultureller Identität.
4. Cop Culture - Korpsgeist oder Binnenkohäsion?: Dieses Kapitel diskutiert die Frage, ob Cop Culture eher als Korpsgeist oder als Binnenkohäsion zu verstehen ist. Es wird argumentiert, dass Binnenkohäsion das Handlungsmuster der Polizisten besser beschreibt als Korpsgeist. Obwohl ein normativ abschließendes Ergebnis noch aussteht, wird die These vertreten, dass Cop Culture als Binnenkohäsion im folgenden Kapitel als Erklärungsmuster für Handlungsweisen herangezogen werden kann.
5. Effekte der Cop Culture: Dieses Kapitel beginnt mit der Erläuterung der Schutzfunktionen der Cop Culture, die sowohl die Durchsetzung staatlicher Gewalt als auch die Tolerierung von Rechtmäßigkeitsüberschreitungen umfasst. Weitere Ausführungen in diesem Kapitel werden in dieser Vorschau nicht wiedergegeben.
Schlüsselwörter
Cop Culture, Polizeikultur, Korpsgeist, Binnenkohäsion, Gewaltmonopol, Loyalität, Integrität, Polizeiarbeit, Subkultur, Handlungsmuster, ethische Implikationen.
FAQ: Analyse der Cop Culture innerhalb der Polizeikultur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Phänomen der "Cop Culture" innerhalb der Polizeikultur. Sie untersucht die Vor- und Nachteile dieser Subkultur und deren Auswirkungen auf das Handeln von Polizeibeamten. Die Analyse stützt sich auf Literaturrecherche und praktische Beispiele.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Begriffsbestimmung von Polizeikultur und Cop Culture, Abgrenzung von Cop Culture und Korpsgeist/Binnenkohäsion, Schutzfunktionen und negative Auswirkungen der Cop Culture, Analyse der Handlungsmuster von Polizeibeamten im Kontext der Cop Culture und Diskussion der ethischen Implikationen der Cop Culture.
Wie werden Polizeikultur und Cop Culture definiert?
Polizeikultur wird als das normative Gerüst des "guten" Polizeihandelns verstanden. Cop Culture hingegen wird als subkulturelles Handlungsmuster, als Ermöglichungsform und Überschreitung des Gewaltmonopols definiert. Korpsgeist wird als Abschottung gegenüber einer feindlichen Außenwelt beschrieben, während Binnenkohäsion eine aus sozialer Nähe gewachsene Gemeinschaft darstellt.
Wie werden Polizeikultur und Cop Culture abgegrenzt?
Die Arbeit grenzt die normative Polizeikultur von der subkulturellen Cop Culture ab. Polizeikultur vermittelt ein normatives Bild, liefert aber keine konkreten Handlungsvorschriften. Cop Culture wird als subkulturelle Identität und Erklärung für Handlungsmuster einzelner Beamter verstanden. Ein Modell verdeutlicht die Wechselwirkung zwischen kollektiver und subkultureller Identität.
Ist Cop Culture eher Korpsgeist oder Binnenkohäsion?
Die Arbeit argumentiert, dass Binnenkohäsion das Handlungsmuster von Polizisten besser beschreibt als Korpsgeist. Obwohl ein normativ abschließendes Ergebnis noch aussteht, wird die These vertreten, dass Cop Culture als Binnenkohäsion im weiteren Verlauf als Erklärungsmuster für Handlungsweisen herangezogen werden kann.
Welche Auswirkungen hat die Cop Culture?
Die Arbeit beleuchtet die Schutzfunktionen der Cop Culture, die sowohl die Durchsetzung staatlicher Gewalt als auch die Tolerierung von Rechtmäßigkeitsüberschreitungen umfasst. Weitere Auswirkungen werden im Haupttext detailliert behandelt (in dieser Vorschau nicht vollständig wiedergegeben).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Cop Culture, Polizeikultur, Korpsgeist, Binnenkohäsion, Gewaltmonopol, Loyalität, Integrität, Polizeiarbeit, Subkultur, Handlungsmuster, ethische Implikationen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Vor- und Nachteile des Phänomens "Cop Culture" zu veranschaulichen und dessen Auswirkungen auf das Handeln von Polizeibeamten zu beleuchten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffsbestimmungen, Abgrenzung von Polizeikultur und Polizistenkultur, Cop Culture - Korpsgeist oder Binnenkohäsion?, und Effekte der Cop Culture.
- Quote paper
- Marcel Jarendt (Author), 2013, Cop Culture. Fluch oder Segen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/215496